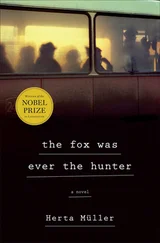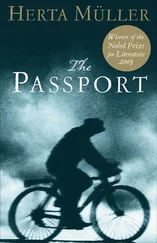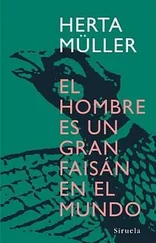Ich habe in einem Ihrer Essays gelesen, dass Sie in der Schule einmal ein Parteigedicht aufsagen mussten, sie dann aber ein Gedicht über eine Schwalbe vortrugen. War das schon eine frühe Form des ›Eigensinns‹, aus dem heraus später Ihre Literatur entstanden ist.
Das war noch im Kindergarten, irgendwann im Winter. Das Gedicht handelt von der Schwalbe als Maurer. Ich kann mich nur noch an die erste Zeile erinnern: Wer war der kleine Maurer? Es ging darum, dass sich die Schwalbe ein Nest aus Schlamm mauert. Weihnachten als christliches Fest war in dieser Zeit offiziell abgeschafft, es gab nur das Frostmännchen, das allerdings erst am 1. Januar kam, die Rumänen hatten es von den Sowjets übernommen. Dann erst gab es auch Tannenbäume, nicht bereits an Weihnachten. Ich sollte an einer Frostmännchen-Feier ein Parteigedicht aufsagen, das meine Mutter von der Kindergartendirektion erhalten hatte. Meine Mutter versuchte vergeblich, es mir einzubläuen. Da ich noch nicht lesen konnte, hat sie es mir wieder und wieder vorgesagt, aber vergeblich. Ich lernte es nicht, jedenfalls nicht so, dass ich es im Kulturheim auf der Bühne hätte vortragen können. Daher sagte ich das Gedicht mit der Schwalbe auf, weil ich mir dachte, wenn ich gar nichts sage, bekomme ich bei der anschließenden Tombola auch keine Weihnachtspäckchen und keinen Neujahrs-Frostmann geschenkt. Das war dann ein Affront, ja, aber was konnte man einem Kind schon vorwerfen?
Ich würde gerne nochmal auf Ihre Lektüren zu sprechen kommen. Wie sind Sie zum Lesen, insbesondere von deutschsprachiger Literatur gekommen?
Zum Lesen bin ich in der Stadt, auf dem Gymnasium gekommen, zuerst anhand von Schulbüchern. Paul Celan zum Beispiel war darin abgedruckt, sein Gedicht »Die Todesfuge«, wenn auch nur teilweise, weil verschwiegen werden musste, dass die Konzentrationslager, in denen Celans Eltern ermordet worden waren, unter rumänischer Leitung gestanden hatten. Das waren natürlich immer die Faschisten gewesen, die hießen in Rumänien stets bloß die Faschisten; mit denen hatte Rumänien offiziell nichts zu tun. Dass Celan Suizid beging, wurde ebenfalls nicht gesagt, das hatte in einem sozialistischen Lehrbuch nichts zu suchen. Die Rumänen haben zwar so getan, als wären sie stets Antifaschisten gewesen, aber das ist falsch: Rumänien war unter Antonescu ein faschistischer Staat und Verbündeter Hitlers.
Ich habe in dieser Zeit auf dem Lyzeum aus Neugier angefangen zu lesen und weil ich dort eine Reihe von jungen Menschen kennenlernte, unter anderem Ernest Wichner und Gerhard Ortinau, die lasen alle. Für uns, die wir alle Deutsch sprachen, war insbesondere das Goethe-Institut in Bukarest wichtig. Rolf Bossert, einer aus unserer Gruppe, lebte in Bukarest und stellte den Kontakt her. Wir fuhren nach Bukarest und liehen uns Bücher im Goethe-Institut aus. Mit der Post hätten wir sie uns nicht schicken lassen können, weil der Geheimdienst die Päckchen gekapert und uns bei den Beschäftigten im Goethe-Institut dann als unzuverlässig verleumdet hätte, um so zu verhindern, dass wir uns weiter Bücher ausleihen können. Das Lesen führte dazu, dass wir uns vom Staat zu distanzieren begannen. Und ’68 hatte an unserer zunehmend kritischen Haltung ebenfalls einen Anteil. Sehr interessiert waren wir an Essays aus dem »Kursbuch«. Die Autoren dieser Zeitschrift mochten in einer Demokratie leben, aber wie wir hatten auch sie Eltern, die Nazis gewesen waren. Darüber war bis dahin dort so wenig geredet worden wie bei uns.
Andere Bücher bekamen wir aus dem Ausland, von Bekannten, die bereits ausgewandert waren, und über »Internationes«. Dafür musste man eine Begründung schreiben, was wir auch taten, das heißt wir erfanden eine. Beispielsweise schrieben wir, dass auf dem Gymnasium ein Aufsatz über dies oder das von uns verlangt wurde und wir dafür bestimmte Bücher benötigen würden. Das funktionierte gut. Wir erhielten Nachschlagewerke, Lexika, aber auch literarische Werke, etwa von Peter Handke. Die Autoren der von uns bestellten Bücher durften nur keine Feinde des Sozialismus sein. Thomas Bernhard war für mich besonders wichtig, weil er in seinen Büchern den alltäglichen Faschismus zum Thema gemacht hat. Ich habe von ihm mehr gelernt als von allen anderen, die ich las. Mir war so, als würde Thomas Bernhard die Gesellschaft beschreiben, in der ich lebte.
Auch ich bin über Thomas Bernhard zur Literatur gekommen, das »Kalkwerk« war eine meiner ersten eigenständigen Lektüren. Aber wir im Westen haben Bernhard wahrscheinlich aufgrund unserer anderen Sozialisation komplett anders gelesen.
Ja, ihr habt die langen Sätze gelesen und seine unglaubliche Intelligenz und seinen Humor, aber auch seine Fähigkeit zu Ironie und Sarkasmus geschätzt. Es ist so wie mit Franz Kafka, über den Imre Kertész gesagt hat: Bei uns in Osteuropa sei Kafka ein Realist gewesen. Wir haben Bernhard und Kafka anders gelesen, wir haben ihn mit der Diktatur im Nacken gelesen und das ist etwas anderes, als wenn du keine Diktatur im Nacken hast. Du gehst, wenn du Bernhard mit den Erfahrungen in einer Diktatur gelesen hast, in eine ganz andere Richtung. Lektüren hängen eben stets vom eigenen Leben ab. So wie in der Polizei jeder etwas anderes sieht. Einer, der aus einer Demokratie kommt, sieht die Polizei unvoreingenommener an als jemand, der ein Leben lang von ihr bedrängt oder misshandelt wurde. Wie verstehen wir eigentlich Bücher? Wir verlängern doch nur etwas, was wir kennen oder wir lernen es kennen, aber wenn wir etwas Neues kennenlernen, geht auch das aus von dem, was wir zuvor erfahren haben. Als ich einmal zu Besuch in Israel war, hörte ich an der Universität in Jerusalem, dass für Israelis zum Beispiel »Der Handschuh« von Schiller oder »Der Erlkönig« von Goethe etwas mit dem Holocaust zu tun haben können. Diese Gedichte werden dort ganz anders wahrgenommen. Diese Lesart ist eben auch möglich, nur sehen Menschen mit anderen Erfahrungen diesen Zusammenhang nicht.
Durch Sie habe ich den österreichischen Autor Theodor Kramer kennengelernt. Sie haben eine Sammlung mit seinen Gedichten herausgegeben. War Ihnen Kramer bereits damals in Rumänien bekannt?
Ich bin in Rumänien in einem Antiquariat auf ein Buch von ihm gestoßen, publiziert in einem Exilverlag. Ein Band mit Gedichten, der »Die Gaunerzinke« hieß. Erst später habe ich erfahren, dass Kramer Jude war, dass er im letzten Moment vor den Nazis fliehen konnte und dass seine Gedichte auch diese Situation und seine Angst in dieser Situation beschreiben. Seine Gedichte waren wie ein Magnet für mich, sie zogen mich vielleicht deshalb so an, weil wir in Rumänien auch Angst hatten. Seine Angst muss noch viel größer und tödlicher gewesen sein als die, die ich erlebte, sicherlich. Dennoch gingen mir seine Gedichte nahe, auch weil ich wusste, mein Vater war in der SS und mein Onkel war ein Nazi und Theodor Kramer, den ich so schätzte, musste fliehen, weil mein Vater und mein Onkel wie viele andere Nazis waren. Wie ich vorhin sagte: Leben und Literatur sind aufeinander bezogen.
Ähnlich erging es mir auch mit Paul Celan. Ich habe mich geniert vor den Texten – und habe sie gleichzeitig so gemocht. Das hat mich verwirrt: Auf eine Weise fühlte ich mich mit Celan seelenverwandt, und gleichzeitig wusste ich, theoretisch hätten ihn mein Vater und mein Onkel umbringen können. Diesem Dilemma war ich ausgesetzt, aber weil ich dieses Dilemma ernst nahm, bin ich ein politischer Mensch geworden. Ich hatte und habe für Theorien nie Zeit gehabt, weil ich immer bedrängt wurde von dem, was war und was sein musste. In dem Sinne habe ich anfänglich auch keine Literatur im eigentlichen Sinn geschrieben, ich wollte mir vielmehr mit dem Schreiben immer selbst helfen. Ich war unglaublich beeindruckt, wenn ich gelesen habe, was andere geschrieben haben, Thomas Bernhard etwa oder Márquez, diese Sätze, diese Schönheit, da war ich völlig fertig. Ich dagegen hatte überhaupt keine Distanz, ich schrieb, weil ich wissen wollte, wie man lebt. Und das hat sich nicht verändert. Wenn ich heute mal wieder Gedichte von Helga M. Novak oder Sarah Kirsch, von Theodor Kramer oder von Rolf Bossert lese, die mir damals in Rumänien viel bedeuteten, die mir in meiner Angst halfen, dann weiß ich auch heute noch, warum sie mir damals wichtig waren, eben weil ich sie so nötig hatte. Angst ist ein guter Literaturkritiker.
Читать дальше