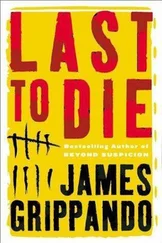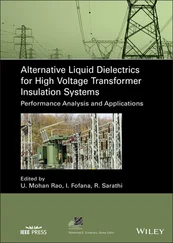Ulla war sich nicht ganz sicher, ob sie das intellektuell oder physiologisch meinte, und gab eine ebenso zweideutige Antwort. Ihre Aufmerksamkeit war sowieso abgelenkt, als sie das Regal mit den Niederschlagsproben von 1961 entdeckte. Auf dem Rückweg wollte sie es sich näher ansehen.
Sie blieben vor einer massiven Eisentür stehen, die nebst einem großen kreisrunden, altmodischen Kombinationsschloss auch noch oben und unten durch Magnetschlösser gesichert war. Nachdem Frau Hansen die runde Drehscheibe ein paar Mal hin- und herbewegt hatte, stieß sie ein triumphierendes »Yes, baby!« aus und lehnte sich mit der Schulter gegen die schwere Tür. Als diese widerstrebend nachgab, rieselten große Splitter alter Farbe auf den Zementboden. Man hätte meinen können, die Tür wäre seit Jahren nicht mehr geöffnet worden.
Im gleichen Moment, als sie die Schwelle überschritt, stellte Ulla fest, dass Frau Hansen nicht übertrieben hatte. Die Vergangenheit hatte Schimmel angesetzt. So eine Schlamperei, dachte sie empört, als sie die klamme, muffige Kellerluft einatmete. Sie legte sich wie Raureif auf ihre Wimpern und machte es noch schwerer, sich in dem Licht der nackten Glühbirne unter der Decke zu orientieren.
»Du meine Güte«, platzte es aus ihr heraus. »Wie haben die Deutschen diesen Raum denn im Krieg genutzt? Als Folterkammer?«
Frau Hansen klirrte mit dem Schlüsselbund und gestand widerstrebend, dass sie das nicht wusste. Aber, beeilte sie sich hinzuzufügen, war es nicht kurios, dass ausgerechnet diejenigen, die sich am stärksten ins Zeug gelegt hatten, das FFI hier, in einem ehemaligen deutschen Militärlager zu etablieren, fast ausnahmslos im Kampf gegen die deutsche Besatzungsmacht in der ersten Reihe gestanden hatten?
Ulla gab keine Antwort. Nicht aus Desinteresse am Zweiten Weltkrieg, aber im Augenblick ging es ihr vor allen Dingen darum, herauszufinden, ob es hier Unterlagen gab, die eine Antwort darauf geben konnten, was ihrer Familie an jenem Oktobertag 1961 zugestoßen war. Ein rascher Blick auf den Archivschlüssel zeigte, dass es zumindest drei Archivserien von potenziellem Interesse gab, inklusive eines Arbeitsprotokolls 31.1/287 – Schutz vor radioaktivem Niederschlag . Sie suchten die Mappen zusammen und begaben sich zurück zum Zentralarchiv.
»Ich befürchte, Sie werden erst morgen weiterarbeiten können«, sagte Frau Hansen, als sie das Archiv betraten. »Ich schließe jetzt. Die nächsten Tage werden Sie ohne meine Hilfe zurechtkommen müssen. Ich nehme an einem Computerkurs teil.«
Ulla hörte nur mit halbem Ohr hin und nickte mechanisch.
»Ich werde versuchen, mich so gut es geht durchzuschlagen«, sagte sie trocken.
Nachdem sie ihre Zugangsmarke in der Wachstube abgegeben hatte, trat sie in den dunklen Februarnachmittag. Obwohl es den ganzen Tag geschneit hatte, war der Bürgersteig am Instituttvei nicht geräumt. Bei zwanzig Zentimeter Neuschnee brauchte sie zehn Minuten bis zur Bushaltestelle. An Tagen wie diesen kam ihr die angeborene Behinderung wie eine Strafe vor.
Während der Busfahrt nach Oslo versuchte sie, ihre Gedanken zu ordnen und die Bedeutung ihrer kleinen Entdeckung im Kellergewölbe unter dem Archiv der Physikalischen Abteilung einzuordnen. Im Regal mit den Niederschlagsproben von 1961 hatten die Schachteln in chronologischer Reihenfolge gestanden. Aber an einer Stelle der langen Reihe war eine Lücke gewesen, exakt so breit wie eine der grauen Pappschachteln, die sie einrahmten. Um Frau Hansens Aufmerksamkeit nicht auf sich zu ziehen, war sie nur so lange vor dem Regal stehen geblieben, wie sie brauchte, um sich zu bücken und die Schnürsenkel zuzubinden. Aber die zehn Sekunden hatten gereicht, um zu sehen, dass die Leerstelle sich zwischen zwei Kassetten befand, von denen die eine mit Freitag, 20. Oktober datiert war und die andere mit Freitag, 10. November 1961 . Ein rascher Blick auf die angrenzenden Regale bestätigte ihr, dass die Proben regelmäßig am zehnten, zwanzigsten und letzten Tag eines Monats abgegeben worden waren. Wenn dort tatsächlich eine Schachtel fehlte, war anzunehmen, dass es sich um Proben von dem dazwischen liegenden Abgabetermin handelte, das heißt, von Dienstag, dem 31. Oktober 1961. Wer hätte eine Veranlassung, den Karton mit den Proben zu entfernen? Noch dazu, wo er sich auf bewachtem Gelände befand, in einem verschlossenen Keller?
Ulla sah sich nervös im Bus um. Sie hatten gerade in Olavsgård gehalten, wo etliche Leute eingestiegen waren. Aus unerfindlichen Gründen hatte sie plötzlich das Gefühl, dass ein Fahrgast zu viel in dem Bus war. Jemand, der nicht dorthin gehörte. Ein lächerlicher Gedanke, keine Frage, aber das unangenehme Gefühl ließ sie bis ins Zentrum nicht mehr los.
Werner starrte an die Decke. Am vergangenen Tag hatte er eine immer stärker werdende Unruhe verspürt, insbesondere dann, wenn die Wirkung des Morphins nachließ und die Operationswunde zu schmerzen begann. Es war ein guter Schmerz, fand er. Er erinnerte ihn daran, was für ein Glück er gehabt hatte. Das Ochsenherz war herausgeschnitten worden. Der Gedanke an den Tod, mit dem er in den letzten Jahren gezwungenermaßen ein beinahe intimes Verhältnis gehabt hatte, ließ sich seither endlich auf Distanz halten. Er ging auf die siebzig zu; daran änderte sich leider nichts. In vier Monaten war seine berufliche Karriere definitiv zu Ende. Doch das Alter war eine Sache, Körper und Seele eine andere. Mit dem mutigen, jungen Herz in seiner Brust fühlte er sich seltsam stark. Wüsste er nicht, dass es unmöglich war, hätte er dafür wetten können, dass ihn die Operation auch geistig verjüngt hatte. Auf unerklärliche Weise fühlte er, dass ihn die Schreie und Rufe der jungen Männer auf der Straße – in einer Sprache, die er nicht verstand – etwas angingen und seine Seele berührten. Was trieb sie nur an? Warum waren sie so willig, die Übermacht herauszufordern? Zuzuschlagen, statt die andere Wange hinzuhalten? Zu töten, ohne um Vergebung zu bitten?
In drei Tagen wollte er an die Mittelmeerküste fahren, um wieder zu Kräften zu kommen.
Nur er und Katarina.
Drei Tage. Die Schleuse zwischen Leben und Tod. Wenn es ihm gelang, lebendig durch die nächsten Tage zu kommen, war die Gefahr einer Abstoßung so gut wie vorüber. Dann lag das Alter wie eine endlos grüne Wiese vor ihm, auf der wunderbare Dinge geschehen konnten. Wie ein Kind freute er sich darauf, auf diese Wiese zu laufen und sie gemeinsam mit Katarina zu erforschen. Ab jetzt würde alles anders werden. Sie würden keine Geheimnisse mehr voreinander haben. Sie würden offen sein für die Welt und für einander. Und das Beste von allem: Sie würden mit der Zeit auch wieder zu dem intimen Umgang miteinander zurückfinden, den ihnen sein krankes Herz geraubt hatte!
Oder war der Glaube daran, dass alles anders werden könnte, dass es einen neuen Frühling für Katarina und ihn geben könne, nur eine Illusion? Er hatte Angst, dass es so war.
Die Katarina, die er 1958 in Boston getroffen und mit der er sich ein halbes Jahr später vermählt hatte, war sie nicht eine andere Frau als die, mit der er jetzt nach Ashdod fahren würde? Damals war sie voller Tatendrang und Optimismus gewesen. Obwohl sie eine fleißige Studentin war, strahlte sie eine Wärme und Lebenslust aus, die es zu einem Fest machte, in ihrer Nähe zu sein, vom morgendlichen Aufstehen bei Sonnenaufgang (eine gemeinsame Angewohnheit seit dem Leben im Kibbuz), bis sie um Mitternacht ins Bett fielen – um dann den Schlaf mit heißer Liebe zu verjagen. In den vertraulichen Gesprächen danach erschien sie reflektiert und nachdenklich, ganz ohne die Vorurteile und festgefahrenen Ansichten, die sie heute prägten. Und während sie früher voller Wärme über die internationale Solidarität und die religiöse Toleranz gesprochen hatte, war sie jetzt wie versteinert in ihrem Hass gegen die arabischen Länder und deren Bewohner und Anführer. Er musste es einfach einsehen: Die Katarina, in die er sich während des Laubhütten-Festes der jüdischen Studenten am MIT Hals über Kopf verliebt hatte, gab es nicht mehr.
Читать дальше