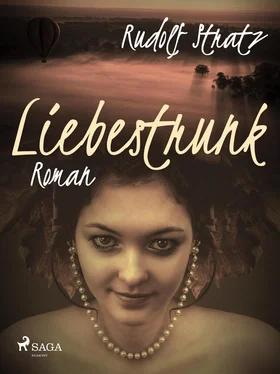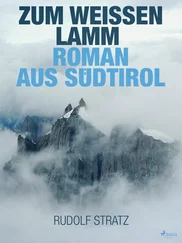Ihre Augen waren trocken. Sie konnte nicht weinen. Sie war viel zu entsetzt. Ihr war, als ringe sie um ihr ganzes Sein gegen einen unsichtbaren Feind. Nein! Nicht unsichtbar. Er war da! . . . Man konnte ihn fassen. Sie atmete auf. Sie hörte, wie draussen in der Halle jemand mit dem Mädchen sprach. Das war der Freiherr von Ostönne. Sie wartete nicht erst, bis er sich anmelden liess. Sie öffnete selbst die Türe ihres Zimmers und sagte aus trockener Rehle in den Vorplatz hinaus: „Bitte, kommen Sie nur!“
Werner von Ostönne trat ein. Er hielt den Zylinder in der Hand und trug den langen schwarzen Gehrock wie gestern. Sein sonnengebräuntes Antlitz war ebenso gleichgültig und fest. Seine schwarzen Augen prüften sie mit einem raschen, kalten Blick. Er verbeugte sich.
„Sie wünschten mich noch einmal zu sprechen?“
Sie bot ihm keinen Stuhl an. Sie stand vor ihm im Zimmer.
„Ja. Ich habe Ihnen noch etwas zu sagen!“
„Ich stehe zu Diensten!“
Plötzlich war es mit ihrer Selbstbeherrschung vorbei. Es rang sich ihr leidenschaftlich über die Lippen. Es war ihr eine Erlösung, das aussprechen zu dürfen.
„Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie sich niedrig und verräterisch benommen haben, dass Sie dies . . . dies da an mich abgesandt haben!“
Auf seinem Gesicht zuckte Keine Muskel. Er erwiderte nur: „Hüten Sie Ihre Worte, Frau Lünhardt!“
„Nein! Das tu’ ich nicht! . . . Ich sag’ Ihnen die Wahrheit! So handelt kein Ehrenmann . . .“
„Frau Lünhardt . . .“
„Ich war so glücklich mit meinem Mann! Ich war noch so glücklich in der Erinnerung an ihn! Welches Mass von Bosheit gehört dazu, mir auch das noch zu rauben!“
„Bitte, hören Sie mich . . .“
„Ein anderer hätte sich an Ihrer Stelle gesagt: ,Und wenn es zehnmal eine Täuschung ist — diese Täuschung ist ihre ganze Seligkeit, tut keinem Menschen weh — gibt ihr und denen um sie Frieden und Ruhe . . . Wozu dies arme bisschen Schleier zerreissen? Für sie ist’s ja so viel . . .‘ Aber Ihrer Rachsucht war damit nicht gedient! Ach, schweigen Sie! Ich weiss, dass es nur Rachsucht war! Sie bilden sich ein, ich hätte Ihnen Ihren Freund genommen . . . Sie waren mein Todfeind von jeher. Nun haben Sie die Gelegenheit benutzt, mich hinterrücks zu treffen. Es ist Ihnen gelungen — aber Ihre Ehre ging dabei in die Brüche, Herr von Ostönne! Man gibt nicht Briefe preis, die einem im tiefsten Vertrauen geschrieben sind! Solche Geheimnisse sind heilig! Die mussten mit Ihnen ins Grab sinken, wenn Sie ein Ehrenmann waren . . .“
„Ich bitte, mich jetzt endlich sprechen zu lassen . . .“
„Sie waren doch Offizier! Trugen den Degen an der Seite! . . . Ich begreife es nicht, wie Sie noch vor mir stehen können und mir ins Gesicht sehen . . .“
„. . . Weil alle Ihre Anschuldigungen grundlos sind, Frau Lünhardt!“
„Grundlos! Da liegen doch die Briefe meines Mannes!“
„Sie liegen da auf seinen eigenen Wunsch!“
„Was?“
„In seinem letzten Brief an mich, am Tage vor seinem Tode, hat er mir ausdrücklich aufgetragen . . .“
Sie unterbrach ihn, wild auflachend.
„Da hab’ ich Sie schon! Es ist nicht wahr! Am Tage vor seinem Tode war er nicht mehr imstande zu schreiben! Das weiss ich besser als Sie!“
„Ich habe auch nicht gesagt, dass er selbst geschrieben hat. Er hat die paar Zeilen diktiert. Darum legte ich sie nicht bei — weil sie nicht von seiner Hand sind . . .“
„Wem hat er sie diktiert?“
„Dem Hauptmann Bankholtz, der hat sie mir auf seinen Wunsch damals geschickt, noch am gleichen Tage!“
„Wo sind sie?“
„Hier!“
Er zog einen zerknitterten Brief hervor und reichte ihn ihr. Sie erkannte die Handschrift ihres künftigen Schwagers. Das Schreiben war kurz, eine Stelle am Schluss mit Bleistift angestrichen. Sie las:
„Es ist zu Ende, alter Kerl! Der liebe Gott benötigt mich dringend da oben und meint es so, wahrscheinlich mit mir am besten! . . . Ich muss mich eilen . . . Ich kann kaum mehr. Meine Frau ist auf eine halbe Stunde fort — zum Arzt. Da hab’ ich schnell Bankholtz kommen lassen. Also höre: Wenn ich hinüber bin und all der faule Zauber mit Begräbnis und Beileid vorbei, dann schicke meiner Frau sofort alle meine Briefe an Dich. Aber so, dass sie sie sicher bekommt! Ich will es! Wenn man mit einem Bein schon hinüber ist, dann möchte man die Lügen des Lebens hinter sich ganz zerstören! Drum muss es sein! Wie ich sie geliebt hab’, das weiss sie! Was ich um sie gelitten hab’, das soll sie erst nach meinem Tode erfahren . . .“
Gabrieles Hand, die das Schreiben hielt, sank langsam nieder.
Werner von Ostönne versetzte: „Sie sehen, Frau Lünhardt: in dem Brief steht: ,sofort!‘ Trotzdem habe ich drei Jahre lang gezögert und mit mir gekämpft, ob ich es tun soll! Aber wie ich nun hier herüberkam, wurde das Verantwortlichkeitsgefühl in mir zu stark. Ich habe noch ein Letztes getan. Ich habe vorgestern mit Bankholtz darüber gesprochen. Er erklärte mir: ,Du hast kein Recht, diese Briefe zurückzuhalten, die dich nichts angehen, sondern sein Verhältnis zu seiner Frau betreffen. Du bist da lediglich der Vollstrecker eines Testaments!‘ . . . Sie sagen, Frau Lünhardt: ,Schweigen ist heilig!‘ Aber der letzte Wille eines Sterbenden ist noch heiliger! Den hab’ ich erfüllt, wenn auch mit schweren Herzen, und dabei gleich auch meine eigene Meinung mit herausgesagt. Das letztere war wohl unnötig! Das verzeihen Sie mir!“
„Warum haben Sie mir diesen Brief nicht gleich gezeigt?“
„Ich hab’ es gestern in der Erregung vergessen! Ich wusste kaum mehr, was ich sprach und tat.“
Es war eine tiefe Stille zwischen beiden. Dann versetzte Gabriele: „Sie waren doch froh, sich an mir rächen zu können . . .“
Er zuckte die Achseln und schwieg.
Sie wandte sich ab. Sie murmelte: „Aber er hat es selbst so gewollt! . . .“
„Er hat es gewollt . . .“
Draussen vor dem Fenster wiegte sich das bunte Herbstlaub im Sonnenschein, der blaue Himmel lugte hindurch. Gabriele Lünhardt stand in der Helle am Fenster, von ihrem Besucher abgewandt. Sie rang mit sich. Endlich sagte sie kaum hörbar zwischen den zusammengepressten Lippen: „Wenn dem so ist, dann kann ich Ihnen allerdings keine Vorwürfe machen! Betrachten Sie, bitte, meine verletzenden Worte von vorhin als ungesprochen!“
„Ich habe sie nie anders aufgenommen, Frau Lünhardt!“
Sie ging an ihren Schreibtisch, raffte die vergilbten Briefe zu einem Päckchen zusammen und hielt es ihm hin.
„Ich danke Ihnen!“ sagte sie kalt. „Ich habe nun gelesen, was ich lesen sollte. Ursprünglich waren Sie der Adressat! Also nehmen Sie Ihr Eigentum zurück!“
Er zögerte.
„Ich weiss nicht, ob es mein Eigentum ist, Frau Lünhardt! Ich hab’ seit Jahren das Gefühl gehabt, als ob ich etwas Fremdes unterschlüge — etwas, das Ihnen allein auf der Welt gehört!“
„Aber ich behalte diese Briefe nicht!“
Bittere Verzweiflung zuckte auf ihrem Gesicht. Sie hatte die Hand immer noch ausgestreckt. Da nahm er die Blätter.
„Was sie tun sollten, haben sie ja nun erfüllt . . . ,“ sagte er. „Nach seinem Vermächtnis! Ich war nur das Werkzeug! Das einzige, was ich von mir aus tun kann, ist das!“
Er warf den Stoss engbeschriebener Bogen in das Feuer des Kamins. Die spielenden Flämmchen haschten gierig nach dem seidendünnen Tropenpapier. Eine blaue Lohe schlug auf, flackerte und erlosch. Gabriele stand stumm daneben. Endlich, als das letzte Blatt verkohlt war, versetzte sie: „Das war vergebliche Mühe!“
Er drehte fragend den Kopf.
Sie fuhr fort: „Das verbrennt doch nicht! Das bleibt! . . .“
Er zuckte die Achseln. Er erwiderte nichts. Er wartete einige Sekunden, ob sie ihm noch etwas zu sagen habe. Es lag viel auf ihren Lippen, aber sie schwieg. Sie sah ihn wie hasserfüllt an. Da nahm er seinen Hut vom Stuhl, verbeugte sich stumm und verliess das Zimmer.
Читать дальше