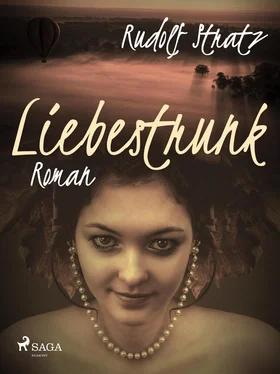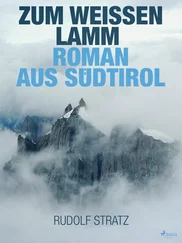Er wohnte, solange er in Berlin war, bei seiner Mutter am Königsplatz. Die alte Frau von Ostönne war eine feine, kleine Dame, silberhaarig, mit einem klugen, rotwangigen Gesicht. Sie liess den Sohn, als der bei ihr eintrat, neben sich sitzen, strich ihm zärtlich über den Scheitel und frug: „Nun, Wernerchen . . . wo kommst du denn her . . .?“
„Ich hab’ ein Rendezvous gehabt, Mama!“
Sie lachte. Das sah ihm gerade ähnlich!
„Wer war denn die Glückliche, Kind . . .?“
„Fräulein von Wieser . . .“
Der scherzende Ausdruck verschwand von den Zügen seiner Mutter.
„Ach . . . lebt die noch?“
„Na . . . wenigstens so ungefähr . . .“
„Wie hast du sie denn aufgefunden?“
„Sie hat an mich geschrieben und mich gebeten, wir wollten uns noch einmal aussprechen!“
„Wie ist sie denn jetzt?“
„Alt geworden, Mama . . .“
„Ja . . . Ja . . .“
„Oder bin ich alt geworden? Ich weiss nicht — na, jedenfalls Schluss!“
„Wirklich?“
„Ich bin nun einmal unversöhnlich gegen Menschen, die mich verraten haben. Dagegen kann ich nichts machen. Ich bin zu hart darin!“
„Nein! Ein zu weiches Herz hast du, Wernerchen!“
Er musste lachen über die gute, alte Mama.
Sie beharrte: „Spotte nicht! Ich kenne dich besser als du selbst! . . . Weil du so weich bist, schliesst du dich so schwer an und bist so karg mit deinem Vertrauen und empfindest es zehnmal bitterer als andere, wenn es missbraucht wird . . .“
„Das ist es worden. Und gründlich. Und mehr als einmal!“
„Aber so sind die Menschen, Kind! Sie meinen es nicht so böse! Man muss sich nicht abschrecken lassen. Sonst ist man schliesslich ganz allein!“
„Das bin ich ja auch so ziemlich, Mama! . . .“ Er nahm liebevoll ihre welken Hände zwischen die seinen. „Wenn ich nicht gerade alle Jubeljahre mal bei Muttern sitze und mich ’rausfuttern lasse . . .“
Die Greisin sass still da. Nach einer Weile hub sie an: „Weisst du, Kind, wozu du geschaffen bist? . . . Erschrick nicht. Aber du bist der geborene Ehemann! . . . Vorausgesetzt, dass du an die Rechte kommst!“
„. . . die Rechte . . . das ist rasch gesagt . . .“
„Du bist eine Natur, die sich nicht zersplittern kann, sondern alles auf eine Karte setzt! Darin liegt unter Umständen die Gewähr für ein grosses, grosses Glück. . . . War’s nicht die Wieser — gut, dann eine andere . . . Du solltest nicht wieder nach Afrika ohne eine Frau!“
„Ja, wenn das so leicht ginge, Mama!“
„Jetzt, Kind . . . wo du schon halbwegs ein gemachter Mann bist . . .“
„Trotzdem! Ich hab’ gar keine Lust mehr!“
Sie wurden beide stumm. Der Teekessel summte sein altes Lied, wie einst, in fernen Kindertagen. Die altmodische Hängelampe warf ihren Schein über das schwere Familiensilber, das verschnörkelte Meissener Porzellan — das verwitterte, feine Gesicht der greisen Dame. Und ihrem Sohn war es, als sässen noch viel mehr Menschen still hier mit um den Tisch, der Vater. . . der Grossvater, der lange weisshaarige Mann mit der Hornbrille, dessen er sich nur noch dunkel entsann . . . Tante Minchen . . . der kleine Bruder Kurt, der so früh gestorben . . . es waren nur Schatten . . . Der Afrikaner stützte den Kopf auf die Hand.
„Bei dir hier könnt’ man denken, man wäre wieder ein kleiner Junge, Mama!“ sagte er. „An dem Tisch da steht die Zeit still . . . komische Idee . . . nicht? . . . wenn man noch ein Bub’ wäre und erst anfinge zu leben . . . ich glaube, man würde dieselben Dummheiten wieder machen, höchstens in anderer Form. Meinst du nicht auch?“
„Was hast du denn je für Dummheiten gemacht, Wernerchen?“
„Gerade, was du sagst: ich habe mich zu sehr auf andere Menschen verlassen!“ Sein Gesicht war wieder hart und gleichgültig geworden. Er stand auf. „Und nun entschuldige mich! . . . Ich hab’ zu tun!“ sagte er, drückte die Lippen auf ihre Hand und beugte sich nieder, um sich von ihr auf die gebräunte Wange küssen zu lassen. Dann ging er in sein Zimmer hinüber. Auch da brannte schon hell die Lampe. Er setzte sich nieder, sperrte ein Schubfach auf und nahm einen Stoss Briefe heraus.
Das Papier war vergilbt. Das oberste der Schreiben trug das Datum von vor sieben Jahren. Er las es wieder, wie er schon oft getan:
„Mein lieber Werner!
„Seit ein paar Tagen habe ich mir überlegt, ob ich eigentlich je in meinem Leben wirklich, was man so sagt, Angst gehabt hab’! Ich habe gefunden: ohne Ruhm zu melden — nein! . . . Der liebe Gott hat mich offenbar, wenn’s schief ging, mit einem stumpfsinnigen Humor gesegnet, so dass die Geschichte dann gar nicht so gefährlich aussah. Aber jetzt hab’ ich Angst, wie ein Hungerkandidat vor der Prüfung vor dem, was ich Dir schreiben muss: Ich bin also doch seit gestern verlobt! . . . Sie hat ,ja‘ gesagt. Sie nimmt den wilden Mann aus Afrika, der von einem Klavier nicht mehr weiss, als dass es schwarze und weisse Zähne bleckt und quietscht, wenn man darauf haut. Sie hofft, er bessert sich und wird ein Kulturmensch.
„Und er, der alte Weiferling, und sie, die alte Weiferlingen, haben ihren Segen gegeben. Sie tun alles, was ihre Tochter will. Jeder tut, was sie will. Im Frühjahr heiraten Gabriele und ich. Und dann — ja — das weisst Du ja schon — sie will nicht mit hinüber! . . . Passte ja auch nicht dahin! Sie ist so schön . . . so wunderschön! . . . ein Schmelz . . . ein Zauber . . . man kann ihn nicht beschreiben . . . Sie ist wie ein kostbares Ding, das man im Treibhaus halten muss, damit es blühen kann!
„Ich bitte Dich, Werner . . . tobe nun nicht und schmeisse diesen Brief nicht von Dir, dass die Affen nachher mit den Fetzen Unfug treiben. Ich schwöre Dir: ich komme! Gib mir nur Zeit! Ein Jahr, wollen wir sagen! . . . Dann kann ich schon von ihr Urlaub nehmen! Dann bin ich Manns genug dazu! Aber vorläufig bin ich verliebt . . . Herrgott . . . Du warst’s ja auch mal vor ein paar Jährchen . . .
„Du wirst freilich sagen: ,Ganz egal! Ich bin trotzdem allein wieder hierher!‘ Ja, aber ich, Paul Lünhardt, ich bin eben kein Cato von Eisen, wie Du, sondern ein armer sterblicher Mensch! Wir wollen doch einander nichts vormachen, zwei alte Landsknechte und Zeltbrüder! Du warst immer der Stärkere! Ich war unter Deiner Fuchtel. Und nun bin ich statt dessen verliebt . . . ich bin wie im Rausch . . . wie wahnsinnig . . . ich bitte Dich: gönne mir eine Zeitlang mein Glück . . .
„Ich will gar nichts davon sagen, dass sie Geld wie Heu hat — dass sie so klug und gebildet ist, dass sie so schön ist — aber mir lieben uns so sehr! . . . Sie mich auch! . . . Wir sind im siebten Himmel . . . wir schwimmen im Glück . . . die Welt ist rosenrot und höchst lächerlich und nett — ein drolliger Einfall unseres Herrgotts . . . Und kurz und gut: ,ich muss!‘ . . . Und das ist meine Entschuldigung . . .“
Der Brief Paul Lünhardts ging noch lange weiter. Werner von Ostönne liess ihn sinken. Der nächste, den er herausnahm, war ein Jahr später geschrieben. Er las mitten daraus:
„. . . Unser Haus im Grünen, ganz am Ende des Tiergartens, wo sich Fuchs und Wolf adieu sagen, ist nun fertig. Ein Traum! Nächste Woche ziehen wir ein. Dass ich jetzt noch nicht von hier fort kann, das begreifst Du . . . Es ist so ein unmenschlicher Gedanke, dass man unter stinkenden Negern bei fünfzig Grad im Schatten am Kilimandscharo scharwerken soll, während hier die schönste Frau im trauten Heim mit Liebe auf einen wartet. Ich liebe sie so abgöttisch. Es ist nicht recht, dass Du auf alle meine Erklärungen schweigst und mir nur schreibst: ,Tu, was Du willst!‘ . . . Natürlich: der kategorische Imperativ heisst: Tu Deine Pflicht! . . . Weiss ich. Aber mein liebes Kerlchen . . . im Vertrauen gesagt: Der alte Kant, der den erfunden hat, war Junggeselle! Und ich will ja meine Pflicht tun . . . ich werde . . . ich will meinem Lebenswerk nicht untreu werden . . . ich komm’ schon hinüber . . . ich reisse mich hier los . . . auf Tod und Teufel . . . hab’ nur Geduld . . .“
Читать дальше