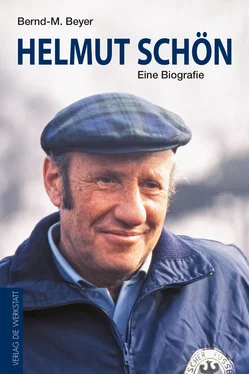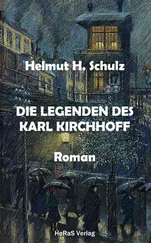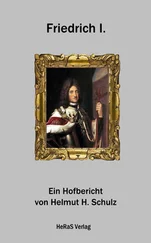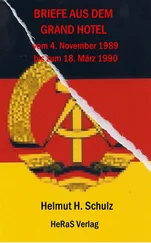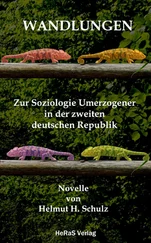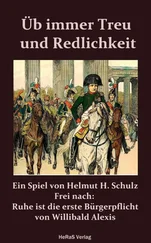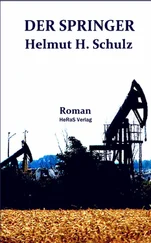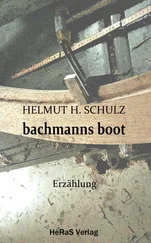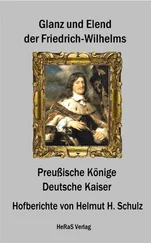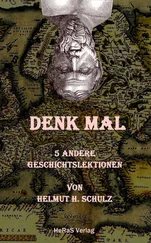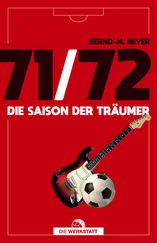Schön gab sein Debüt in der ersten Mannschaft am 26. August 1933 in einem »Gesellschaftsspiel«, wie Freundschaftsspiele damals genannt wurden. Ursprünglich hatte eine ägyptische Meistermannschaft am Ostragehege gastieren wollen, doch die Ägypter sagten kurzfristig ab, und als Ersatz wurde die Elf von Sparta Karlsbad geholt.
Die Dresdner nutzten das Spiel, um zwei Nachwuchsspieler zu testen, einer von ihnen war der 17-jährige Helmut Schön. So stand er plötzlich neben dem großen Richard Hofmann im Sturm, und um ihn herum Nationalspieler wie Karl Schlösser, Friedrich Müller oder Georg Köhler. Das Tor der Dresdner hütete seit Neuestem Nationalkeeper Willibald Kreß, der kaum weniger populär war als »König Richard« und wegen seines eleganten Auftretens auch »der schöne Willibald« genannt wurde. Nationalmannschaftskollege Hofmann hatte den Frankfurter nach Dresden gelotst, nachdem Kreß eine einjährige DFB-Sperre wegen verbotener Zahlungen hatte abbrummen müssen. Die Zeitschrift »Fußball« nannte ihn »das neue Idol der Dresdener Fußballjugend«.
Dass er in diesem edlen Spielerkreis die Schlüsselrolle des Sturmführers bewältigen sollte, dürfte den jungen Helmut Schön ebenso stolz wie nervös gemacht haben. Der »Dresdner Anzeiger« berichtete ausführlich über seinen Auftritt: »Der zweite Neuling war Mittelstürmer Helmut Schön. Seine Aufgabe war schon schwerer, denn hier gilt es vor allem, sich mit den Nebenspielern zu verstehen und ihnen ein wirklicher Führer zu sein. Schön ist technisch recht gut durchgebildet und fügte sich nach einigem verständlichen Lampenfieber recht gut in das Ganze ein. Vor allem verstand er sich mit Hofmann bestens.«
Vor der Begegnung hatte Richard Hofmann den jungen Debütanten beiseitegenommen und ihm eingeschärft: »Lass den Ball laufen und mach dir nichts daraus, wenn’s mal schiefgeht.« »Ja, Herr Hofmann«, hatte Schön geantwortet, worauf »König Richard« ihn aufforderte, gefälligst »Du« zu ihm zu sagen. Schön gestand später: »Ich habe einen knallroten Kopf bekommen.«
In den Tagen nach dem Spiel, das der DSC locker mit 5:0 gewann, sammelte Helmut Schön Zeitungsartikel darüber und klebte sie in eine Kladde ein, die er in sauberem Sütterlin überschrieb: »Meine Spiele in der DSC-Liga!« Besonders stolz war er auf einen Bericht, bei dem sein Porträtfoto abgedruckt und daneben zu lesen war: »Der neue Ligaspieler des DSC, Schön, schoß gegen Sparta Karlsbad 2 von 5 Toren. Der noch junge Spieler bedeutet für den mitteldeutschen Fußball eine sehr begrüßenswerte Verstärkung.«
Inzwischen hatten die Nazis die Macht im Deutschen Reich übernommen. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum neuen Reichskanzler ernannt, nachdem seine NSDAP eine Koalition mit der Deutsch-Nationalen Volkspartei gebildet hatte. Am gleichen Montag hieß eine Schlagzeile der örtlichen Presse: »DSC wieder Gaumeister«, aber die stand nur hinten im Sportteil, denn die Titelseiten wurden von der Politik beherrscht.
Zwei Tage später, am Mittwochabend, veranstaltete die SA gemeinsam mit dem »Stahlhelm«, der Kampftruppe der Deutschnationalen, einen großen Marsch durch Dresden. Mit tausenden Fackelträgern und mehreren Musikzügen wollte man demonstrieren, dass eine neue Zeit angebrochen war, eine Epoche, die tausend Jahre währen sollte. Eine Stunde lang dauerte der Vorbeizug der Kolonnen. Der Marsch endete am Rathausplatz, wo sich laut »Dresdner Anzeiger« eine »unübersehbare Menschenmenge« versammelt hatte.
Unter den Zuschauern, die teils fasziniert, teils angewidert die Szenerie beobachteten, befanden sich auch Ida und Helmut Schön. Der Junge hatte seine Mutter überredet, trotz des nasskalten Winterwetters mit zur Kundgebung am Rathaus zu gehen. Nun stand sie kopfschüttelnd neben ihm, zitterte vor Kälte und klagte: »Und zu so etwas muss ich mit.«
Als Ida Schön nach Hause kam, fühlte sie sich schwach und krank. Aus der Unterkühlung entwickelte sich eine Grippe, von der sie nicht mehr genesen sollte. Sie starb Ende März, im Alter von nur 52 Jahren.
Helmut Schön schilderte den »verhängnisvollen Spaziergang« eindringlich in seiner Autobiografie. Beim Lesen wird deutlich, welchen Einschnitt der Vorfall in seinem Leben bedeutete. »Noch heute«, bekannte er dort, »mache ich mir deswegen Vorwürfe«. Umso mehr muss es ihn als Jugendlichen bewegt haben. Wie er darüber hinwegkam, dazu schrieb er nichts. Aber es ist zu vermuten, dass der Fußball ihm dabei half.
Ein Reich der Freiheit, eine eigene Welt, losgelöst von der gesellschaftlichen Realität, wie sie sich der junge Schön am Schreibtisch erträumt hatte, bildete der Sport jedoch unter dem NS-Regiment weniger denn je. Schon in der Weimarer Zeit war er stark weltanschaulich geprägt gewesen. Die Kirchen hatten ihre eigenen Sportorganisationen, ebenso die sozialistische Bewegung. Deren Arbeitersportgruppen waren politisch so explizit gewesen, dass sie sich noch einmal aufgespalten hatten: in den SPD-nahen Arbeiter-Turn- und Sportbund sowie die Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit, die der KPD nahestand. Beide Verbände wurden nun von den Nazis verboten.
Der DFB hatte sich demgegenüber als unpolitisch definiert, was insofern stimmte, als seine Mitglieder grundsätzlich allen politischen und religiösen Strömungen anhängen konnten. Doch auch dort wurde um ein grundlegendes Verständnis des Sports gestritten: Weltoffene Kosmopoliten, die Sport als Mittel der Völkerverständigung erachteten, standen auf der einen Seite; deutschnationale, teils völkische Ideologen, die den Sport als Mittel zur »Wehrhaftmachung« des Volkes sahen, auf der anderen. Letztere bildeten die Mehrheit der Führungskräfte um den DFB-Präsidenten Felix Linnemann, weshalb die Nazis kaum auf Widerstand stießen, als sie auch den Fußball der »Neuordnung des deutschen Sports« unterwarfen. Die Regionalverbände wurden bald aufgelöst, der DFB als »Fachamt Fußball« dem »Deutschen Reichsbund für Leibesübungen« eingegliedert und das Führerprinzip durchgesetzt.
Auch Dresdner Sportvereine beeilten sich, den neuen politischen Verhältnissen zu huldigen. Der traditionsreiche Dresdner Ruderverein schaffte sich ein neues Paradeboot an, das »Adolf-Hitler-Achter« getauft wurde »zu Ehren des Kanzlers«. »Turnen und Sport stehen im Dienst von Volk und Vaterland«, hieß es Anfang März balkendick im »Dresdner Anzeiger«, und nach den letzten halbwegs freien Reichstagswahlen sollte sich zeigen, was damit gemeint war. Am 5. März 1933 holte die NSDAP reichsweit 43,9 Prozent der Stimmen (Wahlkreis Dresden-Bautzen: 43,6 Prozent), was zur Fortführung der Hitler-Koalition ausreichte. Ab jetzt wurde durchgegriffen.
Mitte April verbreitete der (noch existierende) DFB eine Erklärung, nach der »Angehörige der jüdischen Rasse« fortan »in führenden Stellungen« von Vereinen und Verbänden nicht mehr tragbar seien. In Dresden ging der örtliche »Kommissar für Leibesübungen«, Sturmführer Arno Schiefner, noch einen Schritt weiter. Er proklamierte am 24. April im »Dresdner Anzeiger«: »Ich erwarte von allen dem Dresdner Hauptausschuß für Leibesübungen angeschlossenen Verbänden, daß sie ohne Rücksicht auf die zu erwartenden Beschlüsse ihrer übergeordneten Stellen den Arierparagraphen analog der Deutschen Turnerschaft annehmen und durchführen. Dieser Paragraph der Deutschen Turnerschaft verpflichtet alle Vereine, alle jüdischen Mitglieder aus ihren Reihen auszuschalten. Der Angriff der Juden wird nicht durch den Glauben, sondern durch das Blut bestimmt. Jude ist, wer von jüdischen Eltern stammt. Es genügt, daß ein Teil der Großeltern jüdischen Blutes ist. Eine Selbstverständlichkeit ist, daß Marxisten nicht in die deutschen Leibesübungen treibenden Verbände gehören.«
Diese Forderungen Schiefners gingen deutlich über das hinaus, was zu jener Zeit seitens der NS-Oberen oder des DFB verlangt wurde, und setzten die Dresdner Vereine erheblich unter Druck.
Читать дальше