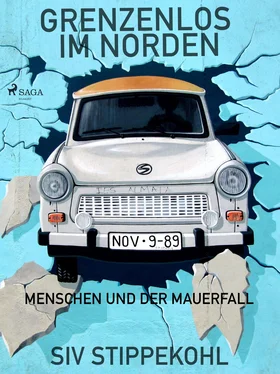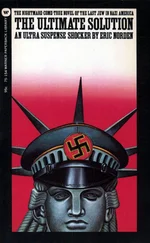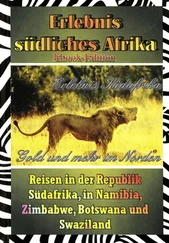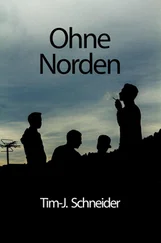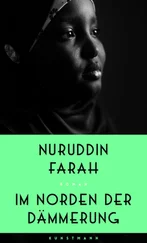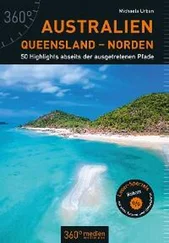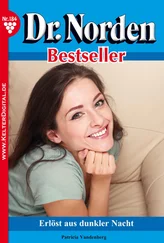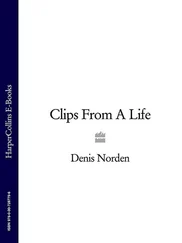Mutter und Sohn finden zunächst ein Quartier bei einer Freundin in Idar-Oberstein, Gerd fährt nach Bremerhaven, wo er Arbeit bekommen hat, eine Urlaubsvertretung. Geld muss her, nach der Flucht ist die Familie mittellos. Er bewirbt sich damals als Tierarzt in einem Oldenburger Schlachthof. Marielie bringt indes am 9. November 1961 ihren zweiten Sohn Carsten zur Welt, der Junge erkrankt bald nach der Geburt, er wird nur wenige Monate alt. Marielie und Sven folgen Gerd Seilkopf nach Oldenburg. Marielie erinnert sich noch gut daran, dass sie damals im Oldenburgischen nicht gerade mit offenen Armen empfangen werden. Sie sind Flüchtlinge aus dem Osten, nicht unbedingt jedem willkommen, das spürt sie deutlich. Nach dem Tod des zweiten Kindes wird schließlich 1963 der Sohn Matthias geboren, die Familie hat im Westen aber immer noch nicht richtig Fuß gefasst.
Durch einen zufälligen Kontakt erfährt Gerd von einer freien Stelle in Aulendorf. Im Juli 1964 fängt er im Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt an, im Januar 1965 kommt Marielie mit den Kindern nach. Sie erinnert sich genau, dass sie zunächst erschüttert darüber war, wie wenig man im schwäbischen Aulendorf von den Ereignissen knapp vier Jahre zuvor im Osten Deutschlands wusste, ihre eigene Geschichte wurde sogar angezweifelt. Deshalb hat das Ehepaar nie viel erzählt über ihr Leben, bis heute nicht.
Die beiden arbeiten energisch für eine neue Zukunft, Marie-Elisabeth führt als gelernte Krankengymnastin in Aulendorf das Kinderturnen ein, so bekommt sie Kontakt zu den Müttern. So erobert sie für ihre Familie eine soziale Stellung in dem konservativ geprägten Städtchen. Letztlich angekommen sind sie, als Marielie Kirchgemeinderätin wird, das verhilft der Familie aus dem Osten zu mehr Akzeptanz. Gerd spezialisiert sich auf die Geflügelhöfe in der Gegend. Die Bauern haben Vertrauen zu dem Mann, der den schwäbischen Dialekt zwar nicht spricht, der sich aber nicht nur um ihre Tiere kümmert, sondern ihnen auch zuhört, wenn es um ihre persönlichen Probleme geht. Dr. Gerd Seilkopf ist in all den Jahren zu einem angesehenen Mitarbeiter geworden, der seiner Familie einen ansehnlichen Wohlstand erarbeitet.
Die Geschwister und Familienangehörigen, die im »Arbeiter-und-Bauern-Staat« zurückgeblieben sind, haben sich lange Zeit enttäuscht von den beiden gezeigt, aber sie distanzierten sich nicht von ihnen. Noch im August 1961 haben Verwandte wichtige Papiere aus der Wohnung am Prenzlauer Berg geholt, die sie später in den Westen schickten. Gerds ältester Bruder wurde von den DDR-Behörden beauftragt, die beiden zurückzulocken, Straffreiheit und Rückgabe der Wohnung wurden versprochen. Aber Gerd und Marielie misstrauten dem System in Ostdeutschland viel zu sehr, als dass sie auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht hätten. Die Eltern, Brüder und Schwestern im Osten respektierten die Fluchtentscheidung der beiden zunehmend. Das war sehr wichtig für Marielie und Gerd, denn das sehen sie als Grundlage für den heutigen Familienzusammenhalt. Nachdem am 9. September 1964 ein DDR-Ministerratsbeschluss Rentnern wieder Besuchsreisen in die Bundesrepublik ermöglichte, sah Marielie ihre Eltern endlich wieder. Der Kontakt zu den Verwandten im Osten wurde wieder intensiver, nachdem die Seilkopfs in Aulendorf ansässig geworden waren. Er riss auch nie ab in all den Jahren danach. Gerd verdiente in den 1970er und 1980er Jahren gut; je besser es der Familie ging, umso mehr unterstützten sie ihre Angehörigen in der DDR, das sei ungeheuer wichtig für sie gewesen, sagt Marielie. Unzählige Pakete wurden verschickt, und später, als sie selbst wieder in die DDR fahren konnte, hat sie viel mitgenommen, Kleidung, Haushaltsartikel, Lebensmittel.
Gerd und Marielie dachten im Traum nicht daran, dass sie die Vereinigung Deutschlands noch erleben würden. Die deutsche Wirklichkeit war für sie zweigeteilt, sie hatten zwar eine ostdeutsche Geschichte, aber sie waren in der westdeutschen Realität angekommen. Ihre Söhne wuchsen heran, aber ganz klar westlich orientiert, wie Marielie sagt. Beide Jungen leben mit Frauen aus westdeutschen Familien zusammen, das prägt, meint sie. Das Interesse an der ostdeutschen Verwandtschaft hielt sich bei Sven und Matthias auch eher in Grenzen. Gerd und Marielie selbst nehmen für sich in Anspruch, ihre ostdeutsche Identität nie verloren zu haben. Die historischen Ereignisse haben sie so sehr geprägt, dass die Jahrzehnte in Aulendorf ihnen dieses Bewusstsein nicht nehmen konnten. Die turbulenten Tage und Wochen im Herbst 1989 und die Berichte von den Massendemonstrationen in der DDR verfolgt das Ehepaar mit großer Anteilnahme: »Die Bilder von Leipzig waren für mich ungeheuer beeindruckend«, erinnert sich Marielie an die Montagsdemonstrationen in der DDR. »Wir haben hier gelebt, aber unser Herz ist drüben«, so beschreiben die beiden ihre Gefühle. »Für uns war der Fall der Mauer ein Wunder«, sagen sie, »aber wir waren sehr überrascht, wie wenig Anteil die Menschen hier in Aulendorf daran nahmen.« Im gleichen Atemzug verrät Marielie aber auch, dass sie sich 1989 auch Sorgen gemacht habe, wie es den Deutschen gelingen könnte, wieder zueinanderzukommen. Zu sehr hat sie die Unterschiede am eigenen Leib gespürt, damals schon in den 1960er Jahren, als sie lernen musste, zu verstehen, wie die Schwaben in Aulendorf »ticken«. All das ist wieder hochgekommen, 1989, es habe vor allem auch geschmerzt, dass die Seilkopfs nicht so recht gewusst haben, wohin mit ihren Gefühlen. In Aulendorf haben sie niemanden, mit dem sie über ihre Freude, aber auch über ihre Ängste und Befürchtungen sprechen können, niemanden, der all das verstehen könnte.
Doch bald bekommen die Seilkopfs in Aulendorf Besuch von den vielen Verwandten aus Mecklenburg, aus Berlin, die erkämpfte Freiheit wird im wahrsten Sinne des Wortes gelebt. »Es war wunderschön, als unsere Geschwister kamen mit ihren Kindern und den Angeheirateten. Das Haus war immer voll«, erinnert sich Gerd Seilkopf an diese Zeit. Bald kommt auch der Augenblick, in dem Gerd und seine Marielie ohne Hürden in den Osten Deutschlands fahren können. Sie machen sich auf den Weg, wollen zu ihren Wurzeln zurückkehren. Ihren ersten Eindruck von dieser Reise beschreiben sie heute, gut zwanzig Jahre später, so: »Wir konnten wieder hin, was wunderschön war, aber wir hatten nicht mehr das Gefühl, dass wir unsere Heimat wiederbekamen.« Zurückgehen? Nach beinahe drei Jahrzehnten kommt das nicht mehr infrage. Die Söhne sind im Westen, in Schwaben aufgewachsen, die Enkel wissen kaum etwas über die DDR. Ein bisschen betrübt erzählt Marielie, dass in ihrer Familie nie viel über die Geschichte der Ost- und Westdeutschen gesprochen wird, dafür hat sie nur »ihren« Gerd.
»Sie haben ihn zu Tode gejagt«
Inge Lemme
und der Tod ihres Sohnes Hans-Georg in der Elbe
35 Jahre ist das jetzt her mit Hans-Georg und 20 Jahre die Wende«, sagt Inge Lemme, seufzt und macht eine lange Pause. »Ja.«, sagt sie und verstummt. Wie soll man auch seine Gefühle beschreiben? Wie mag jemand die Öffnung der Grenze erlebt haben, der an dieser Grenze sein Kind verloren hat? Inge Lemme, im April 2009 ist sie 80 Jahre alt geworden, sie wirkt, als mache sie nicht viele Worte, vor allem nicht unüberlegt. Ihr Mann Georg ist verstorben. Die Witwe sieht bedeutend jünger aus als 80, die Haare sind zu einem frechen Pagenkopf geschnitten, sie ist schlank, man könnte sie als ein ruhiges Wesen bezeichnen, aber auch als starke Frau, ihre kleinen Augen strahlen. Sie ist das, was man gewöhnlich gefasst nennt. 1989, das sei für sie eine schlimme Zeit gewesen, als die Wende kam, »das war ganz schlimm«.
Jahrzehntelang war die Elbe, der Grenzfluss, für sie und alle anderen unerreichbar. Als 1989 nach der Öffnung der Grenzen die ersten Fähren wieder über die Elbe verkehren, kann sie sich nicht freuen. »Wir haben hier mal eine Dampferfahrt gemacht«, erzählt sie, »da musste ich weinen. Aber was will man machen. Es ist geschehen und man muss damit fertig werden. Das ist immer schlimm, wenn ich über die Elbe rüberfahre, dann kommen immer die Gedanken. Es hat so sollen sein. Hans-Georg war ja im Wasser zu Hause. Er war ja im Sommer jeden Tag baden. Jeden Tag im Wasser. Die Haare waren ganz ausgeblichen im Sommer vom Baden. Und da ist er nun drin umgekommen. Es ist schmerzlich, sehr schmerzlich. Weil er ja doch ein guter Junge war und der achte Lemme auf unserem Hof. Und er hat gekämpft, gekämpft. Er wollte es schaffen. Aber es ist anders gekommen. Und wie alles genau abgelaufen ist, das weiß man nicht. Ich habe zu der Zeit auf dem Sofa gelegen, und auf einmal wurde mir ganz leicht und da ist er wahrscheinlich gestorben.«
Читать дальше