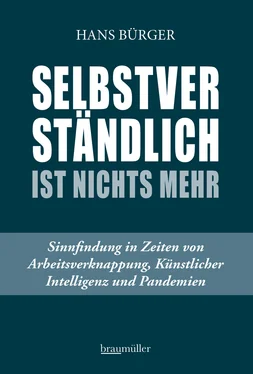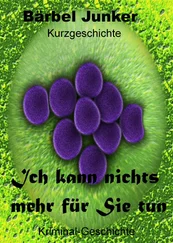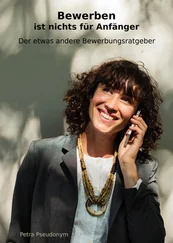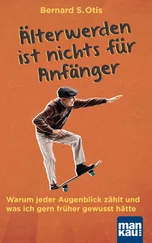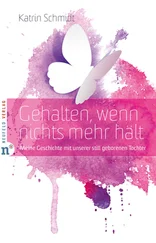Nur ein paar Zeilen dazu. Ein Unternehmen, das am Beginn steht, braucht neben Eigenkapital in der Regel auch Fremdkapital, und das nicht zu wenig. Es braucht also einen Kredit- und/oder einen Eigenkapitalgeber. Der verlangt Zinsen und/oder einen Teil des späteren Gewinns. Das gilt nicht nur bei Erstinvestitionen, sondern auch bei Erweiterungsinvestitionen. Eine neue Firma arbeitet also auf Pump und muss ab einem gewissen Zeitpunkt dauerhaft Gewinne garantieren können, damit Banken und Investoren bereit sind, Kapital vorzuschießen. Dauerhafter Gewinn bedeutet dauerhaftes Wachstum. Wäre der Kapitalismus ein Kreislauf, bei dem man nach jeder Periode wieder am Anfang landen würde, würden die privaten Unternehmen immer nur das einnehmen, was sie vorher an Löhnen und Investitionen eingesetzt hätten. Es entstünde dann eben keine Entlohnung des Kapitals, und keine Bank der Welt würde jemals wieder einen Vorschuss leisten. So oder so ähnlich, aber natürlich umfangreicher und detaillierter wird Kapitalismus auf Hunderten Seiten und in unzähligen Büchern definiert – dass es Kritiker ganz anders sehen und durchaus eine Ökonomie ohne Wachstum für realistisch halten, ist wieder eine andere Geschichte.
Auch eine andere Geschichte sind die Grenzen, die unser Planet dem ewigen Wachstum auf immer drastischere Weise entgegenhält. Ob nun die ökologischen Zäune, der in seinen Möglichkeiten begrenzte Mensch selbst, weil er mit dem Tempo des Lebens nicht mehr mithalten kann und ihm nicht nur Geld, sondern auch Zeit fehlt, um weitere Güter überhaupt noch konsumieren, geschweige denn genießen zu können, oder die immer weitgehender eingesetzte Digitalisierung der Arbeitswelt, Roboter oder Künstliche Intelligenz, wir werden uns schon aus diesen Gründen überlegen müssen, was der Mensch mit sich anfängt, wenn er in dieser neuen Welt seinen Platz finden will.
Wie also könnte er theoretisch auch leben? Gäbe es ein Leben mit mehr Sinn statt Tempo? Hat es überhaupt einen Sinn, ein „So ginge es auch“-Modell in der reinen Theorie zu beschreiben?
Hätte der Autor diese Fragen nach langem Überlegen letztendlich nicht doch mit „Ja, es hat einen Sinn“ beantwortet, wäre dieses Buch nicht entstanden. Und so hat er einige neue, vor allem aber teils jahrtausendealte Lebensweisheiten wieder ausgegraben, zusammengefasst und daraus theoretische Lebensmöglichkeiten gebastelt.
Das Buch wurde also geschrieben. Von Ende 2018 bis März 2020.
Und dann kam Corona.
Zeitgleich mit der Fertigstellung des Buches wurden in Österreich die sehr weitgehenden Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Und schon nach wenigen Tagen wurde das für das Buch skizzierte Menschenbild – entworfen für eine Zeit, wenn die Arbeit als ein oder bei vielen der Lebenssinn wegfällt – Realität.
Plötzlich hatten alle Zeit. Zeit für sich, für die Familie, für Freunde, für Nachbarn. Eine Höflichkeit im Umgang miteinander war nicht Ausnahme, sondern fast schon Regel. Und die Menschen taten Dinge, die sie nach eigenen Aussagen, Jahre oder gar Jahrzehnte aufgeschoben hatten. Sie schlenderten durch die Natur, bastelten mit den Kindern oder suchten am Dachboden nach Juwelen.
Im letzten Kapitel soll darauf auch näher eingegangen werden, nicht auf die schreckliche COVID-19-Pandemie an sich, aber auf das, was dieser erzwungene Rückzug, der verordnete Stillstand, in uns allen ausgelöst hat.
Die Frage „Wozu das alles?“ – und damit wieder zurück zum ursprünglichen Sinn dieses Buches – erlebt seit Ende des vorangegangenen Jahrhunderts eine Renaissance. Zunächst in der Glücksforschung. In immer mehr Ländern wurde und wird versucht, mittels viel zu langer Fragebögen das Lebensglück zu erfragen, stets gipfelnd in der Parole: „Wir müssen Bhutan werden.“ Das buddhistisch gelenkte Königreich am Rand des Himalaya gilt weithin als weltweites Zentrum des Glücks, und seit den 1960er-Jahren wird das Bruttonationalglück in diesem Land in der Verfassung festgeschrieben. Sinngemäß heißt es dort: Nur eine Regierung, die für ihr Volk Glück schaffen kann, hat eine Existenzberechtigung. Tut sie das nicht, hat sie keinen Grund, zu regieren.
Auch die Ratgeberliteratur sprengte alle Rahmen des großen Glücks, das in nicht immer seriösen Varianten auf Zehntausenden Seiten niedergeschrieben wurde.
Doch dann ging dem Glück die Luft aus.
Glück sei nicht alles im Leben, warnten plötzlich die Philosophen. Ein Berufszweig, der Jahrzehnte geschwiegen und sich in die Denkerzimmer der theoretischen Philosophie, meist in Universitäten, zurückgezogen hatte, wagte sich wieder an die breite Öffentlichkeit. Die Philosophie erlebt in ihrer Ausprägung der praktischen Philosophie seit einigen Jahren ein unglaubliches Comeback. Ob die aus Deutschland stammenden Richard David Precht, Wilhelm Schmid, Albert Kitzler, Rüdiger Safranski, ob die Österreicher Robert Pfaller oder Konrad Paul Liessmann oder der Schweizer Philosoph Peter Bieri, ihnen allen geht es nicht mehr ums Glück allein. Es ist „das gute Leben“, das thematisch ihre an Universitäten allerdings sehr kritisch beäugten Publikationen dominiert, wie auch das seit Jahren in Frankreich und dann auch in Deutschland erscheinende Philosophie Magazin und andere neue Philosophie-Schwerpunkte in Zeitungen meist die „Lebenskunst“ in den Mittelpunkt stellen.
Was ist ein „gutes Leben“?
Eine der ältesten Fragen der Philosophie. Älter ist nur die Frage: Was ist der Sinn von allem?
Die Antwort ist so einfach wie banal: Weise leben.
Und das Schöne daran. Es ist schon alles gedacht. Vielleicht nicht wirklich alles. Aber fast alles. Zum Teil vor dreitausend Jahren.
Braucht es also neue Weisheiten? Nein, sagt der Philosoph Albert Kitzler: „Denn die Funktionsweise unserer Seele ist in den letzten 3000 Jahren im Wesentlichen unverändert geblieben.“ 1Keiner von uns müsse das Rad immer wieder neu erfinden (wobei dieser Spruch erst rund 40 Jahre alt ist, das Rad selbst mindestens fünf Jahrtausende), man müsse auch die Lebensweisheiten nicht immer neu erdenken.
In diesem Buch soll es deshalb auch, oder vielleicht vor allem, um die vielen kleinen und großen Ideen und Anregungen weiser Menschen gehen, die manches im Leben im wörtlichen Sinne leichter machen könnten. Die Philosophie bekommt im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts immer stärkeren Rückenwind auf ihrem Weg in die immer mehr von Unzufriedenheit geprägte menschliche Gedankenwelt. Und das ist gut so. Nein, nicht das gedankliche und zu oft verbalisierte Raunzen, sondern die Befassung der modernen Philosophie damit – im Gewand der praktischen Philosophie, jenem Teilbereich der Philosophie, wie ihn Aristoteles geprägt hat. Es soll also um die konkrete Anwendung von Philosophie gehen in Fragen der Ethik, des Rechts, der Politik, auch der Ökonomie und der Medizin. In der Volkswirtschaftslehre sagen die sogenannten neoklassischen Professoren – in ihrer politischen Ausformung: die Neoliberalen –, dass man mikroökonomische Betrachtungen, wie wir sie eben getroffen haben, auf die Makroökonomie übertragen könne. Denn so wie sich der Homo oeconomicus, der stets rational handelnde Modellmensch in der Gleichgewichtswirtschaft, auf den Märkten bewege, so könne man das auch auf eine gesamte Volkswirtschaft umlegen. Oder weniger ökonomisch formuliert: So wie die Leute sind, so funktioniert dann auch ein ganzer Staat.
Dass das nicht stimmt, haben viele Wirtschaftswissenschaftler und Denker aufgezeigt und gut begründet. Der Wichtigste unter ihnen: John Maynard Keynes. So sei etwa ein Sparparadoxon auszumachen. Spart ein Mensch, so mag das für ihn gut sein, weil ihm in der Zukunft mehr Geld für eine geplante größere Anschaffung zur Verfügung steht. Sparen jedoch plötzlich alle, also die Wirtschaftsteilnehmer eines gesamten Landes, geht der Gesamtkonsum dramatisch zurück und damit das gesamte Volkseinkommen. Dann fallen beide – der Gesamtkonsum und die Gesamtersparnis.
Читать дальше