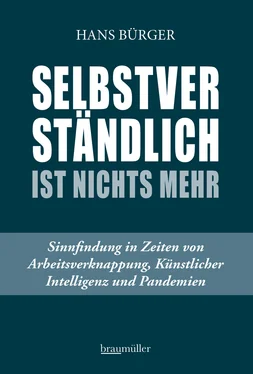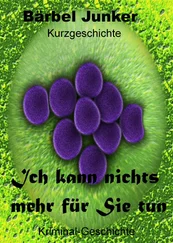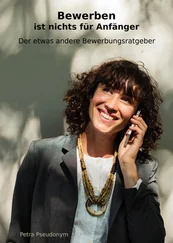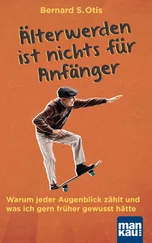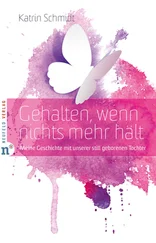Zynismus pur. Und zudem immer unrichtiger. Denn ab dem dritten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends wird je nach Studie jeder fünfte bis zumindest jeder dritte oder bis 2050 sogar jeder zweite Arbeitsplatz, wie wir ihn bis dato kennen, verloren gehen. Ob bis 2040 oder 2050, das will niemand genau prognostizieren, aber meine Kinder und die heute vierzehnjährige Netzwerkerin werden mittendrin stecken. Im Beruf – oder in einer anderen Welt.
Und um diese Welt soll es in diesem Buch gehen. Ich verstehe es als Fortsetzung meiner ersten drei Bücher: „Wie Wirtschaft die Welt bewegt“, „Der vergessene Mensch in der Wirtschaft“ und „Wir werden nie genug haben“. Als eine Art Fortsetzung deshalb, weil mich als Absolvent eines Volkswirtschaftsstudiums eine Frage schon immer beschäftigt hat: Warum wirtschaften und wachsen wir in immer schnellerem Tempo, wenn Wohlstandsgesellschaften schon relativ viele Güter haben? „Sättigungstendenzen – Ursache dauerhafter Nachfrageschwäche?“ betitelte ich meine Diplomarbeit. Heute würde ich die Frage viel breiter anlegen. Was macht der Kapitalismus, wenn immer weniger mitmachen? Sei es aus Mangel an Einkommen (trifft noch immer auf rund 95 Prozent der Haushalte zu), aus Mangel an Lust auf den Konsum oder aus Mangel an Zeit.
Der durchschnittliche Deutsche kann heute rund 10.000 Dinge sein Eigen nennen. Von der Stecknadel bis zum Auto. Rund acht von zehn neuen Produkten schaffen es nicht mehr auf den Markt und wenn, dann nur ganz kurz. Dann sind sie wieder weg. Die Entwicklungskosten bleiben im Unternehmen, meist werden Mitarbeiter gekündigt oder – im schlimmsten Fall – muss die Firma zusperren. Im letzten Jahrhundert traf es etwa den Monoski. Kaum war er da, war er von den Breitensportpisten auch schon wieder verschwunden.
Oder ein Beispiel aus jüngerer Zeit: Der ruhelose Zappelphilipp auf zentral gelagerten Kugeln, besser bekannt als „Fidget Spinner“. Erfunden wurde er eigentlich von der US-Amerikanerin Catherine Hettinger im Jahr 1993 – allerdings verzichtete sie wegen Erfolglosigkeit beim Anbieten an Spielzeug-Verkaufsketten zwölf Jahre später auf die Erneuerung des bestehenden Patents. Zehn Jahre lang hätte sie noch durchhalten müssen. Denn plötzlich wollten alle Kinder Handkreisel. Ohne Vorwarnung. Aber natürlich nicht nur einen Fidget Spinner, sondern mindestens zehn verschiedene Modelle. Ende 2016 kürte das Forbes Magazine das Ding zum „Must-Have Office Toy For 2017“ . Die Zahl der Hersteller explodierte weltweit. Kein Spielgeschäft der Welt, kein Touristenshop zwischen Peking und Pisa, keine Straßenverkäufer zwischen Wien und Berlin wagten es, keine Handkreisel anzubieten. Beim ersten Verkaufsrückgang begannen die Geräte in anderen Farben, Formen und teils mit angehängten kleinen Gewichten zu glänzen. Als auch das nichts mehr half, erzeugten manche Fidget Spinner beim Drehen bestimmte Muster, leuchteten im Dunkeln oder blitzten in der Nacht. Zwei Jahre später waren sie verschwunden oder um einen Euro in Billigläden zu erstehen. Dem Spiel Pokémon GO, bei dem Scharen von Kindern und Erwachsenen in Büschen virtuelle Gestalten suchen, ist es ähnlich ergangen.
Die Zeit, sich täglich mit Gegenständen zu beschäftigen, ist bei vielen von uns aufgebraucht. Weitgehend von Schlaf, Kommunikation und Arbeit ersetzt. Den Schlaf haben wir in den vergangenen 200 Jahren von acht auf sechs Stunden reduziert, das Kommunikationstempo seit 1825 ver-10-Millionen-facht. Bleibt nur noch die Arbeit.
Was machen wir also, wenn auch sie geht. Was bleibt uns dann? Für die meisten von uns, so hat man es uns einige Jahrhunderte lang gelehrt, ist es vor allem sie, die Sinn stiftet. Wer nicht arbeitet, ist nicht. Und hat letztlich auch kein Recht, in Zufriedenheit zu leben. Oder wie Apostel Paulus der Gemeinde Thessaloniki verkündete (Kap 3, Vers 10): Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen .
Was man mit Falschinterpretationen alles anrichten kann. Denn der Apostel Paulus wollte mit diesem Satz in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher keineswegs die Faulheit attackieren. Auch wenn es die Kirche jahrhundertelang so weitergegeben hat. Paulus meinte eigentlich das Gegenteil. Er verstand diese Aussage als Angriff auf jene Reichen, die andere Menschen für sich arbeiten ließen und nur faulenzten. Damit sollte ein klares Nein zur Sklaverei ausgedrückt und diese Hierarchie in der Gemeinschaft der Christen aufgelöst werden, etwa beim gemeinsamen Essen. Es sollten eben nicht die einen auf das Essen warten, das die anderen zubereitet hatten, sondern: Wer nicht gearbeitet hatte, sollte auch nicht mitessen dürfen. Im Grunde war das ein Aufruf zur sozialen Gleichberechtigung und Gerechtigkeit.
Abgesehen von diesem „historischen“ Einwand wird Faulheit wohl bei wenigen ein echtes Lebensziel sein. Kaum jemand wird sich zeit seines Lebens freiwillig ausschließlich zwischen Bett und Küche bewegen wollen. Fällt die Arbeit einmal tatsächlich weg oder auch nur zu einem großen Teil des bisher gewohnten Umfanges, wird für viele in der westlichen Welt auch der Sinn wegfallen. Auch wenn sie das anderen gegenüber nur selten zugeben werden.
Familie, Gesundheit, eine gesunde Umwelt und der Weltfrieden – deshalb bin ich hier, so werden zwar in den letzten Jahrzehnten Fragebögen ausgefüllt, aber im sozialen Vergleich sind es dann doch der Beruf, die hierarchische Ebene in diesem sowie Einkommen, Immobilie, Auto, Urlaubsdestinationen, Kleidung und das nicht länger als vor einem halben Jahr erworbene Smartphone, die zählen.
Das wäre in vielen Fällen wohl anders, würden wir – auch mit unserer Familie – auf einer einsamen Insel leben. Sobald der soziale Wettbewerb hinzukommt, ist es mit der Inselmentalität schon wieder vorbei. Tatsächlich schaffen in den letzten Jahren immer mehr Menschen die Fokussierung auf Glück, Lebenszufriedenheit und Sinn – auch mitten im sozialen Wettbewerb –, aber dennoch sind diese Aus- und Umsteiger in ihren selbst fabrizierten Holzhütten im Wald oder in Kleinhäuschen in Kreta nach wie vor in einer verschwindend kleinen Minderheit. Da nützen auch die seit der Jahrtausendwende gefühlt jährlich 1000 neuen Ratgeber zum Rückzug – am besten gleich ganz in sich selbst – wenig bis nichts.
Es wird jedem von uns – vor allem jenen, die am Anfang oder mitten im Arbeitsprozess stecken – nichts anderes übrig bleiben, als sich mit sich selbst darüber im Klaren zu werden, was kommt, wenn die Lohnarbeit geht.
Was kommen soll.
Was geschieht, wenn die direkte Abhängigkeit vom Arbeitgeber wegfällt. Was auf den ersten Blick nur zu Erleichterung führen kann, gestaltet sich auf den zweiten Blick allerdings viel komplexer. Geldlohn gegen zeitlich begrenzte Zurverfügungstellung von körperlicher oder geistiger Arbeitskraft schafft auch Sicherheit, halbwegs stabile Rahmenbedingungen im wackeligen Weltgefüge und die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg.
Arbeitgeber oder gar Selbstversorger, wie sie zum Teil in der Dritten Welt noch immer gang und gäbe sind, müssen sich diese Fragen nicht stellen, was dennoch nicht bedeutet, dass sie das „Wozu das alles?“ nicht auch zusehends beschäftigt.
Womit wir uns dem Untertitel dieses Buches annähern. Der Suche nach Sinn in einer kapitalistischen Welt, der immer mehr die Arbeit ausgeht. Oder: Sinn statt (nur) Gewinn. Gemeint ist selbstverständlich nicht nur der Unternehmensgewinn. Sondern das, was wir im herkömmlichen Sprachgebrauch neben dem Gewinn in Firmen darunter verstehen: Gewinn von mehr Gütern, Gewinn von sozialem Aufstieg oder Prestigegewinn (durch die Anschaffung von Kleidung, Smartphone, Auto, etc. – vorausgesetzt, das Produkt wird von anderen oder professionellen Marketingstrategen gerade jetzt als wirklich „in“ gebrandet).
Was wird sein, wenn Gewinn in diesem Sinne, beziehungsweise präzise formuliert: permanenter Gewinn zuwach s, nicht mehr möglich ist? Wenn uns das Gegenteil treffen wird? Weniger Arbeitsvolumen in der westlichen Welt, also weniger Nachfrage nach dem Produktionsfaktor menschliche Arbeitskraft, weniger Wirtschaftswachstum oder überhaupt kein Wachstum, was aber die feststehende Basis des Kapitalismus ist. Aber ohne Wachstum kein Kapitalismus. Warum das eigentlich so ist, werfen Sie ein?
Читать дальше