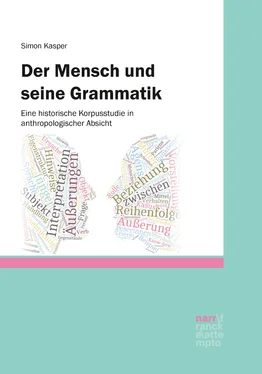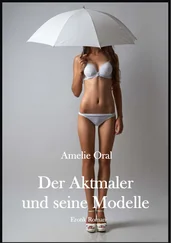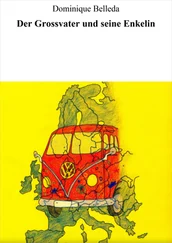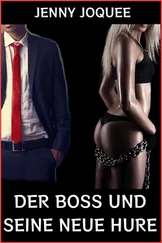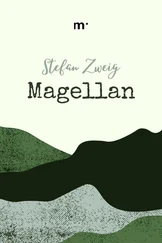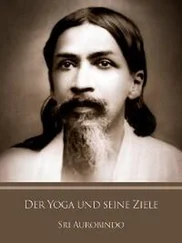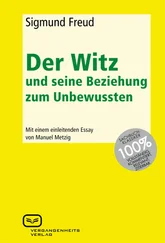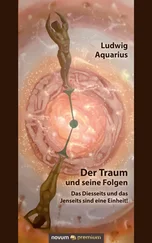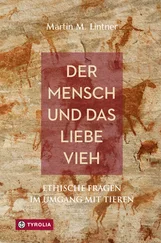1 ...8 9 10 12 13 14 ...30 VorstellungenVorstellung sind wie alle mentalen Vorgänge aber privat, das heißt nur derjenige, der sich etwas vorstellt, weiß auch, was er sich vorstellt. Daher war der Schreiber darauf angewiesen, seine Vorstellung auf irgendeine Art zugänglich zu machen. Kopieren und Einfügen waren und sind dabei auf absehbare Zeit keine realistischen Optionen. Der einzig mögliche Weg ist, etwas wahrnehmbarWahrnehmung zu machen, indem man es entäußert. Dadurch wird es öffentlich.
2.1.2 Öffentlichkeit und sprachliche Konventionen
Im ersten Kapitel hatten wir gesehen, dass unter Beachtung der Konventionen einer Sprache die Ausdeutbarkeit einer Äußerung engen Grenzen unterliegt und dass dies zu den Eigenschaften gehört, die Sprache zu einem praktisch erfolgreichen Kommunikationsmittel machen. Ich möchte nun die Frage diskutieren, wie wir dieses Konventionalisierte im Sprachgebrauch besser fassen können. Denn wenn unser Schreiber etwas von seiner Vorstellung dadurch kommunizieren möchte, dass er vokalisch, manuell oder graphisch Erzeugtes öffentlich wahrnehmbar macht, sind diese Erzeugnisse ohne Konventionen nahezu beliebig ausdeutbar, wie wir gesehen haben.
Zunächst einmal möchte ich klarstellen, dass unter Konvention nicht eine Übereinkunft in dem Sinne verstanden werden kann, dass eine Gruppe von Menschen sich darüber einigt, welche Regeln künftig für ihr kommunikatives Miteinander gelten sollen, denn wie sollte man sich über etwas einigen, ohne dass bereits Konventionen bestünden, die eine solche Einigung ermöglichten? Plausibler erscheint, dass die Entstehung und Fortentwicklung des Kommunikationsmittels Sprache durch unzählige Zyklen aus Variation (vielfältiges Ausprobieren), Selektion (Weiterverwendung des Erfolgreichen) und Reproduktion (Weitergabe beziehungsweise Übernahme des Bewährten) zwischen Menschen innerhalb von Gruppen und zwischen Gruppen gekennzeichnet sind, die sich über Lebzeiten und Generationen hinweg erstrecken. Mit ihren jeweiligen kognitiven und physischen Fähigkeiten versuchen Menschen, auf vielfältige Weise mit bestimmten vokalischen oder manuellen Gesten ihre Vorstellungen zu gemeinsamen Vorstellungen zu machen.1 Sie verwenden solche Gesten weiter, die sich dabei in der gemeinsamen Praxis als erfolgreicher erweisen als andere, und geben sie im Rahmen der Kultur einander und an nachfolgende Generationen weiter. Diese wiederum übernehmen die bewährten sprachlichen Praktiken, verändern sie dabei aber, indem sie neue Gesten ausprobieren, praktisch bewährte auf Kosten anderer weiterverwenden, übernommene Gesten enger oder weiter gebrauchen, die Gestalt der Gesten verändern und so weiter.2 Aus diesem kumulativen Zyklus aus Versuch und (Miss-)Erfolg, aus dem immer Mittel weiterverwendet werden, die sich als praktisch erfolgreich erwiesen haben, kann durch zunehmende Ausdifferenzierung des Gesteninventars und ihrer Funktionen schließlich das entstehen, was wir heute als natürliche Sprachen kennen.3 Dafür ist keine metasprachliche Einigung darüber nötig, welche Ausdrucksmittel zu gebrauchen sind und welche nicht. Die Konventionen kommen mit dem Gebrauch. Sie beruhen wesentlich auf dem öffentlichen Charakter des Kommunikationsmittels und bilden sich in der Interaktion heraus. Dass alle Mitglieder einer Sprachgemeinschaft eine Konvention befolgen, ist dabei in der Regel nicht das geplante oder planbare Resultat der Sprecherin, die sie eingeführt hat, sondern meistens eine Folge davon, dass eine hinreichende Menge anderer Sprachbenutzerinnen sie, ob bewusst oder unbewusst, übernimmt. Konventionen sind nicht als Regelwerke verfügbar, in denen expliziert wäre, was erlaubt und was nicht erlaubt ist. Für unsere Interpretin haben sie den Charakter eines positiven Know-hows : Sie verfügt über die Fertigkeit, physische und kognitive Aktivitäten gelungen und erfolgreich ausführen, oft in routinisierterRoutine, Routinisierung oder gar automatisierterAutomatismus Weise. Dieses Know-how Know-how ist scharf von einem Know-that zu unterscheiden, das ein explizierbares Wissen darüber umfasst, wie diese Aktivitäten analysierbar sind und wie nicht, und darüber, was die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für ihr Gelingen und ihren Erfolg sind.4 Für das Know-how , das unsere Interpretin bei ihren tagtäglichen Verrichtungen demonstriert, zu denen auch Sprechen, Schreiben, Hör- und Leseverstehen gehören, bedarf sie des Know-thats nicht. Das gilt es auch zu bedenken, wenn ich im Folgenden davon spreche, dass eine Interpretin Grammatisches „kennt“ oder „weiß“.
2.1.3 Die Zwänge der Öffentlichkeit: TreuTreue (vs. Sparsamkeit)e und SparsamkeitSparsamkeit (vs. Treue)
Von Anfang an begleitet diesen Zyklus aus Versuch und (Miss-)Erfolg aber auch ein Kompromiss aus dem Wünschenswerten und dem Machbaren. Wünschenswert wäre beispielsweise die Möglichkeit, bestimmte Vorstellungen – dieser konkrete Jünger, diese konkrete Frau, vielleicht auch das ganze konkrete Ereignis in seiner phänomenalen Fülle WahrnehmungPhänomenqualitäten1 – mit bestimmten, nur für diese konkreten Gegenstände oder dieses Ereignis verwendbaren Gesten sozusagen vorstellungsgetreu auszudrücken und für andere konkrete Jünger, Frauen oder Ereignisse ebenso treu jeweils andere Ausdrücke zu verwenden. Obwohl dies nicht einmal der radikalste mögliche Wunsch im Sinne der Treue ist, mag selbst er, wenn überhaupt, nur so lange praktizierbar sein, wie die Miniaturwelt, in der so kommuniziert wird, klein genug ist und der Kreis, mit dem so kommuniziert wird, dieser Miniaturwelt angehört. Er wird sehr schnell an Grenzen stoßen. Diese Grenzen betreffen einerseits die geringen Erfolgsaussichten, die die verfügbaren Ausdrucksmittel besitzen, sobald nicht mehr alle Sprecher über den gleichen Erfahrungsschatz verfügen, und andererseits die kognitive Beherrschbarkeit der Ausdrucksmittel, sobald die Zahl der Gegenstände oder Ereignisse des gleichen Typs, aber auch unterschiedlichen Typs, zu hoch wird. Solche Erfordernisse der Sparsamkeit erzeugen bei Menschen einen Selektionsdruck auf solche Ausdrucksmittel, die in ihrer Bestimmtheit in gewissem Maße untreu gegenüber den bestimmten Vorstellungen sind, zu deren Ausdruck sie dienen, aber immer noch treu genug, um den Interaktionserfolg sicherzustellen.
Ein zentraler Aspekt dieser Untreue im Dienste der Sparsamkeit ist auch, für alle möglichen Beziehungen zwischen allen möglichen Dingen ( Was Was steht womit in welcher Beziehung? steht womit in welcher Beziehung? ) ein begrenztes Inventar an Ausdrucksmustern zu entwickeln. Gestern wies der Präsident alle Anschuldigungen von sich mag hinsichtlich des Vorstellungsinhalts wenig mit unserer Äußerung in (4) gemeinsam haben, aber die Ausdrucksmuster können als sehr ähnlich oder sogar identisch beschrieben werden, wenn wir von der jeweiligen Bestimmung des Was? , Womit? und Welche Beziehung? absehen. In dem langen Prozess der Konventionalisierung einer Sprache setzt die Herausbildung eines solchen begrenzten Inventars an routinisierten Ausdrucksmustern der Kreativität ihrer Sprecher zunehmend Grenzen. Dadurch entsteht in der Sprache so etwas wie eine Eigenstruktur in einem Bereich zwischen dem Privaten der individuellen Vorstellungswelt und dem Öffentlichen, Überindividuellen des Kommunikationsmittels Sprache.2 Die Eigenstruktur ist nämlich einerseits niemals völlig unabhängig vom VorstellungslebenVorstellungsleben der Sprecher. Die beiden Äußerungen weisen, wenn wir vom Konkreten der Vorstellungen absehen, jeweils eine AgensAgens-Handlung-PatiensPatiens-Pfad-LokationLokation-Konfiguration auf, was dem Treuezwang Genüge tut; andererseits kann nicht (mehr) jede Konfiguration von Vorstellungsinhalten so kreativ ausgedrückt werden, dass ständig neue Ausdrucksmuster entstünden, die zu RoutinenRoutine, Routinisierung neben anderen Routinen führen würden – jemanden zu sich zu nehmen und Vorwürfe von sich zu weisen unterscheiden sich in der Ausgestaltung der obigen Konfiguration nämlich recht stark. Die Sprecher einer Sprache sind stattdessen gezwungen, das meiste vorstellungsmäßig Neue analogisch mit einer geschlossenen Klasse an überkommenen Mitteln auszudrücken. Diese Konventionen erstrecken sich irgendwann auf die meisten Aspekte der Formgebung auf verschiedenen Ebenen der Sprache und sind so eng aneinandergeknüpft, dass jede Innovation, die dann doch einmal von anderen Sprechern übernommen wird, das strapazierte Gleichgewicht aus Treue und Sparsamkeit stören und Modifikationen in den überkommenen Mitteln erzwingen kann, damit dieses Gleichgewicht im Dienste der Funktionalität und Beherrschbarkeit der Sprache wieder hergestellt wird.
Читать дальше