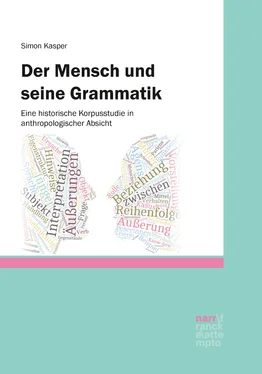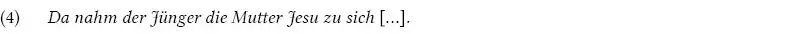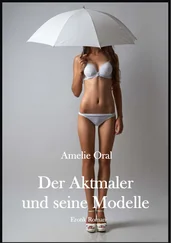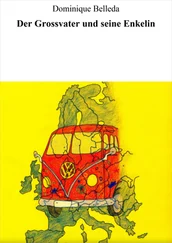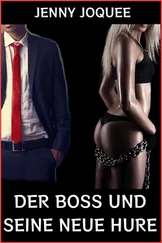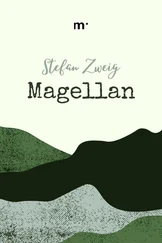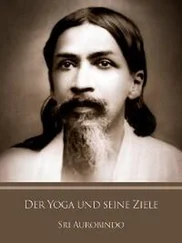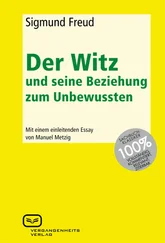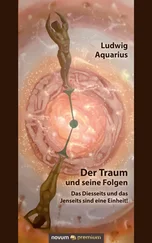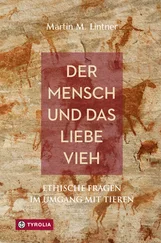1 ...7 8 9 11 12 13 ...30 Ali Zürcher chönd sie ja uf Hoochtüütsch läse, zum Biischpil i de nöie Zürcher Übersetzig. Aber vilicht isch grad drum d Bible vilne frönd plibe. S Hoochtüütschi isch ebe e Fröndspraach für öis. […] Wänn s stimmt, das d Büecher vom Nöie Teschtamänt für s Hèèrz gschribe sind, dänn mues es au e züritüütschi Übesetzig gèè.41
Diesen beiden Bibeln ist daher auch keine große öffentliche Wirkung beschieden. Sie dienen vielmehr der privaten Erbauung. „Dat Nie TestamentDat Nie Testament“ von Jessen ist eine relativ freie Übersetzung, deren Stil als „Hartslag“ bezeichnet wird. Sowohl Weber als auch Jessen haben aus dem Griechischen übersetzt.
Die Kurzcharakterisierungen der Bibelübersetzungen beziehungsweise -editionen sollte zumindest andeuten, dass sie jeweils unter sehr verschiedenen kulturhistorischen, theologie- und kirchengeschichtlichen, sprachhistorischen und editionstheoretischen Umständen entstanden sind. Wenn wir uns vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund unserer Fragestellung für jede Übersetzung so etwas wie eine generalisierte Leserin vorstellen, an der wir InterpretationsautomatismenAutomatismus und ‑routinenRoutine, Routinisierung durchspielen, die für alle Texte gelten sollen, dann ist es klar, dass wir von den meisten dieser variablen Umstände absehen müssen, um überhaupt vergleichen zu können. Die wichtigsten beiden Faktoren haben wir dabei noch nicht ausreichend berücksichtigt. Es ist der Charakter der Übersetzung selbst und die Bedingungen ihrer Rezeption. Die Übersetzung ist geprägt von den ideellen Auffassungen, die die Übersetzer von der Quellsprache der Vorlage und der Zielsprache des jeweiligen Übersetzungstextes hatten. Davon ist ebenfalls abhängig, wie sie gelesen wurde und wird. Und wie eine Bibelübersetzung gelesen wurde und wird, ist schließlich davon abhängig, wie zu einer bestimmten Zeit generell gelesen wurde. In Bezug auf diese Faktoren stehen unsere Bibelübersetzungen unter ganz verschiedenen Vorzeichen. Welche das genau sind und wie mit ihren Konsequenzen zu verfahren ist, soll aber erst erörtert werden, wenn deutlich geworden ist, was es für sprachliche Äußerungen bedeutet, grammatisch eindeutigeindeutig und grammatisch mehrdeutigmehrdeutig zu sein.42
2 Leistungen und Grenzen der sprachlichen Eigenstruktur
[A] particular utterance can have many different meanings in different situations and one and the same impression can be produced by many different utterances. Nevertheless, the hearer has the feeling of being directly in the presence of anger or other feelings of [the] o[ther person], and it would be hard to find a difference between this feeling of presence and the feeling of being in the presence of directly, visually seen objects. There certainly does not have to intervene a ‘judgment’ or an ‘inference’ just because meanings are essential data in the perceptual process.
(Heider, The psychology of interpersonal relations, S. 47)
Das Ziel dieses Großkapitels wird es sein, nachzuweisen, dass Leserinnen unserer neutestamentlichen Kapitel es mit grammatisch mehrdeutigenmehrdeutig Sätzen zu tun bekommen. Und wenn wir verstehenverstehen möchten, wie mehrdeutige sprachliche Äußerungen verstanden werden können, müssen wir zunächst einmal klären, wie es dazu kommt, dass sprachliche Äußerungen für Leserinnen anscheinend eindeutigeindeutig sein können. Die Natur der Mittel, mit denen die Ausdeutbarkeit von sprachlichen Äußerungen eingeschränkt werden kann, ist das Thema von Abschnitt 2.1. Welche Mittel dies konkret sind und welche Leistungen sie für die Interpretation erbringen können, werde ich in Abschnitt 2.2 illustrieren. In Abschnitt 2.3 werden wir sehen, wie Mehrdeutigkeit daraus resultiert, dass diese Mittel in der Interpretation nicht zur Verfügung stehen oder nicht genutzt werden. In Abschnitt 2.4 wird es dann darum gehen, wie sich diese Mittel den Lehrmeinungen zufolge zueinander verhalten. Die Abschnitte 2.5 bis 2.7 werden dann die Korpusuntersuchung vorbereiten, indem sie die Fragen behandeln, wie wir mit den historisch bedingten unterschiedlichen Übersetzungsstilen umgehen werden, wie wir die Übersetzungen auf einen gemeinsamen erkenntnistheoretischen Nenner bringen können und welche Rolle eine möglicherweise stille ProsodieProsodie als weiteres sprachliches Mittel spielen könnte. Im letzten Abschnitt 2.8 folgt der Korpusanalyse erster Teil.
2.1 Sprachliche KonventionenKonvention und Verstehenverstehen
2.1.1 Vom Privaten zum Öffentlichen
Wir verwenden Sprache nicht nur, um uns gegenseitig das Neue Testament zu übersetzen, sondern auch dazu, einander über alles Mögliche zu informieren, einander aufzufordern, etwas zu tun, Gefühle und Einstellungen miteinander zu teilen, Kontakt untereinander zu organisieren, uns zu verfluchen, zu dichten, zu beten und zu beschwören. Einige Philosophen verstehen auch das Denken – hier zu unterscheiden vom WahrnehmenWahrnehmung, VorstellenVorstellung, Erinnern und Fühlen – als sprachliche Aktivität, also als so etwas wie simuliertes Sprechen. Die meisten dieser Aktivitäten sind solche, die zwischen zwei oder mehr Interaktionspartnern stattfinden. Selbst die Dichterin, Denkerin und Tagebuchschreiberin übernimmt mindestens zwei Rollen, die der Sprachproduzentin und die der Interpretin des eigenen (simulierten) Sprechens oder Schreibens. Sie kann sich sogar durch die Mehrdeutigkeit ihrer eigenen Äußerungen selbst täuschen oder an ihr Misserfolge erleben. Auch beim Beten und Beschwören wird ein Gegenüber, ob personhaft oder nicht, vorgestellt. Um diese interaktiven Funktionen zu erfüllen, müssen sprachliche Äußerungen eine wesentliche Eigenschaft aufweisen, die man als funktionales Universal bezeichnen könnte: Sie müssen regelmäßig erfolgreich interpretierbar hinsichtlich der Frage sein, was womit inWas steht womit in welcher Beziehung? welcher Beziehung steht. Dass dies keine triviale Leistung ist, soll einmal mehr an unserem Satz aus Johannes 19, 27 demonstriert werden, aber diesmal an der neuhochdeutschen Neuen Genfer Bibelübersetzung. Dort lautet er folgendermaßen:
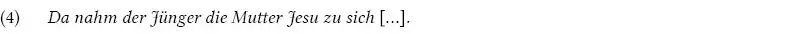
Zu Illustrationszwecken möchte ich diesmal davon ausgehen, dass der Schreiber das Ereignis, das dieser Äußerung zugrunde liegt, selbst wahrgenommenWahrnehmung und als bestimmtes Ereignis erkannt habe und es ihm nicht bereits sprachlich vermittelt worden sei. Wir können dann sagen, dass der Schreiber in Bezug auf dieses Ereignis eine für ihn bestimmte, komplexe Vorstellung erwarb; bestimmt, was die Zeit des Ereignisses (Vergangenheit relativ zum Zeitpunkt der Niederschrift), den Beginn des Ereignisses (ab dem Zeitpunkt von Jesu Erklärung), den Jünger, Jesus, die Mutter und etwa die Heimstatt des Jüngers betrifft; bestimmt auch dahingehend, dass der Jünger der Nehmer und die Mutter die Genommene war und die Bewegung des Nehmens auf den Jünger (beziehungsweise seine Heimstatt) gerichtet war; bestimmt möglicherweise auch darin, wie es dort roch, wie sich die Beteiligten fühlten, wie Jesus litt, welche Farbe der Himmel hatte, welches Material die Kleider der Beteiligten hatten, welche Frisuren sie trugen, wie der Weg beschaffen war, auf welchem Weg sie zur Heimstatt des Jüngers gelangten und so weiter. Dabei ist zu beachten, dass dies bereits eine normenNorm-, konventionenKonvention- und durch die „-enz-enz-Faktoren“-Faktoren gefilterteFilter Deutung des Ereignisses ist. (Streng genommen bringt die Deutung das Ereignis als solches erst hervor.) Ihre Bestimmtheit in Bezug auf die darin vorkommenden Gegenstände, ihre Beziehungen zueinander, ihre phänomenalen QualitätenPhänomenqualitäten undPhänomenqualitätenBedeutsamkeit ihre Wirklichkeit besitzt sie auf Kosten anderer möglicher Bestimmungen. Auf die übergeordnete W -FrageW-Fragen Was Was kann ich tun? kann ich (jetzt) tun? mag eine spätere Antwort des Schreibers gewesen sein, denen davon berichten zu wollen, die es noch nicht erfahren haben.
Читать дальше