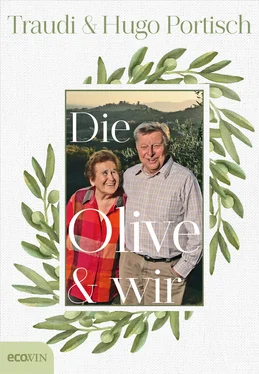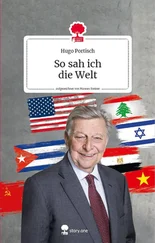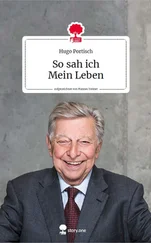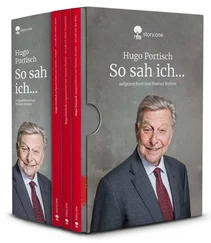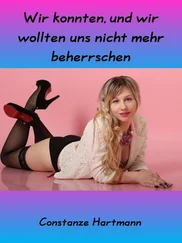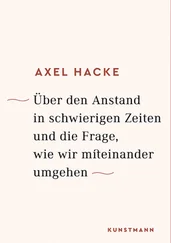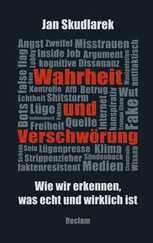Natürlich gab es auch unangenehme Überraschungen, wenn in meiner Abwesenheit irgendetwas gemacht werden musste, was nicht vorgesehen war. Zum Beispiel die Stützmauer vor der Terrasse. Jeder Eingriff in die Natur ist in dieser Landschaft zu büßen, und der Baumeister wusste dies auch, als er daran ging, Haus und Hof nach unten abzusichern.
Eine Mauer musste her, das war ihm klar, aber Mauern und überhaupt alles, was sich nicht im und um das Haus abspielte, waren ja nicht Sache des Architekten, sondern eher eine Sache des Eigentümers. Ein Bauer macht eine Stützmauer, wenn ihm eine Terrasse abzubrechen droht, also errichtete der Baumeister auch eine. Aber nicht eine Trockenmauer, wie das in dieser Gegend üblich ist, sondern eine mächtige, mit großen Steinen gemauerte Mauer, sodass das Haus plötzlich wie ein Kastell aussah. Als der Architekt und wir die mächtige Mauer das erste Mal sahen, blieb uns der Atem weg. Damals wussten wir noch nicht, dass die toskanische Landschaft von Mauern geprägt ist, und dass jeder Baumeister danach trachtet, so viele Mauern wie nur möglich zu errichten, denn erst diese machen aus einem Haus eine Art Festung. Ich glaube, das machen hier alle, und die Passion, Mauern zu bauen, stammt sicher aus der Zeit, in der jedes Dorf befestigt war und sich vor Eindringlingen schützen musste.
Es gibt in diesen Hügeln eigentlich keine Dörfer in unserem Sinn. Die Menschen in den Dörfern, wenn man ein Dorf allein nach der Einwohnerzahl von einer Stadt unterscheidet, benehmen sich wie Stadtmenschen. Es gibt keine sogenannte Dorftracht wie in unseren Alpentälern, und der Dorfbewohner unterscheidet sich durch nichts von den Bewohnern größerer Ansiedlungen.
Rund um alle toskanischen Dörfer zieht sich immer eine feste Mauer, wenn sie nicht im Laufe der Jahrhunderte zusammengebrochen ist. Ihre Reste wurden dann als Grundmauern für spätere Häuser verwendet. So wachsen diese unglaublichen Gebäude gralsburgähnlich in den Himmel und prägen die Landschaft mit ihrer bizarren Silhouette.
Wenn ich mit dem Baumeister allein war, bestand meine Sorge darin, dass er die vorhandenen Strukturen des Hauses vielleicht verändern wollte. Auf gewisse Fragen, wie man zum Beispiel etwas verputzen sollte, sagte ich immer: „No, questo è troppo palazziale“, und meinte damit, dass das zu palastähnlich wäre. Das Wort „palazziale“ gibt es im Italienischen zwar nicht, es ist aber eine ganz gute Erfindung gewesen, denn der Baumeister gebraucht es jetzt selbst.
Dieser Baumeister war ein echtes Genie, obwohl er das Gewerbe nur als Maurer gelernt hatte. Das lag im Blut dieser Leute. Seine Maurer waren ein lustiges Volk. Sie redeten viel und verstanden sich sehr gut. Punkt zehn Minuten vor zwölf verschwand jeder von ihnen auf seinem Motorino oder in seinem Fiat Cinquecento, um dann um Punkt ein Uhr wieder auf der Baustelle zu erscheinen. Nie hat einer von ihnen auf der Baustelle etwas gegessen oder auch nur einen Tropfen Bier oder Wein getrunken, was erstaunlich war, denn da war ich aus Wien anderes gewöhnt! Die Leute hier trinken nur während der Mahlzeiten – eine eiserne Regel bei Arbeitern und Handwerkern, die nur von wenigen gebrochen wird. Wein ist ein Nahrungsmittel und weniger ein Genussmittel. Zur richtigen Zeit konsumiert, löst er weder Kopfweh noch andere Beschwerden aus. Eine alte Bauernweisheit.
Am Abend waren die Arbeitsschlusszeiten nicht so genau geregelt. Manchmal ließ der Baumeister eine Arbeit nicht unterbrechen, und ich hatte schon Angst, die Ehefrauen der Maurer würden kommen, um mich zu lynchen.
Am eifrigsten arbeiteten die Maurer, wenn ich dabei war. Das hat nichts mit Faulheit zu tun, wie ich bald merken konnte, sondern mit einem gewissen Interesseverlust, der eintrat, wenn der Bauherr nicht da war, um den Fortschritt der Arbeit mitzuerleben. Wenn ich nach Wien fahren musste, und das musste ich doch ziemlich oft, dann konnte ich sicher sein, dass in meiner Abwesenheit nicht allzu viel geschah.
„Sobald Sie weg waren, sind die Leute, denen ich eine Arbeit schon seit langer Zeit versprochen habe, über mich hergefallen“, jammerte der Baumeister, und das war sicher wahr. Aber ich wusste auch, dass er und sein ganzes Team lustlos wurden, wenn ich nicht dabei war. Das bezog sich natürlich automatisch auch auf den Elektriker, den Maler, den Installateur und wer aller sonst noch am Bau beteiligt war.
Wir fanden uns mit dieser Situation ab. Schließlich hatten wir nicht so schreckliche Eile. Andere aber hatten es eilig, hauptsächlich mit Reparaturen, Dachschäden vor allem, denn die italienischen Dächer sind zwar wunderschön, aber jeder größere Sturm kann ein Dach undicht machen und der Baumeister hatte dann eben sofort zu helfen.
Warum sollte ich mich gegen die Eigenheiten dieser Leute stellen, die, wenn ich beim Bau dabei war, so wunderbar arbeiteten? Es hätte sich wahrscheinlich nichts geändert, und ich hätte mir nur selbst den Spaß dabei verdorben.
Denn lustig war die ganze Sache wirklich. Vor allem der Vorstoß in eine fremde Sprache, die mich immer vor neue Rätsel stellte. Meine größte Anstrengung beim Umbau unseres Hauses war sicher, immer verstehen zu wollen, was jeder sagte. Manchmal allerdings setzte mein Gehirn plötzlich aus und ich konnte nur auf Deutsch antworten. Dann sagte ich schnell „Arrivederci“ und zog mich in mein Hotelzimmer zurück, wo ich erschöpft in tiefen Schlaf fiel.
Natürlich hörte man mir bald an, dass ich mein Italienisch hauptsächlich von den Bauern und Arbeitern gelernt habe, und auch besondere Ausdrücke gebrauchte, die mir sehr gefielen, die aber keineswegs in irgendwelchen Wörterbüchern zu finden sind. Dies bekam ich später öfter zu verspüren, wenn ein toskanischer Freund mich jemandem vorstellte: „Das ist meine Freundin Traudi, die ihr Italienisch von den Maurern gelernt hat.“
Am liebsten rief ich alle möglichen Heiligen an, wie San Bartolomeo, oder sagte etwas deftiger „Porca miseria“, was so viel wie „Schweineunglück“ bedeutet, abgesehen von den blasphemischen porco-Ausdrücken, die ich auch bald beherrschte. Manchmal entschlüpfte mir ein derartiger Ausdruck in feiner Gesellschaft, was die Italiener sehr amüsierte.
„Du bist eine Landpomeranze geworden“, sagte mein Mann zu mir. Und ich muss zugeben, dass mich die Sorgen und Freuden der Bauern und Handwerker hier mehr interessierten als die der biederen Bürgersleute der mondänen Kurstadt, die kaum zehn Autominuten von unserem Haus entfernt ist. Hier kenne ich mich aus und lerne täglich neue Sachen, die mir in der Stadt sicher entgangen wären.
Chi troppo sa – poco sa. Wer zu viel weiß, weiß wenig .
Nichts ist so beeindruckend wie ein Olivenwald. Trotzdem würde niemand eine größere Anzahl von Olivenbäumen einen Wald nennen. Die eigentliche Bezeichnung lautet: Olivenhain. Ein antiquiertes Wort, das man sonst kaum mehr gebraucht. Es hat etwas Mystisches an sich. Ein heiliger Hain. Pan spielte in einem Olivenhain. Die Oreaden wohnten in Hainen. Orion belauschte Diana in einem Hain, und Faune tummelten sich darin.
Warum sich Oliven nur in Hainen befinden und keine Wälder bilden, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich kommt es daher, dass Olivenbäume viel Platz brauchen und deshalb immer in großem Abstand voneinander stehen. Aber da gibt es noch etwas anderes sehr Interessantes an einem Olivenbaum. Man kauft einen jungen Baum in einer Baumschule mit einem dünnen, geraden Stamm, setzt ihn ein, und es fällt einem auf, wie fremd er unter den anderen Bäumen steht. Er hat eben einen geraden Stamm! Kaum aber trägt er die ersten Oliven, fängt er an, sich auch schon zu krümmen. Ein paar Jahre danach beginnen sich die Äste nach allen Richtungen zu drehen, der Stamm teilt sich auch oft, kurz, er hat keine Ähnlichkeit mehr mit dem Baum, den man gekauft hat. Ihre groteske Veränderungskunst aber macht Olivenbäume nicht unheimlich wie manche alte Weiden, sondern zart und ätherisch, als wären sie so in die Landschaft hineingelegt. Ihre wahre Pracht aber ist die silberne Farbe ihrer Blätter, obwohl sie klein und unscheinbar sind. Oft habe ich zugesehen, wie ein einziges Blatt in Bewegung geriet, während alle anderen ganz still waren. Es schien mir dann, dass das irgendein Zeichen für mich war, das ich aber nicht deuten konnte. Die Olivengeister sind gute Geister. Das wissen alle Toskaner. Sie können es nicht beweisen, aber das ist auch nicht notwendig, denn jeder, der hierher kommt, spürt sie.
Читать дальше