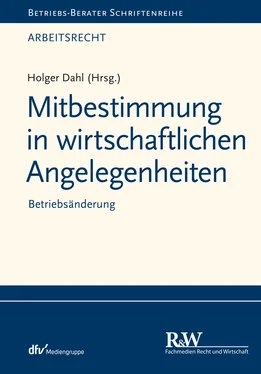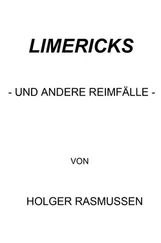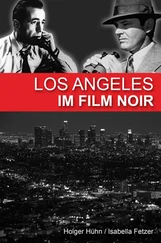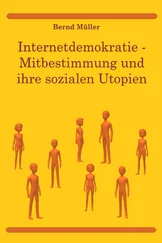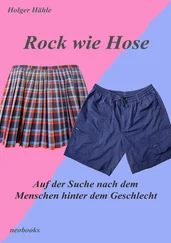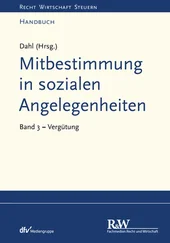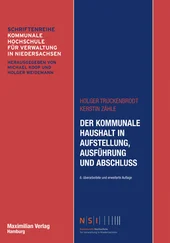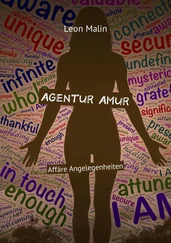13
Zur Qualifizierung der Umstrukturierungsmaßnahme als mitbestimmungspflichtige Betriebsänderung muss diese die gesamte Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft betreffen. Für die Mitbestimmungstatbestände der Einschränkung, Stilllegung und Verlegung (§ 111 Satz 3 Nr. 1 und 2 BetrVG) genügt, dass ein wesentlicher Betriebsteil von der Maßnahme betroffen ist. Ob der betroffene Betriebsteil als wesentlich anzusehen ist, bestimmt sich danach, ob dieser einen erheblichen Teil der Gesamtbelegschaft umfasst.
14
Zur Ermittlung der Erheblichkeitsgrenze im vorstehenden Sinne sind nach der ständigen Rechtsprechung des BAG die Schwellenwerte des § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG anzusetzen.15 Entscheidend für die Berechnung der Schwellenwerte ist dabei nicht die Zahl der Beschäftigten des Unternehmens, sondern die Beschäftigtenzahl des betroffenen Betriebs.16 Ist nur ein wesentlicher Betriebsteil von der Umstrukturierungsmaßnahme betroffen, ist bei der Bestimmung des Schwellenwerts auf die Anzahl der Beschäftigten des gesamten Betriebs und nicht lediglich die des betroffenen Teils abzustellen.17
15
Zusätzlich verlangt das BAG, dass mindestens 5 % der Gesamtbelegschaft von der Maßnahme betroffen sind.18 Diese zusätzliche Voraussetzung wird jedoch erste bei einer Belegschaftsstärke von mehr als 600 Beschäftigten relevant. Bis zu dieser Beschäftigtenanzahl können durch die uneingeschränkte Anwendung der Schwellenwerte des § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG interessengerechte Ergebnisse erzielt werden. Sollte jedoch etwa bezüglich einer Betriebsänderung, die einen Großbetrieb mit 3.000 Beschäftigten betrifft, der entsprechende Wert des § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KSchG ohne Einschränkung angewendet werden, würde schon die Betroffenheit von nur 30 Beschäftigten und damit lediglich von 1 % der Gesamtbelegschaft ausreichen, um eine Beteiligungspflicht des Betriebsrats auszulösen. Um nicht jede betriebliche Änderung, die nur einen sehr geringen Anteil der Beschäftigten betrifft, die Qualität einer mitbestimmungspflichtigen Betriebsänderung beizumessen, ist die Rechtsprechung des BAG zur zusätzlichen Anwendung einer 5 %-Hürde interessengerecht. Zudem müssen nach der Rechtsprechung des BAG bei Betrieben mit 20 oder weniger Beschäftigten von der Maßnahme mindestens 6 Beschäftigte betroffen sein.19
16
Der Zahl der Beschäftigten, die von der Umstrukturierungsmaßnahme betroffen sind, kam nach der Rechtsprechung des BAG zunächst nur eine indizielle Bedeutung zu.20 Nunmehr setzt das Vorliegen einer Betriebsänderung nach der Rechtsprechung des BAG wohl voraus, dass die Anzahl der betroffenen Beschäftigten die Schwellenwerte erreicht und insgesamt 5 % der Belegschaft ausmacht. Die Werte des § 17 Abs. 1 Satz 1 KSchG dienen nach der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung der Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals „erhebliche Teile der Belegschaft“ aus § 111 Satz 1 BetrVG.21
17
Bei der Durchführung mehrerer unterschiedlicher Umstrukturierungsmaßnahmen, die der gleichen Zielsetzung wie etwa einer umfassenden Unternehmenssanierung dienen und auf einem einheitlichen unternehmerischen Beschluss beruhen, ist eine Betrachtung aller von den verschiedenen Maßnahmen betroffenen Arbeitnehmer geboten. Hat der Arbeitgeber jedoch zum Zeitpunkt der Planung einer weiteren beteiligungsbedürftigen Betriebsänderung eine vorherige, unabhängig geplante Maßnahme bereits durchgeführt, sind diese und die nunmehr geplante Maßnahme mitbestimmungsrechtlich nicht zur Ermittlung der betroffenen Arbeitnehmer zusammenzurechnen.22 Die Beweislast für das Vorliegen eines einheitlichen, auf mehrere Betriebsänderungen bezogenen Entschlusses des Unternehmers liegt beim Betriebsrat.
18
Ob die wirtschaftliche und sonstige Bedeutung eines Betriebsteils, der den personellen Schwellenwert des § 17 Abs. 1 KSchG nicht erreicht, dazu führen kann, dass dieser dennoch als „wesentlich“ anzusehen ist, wurde höchstrichterlich noch nicht entschieden.23 Aus Gründen der Praktikabilität und Rechtssicherheit wäre eine Klarstellung des BAG dahingehend wünschenswert, dass Betriebsteile, welche die Schwellenwerte nicht erreichen, nicht als wesentlich anzusehen sind, selbst wenn diese eine wichtige Aufgabe innerhalb der Betriebsorganisation wahrnehmen.
19
Das Vorliegen von wesentlichen Nachteilen für die betroffene Belegschaft durch die Betriebsänderung, welches gemäß § 111 Satz 1 BetrVG Voraussetzung für die Entstehung der Beteiligungsrechte des Betriebsrats ist, wird für die in § 111 Satz 3 BetrVG aufgezählten Tatbestände bereits fingiert und muss dementsprechend nicht mehr gesondert festgestellt werden.24 Somit unterliegt eine unternehmerische Maßnahme, die einen Fall des § 111 Satz 3 BetrVG darstellt, immer den Beteiligungsrechten des Betriebsrats. Dies gilt auch dann, wenn im Einzelfall gar keine wesentlichen Nachteile für die Belegschaft entstehen.25
1. Einschränkung und Stilllegung
20
Nach § 111 Satz 3 Nr. 1 BetrVG zählt die Einschränkung oder Stilllegung eines Betriebs oder eines wesentlichen Betriebsteils als beteiligungspflichtige Betriebsänderung.
a) Stilllegung
aa) Begriffsbestimmung
21
Unter einer Betriebsstilllegung i.S.d. § 111 Satz 3 Nr. 1 BetrVG ist die Aufgabe des Betriebszwecks in Verbindung mit der Auflösung der vorhandenen Organisation durch einen endgültigen Willensentschluss des Unternehmers für eine nicht nur vorübergehende Zeit zu verstehen.26 Hierunter fällt der in der Praxis relevante Fall einer vollständigen Standortschließung aus wirtschaftlichen oder sonstigen unternehmerischen Gründen. Bei einer Betriebsstilllegung entfallen dauerhaft alle bisher bestehenden Beschäftigungsmöglichkeiten.27 Dabei ändert die in der Praxis häufig notwendige Weiterbeschäftigung von einzelnen Beschäftigten für eine gewisse Dauer zu Abwicklungszwecken nichts an der Qualifizierung der Maßnahme als Betriebsstilllegung und damit als mitbestimmungspflichtige Betriebsänderung.28
bb) Beteiligung des Betriebsrats vor der Durchführung der Stilllegung
22
Für den Unternehmer ist insbesondere der Zeitpunkt ausschlaggebend, in dem der Betriebsrat nach § 111 Satz 1 BetrVG bei einer geplanten Betriebsstilllegung unterrichtet werden muss, um etwaigen Ansprüchen der betroffenen Beschäftigten aus § 113 BetrVG auf Ausgleich der durch eine fehlende Betriebsratsbeteiligung entstehenden wirtschaftlichen Nachteile vorzubeugen. Die Beteiligungsrechte entstehen, sobald der Unternehmer den Entschluss zur Betriebsstilllegung gefasst hat. Der Betriebsrat sollte dementsprechend zur Vermeidung von Ansprüchen aus einem Nachteilsausgleich vor dem Beginn der tatsächlichen Durchführung der Maßnahmen zur Umsetzung der Betriebsstilllegung beteiligt werden.
23
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Maßnahmen bereits als Durchführung der Betriebsstilllegung gelten, sodass diese erst nach der Beteiligung des Betriebsrats zu empfehlen sind. Die Einstellung der Produktion stellt noch keine Betriebsstilllegung dar, da diese jederzeit einseitig vom Unternehmer rückgängig gemacht werden kann, sollte die Betriebsorganisation als solche noch bestehen.29 Ebenso verhält es sich mit etwaigen Freistellungen der betroffenen Beschäftigten, da eine Freistellung den Bestand des Arbeitsverhältnisses nicht tangiert.30 Ob der Ausspruch von Kündigungen bereits die Durchführung der Betriebsstillegung darstellt, hängt davon ab, ob der Arbeitgeber bereits den Entschluss gefasst hat, den Betrieb zu schließen.31
24
Maßgeblich für den Zeitpunkt des Beginns einer Betriebsstilllegung ist dementsprechend, ob die betriebliche Organisation durch die Maßnahme des Unternehmers aufgelöst wird und ob die Maßnahme unumkehrbar ist oder von dem Unternehmer einseitig wieder aufgehoben werden kann.32 Dies ist beispielweise bei der Veräußerung von Betriebsmitteln nicht der Fall,33 diese Maßnahme kann nicht ohne die Mitwirkung des Käufers der Betriebsmittel rückgängig gemacht werden.
Читать дальше