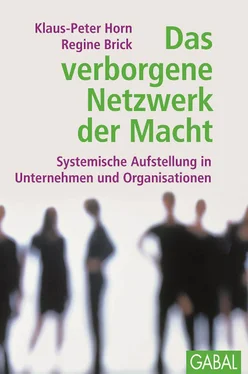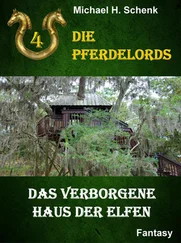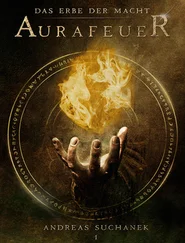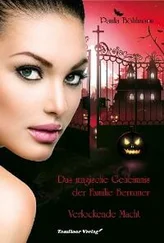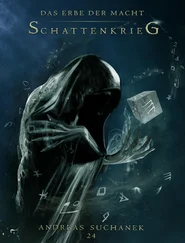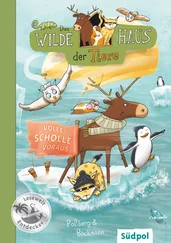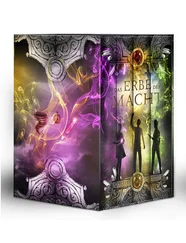1.2 Das Gewissen als systemischer Kompass
Beim einzelnen Menschen wie in Organisationen führt eine besondere Kraft zum Ziel oder auf Abwege: das Gewissen . So, wie wir es hier verstehen, hat es mit moralischen Prinzipien oder hehren Idealen wenig zu tun. Vielmehr handelt es sich um eine Art Kompass, der uns sagt, ob wir uns auf dem richtigen Kurs befinden. Mit unserem systemischen Gewissen verfügen wir über eine Art sozialen Orientierungssinn, der uns nicht über »gut« und »böse« im moralischen Sinne informiert, sondern darüber, ob wir uns in unserem Umfeld auf dem richtigen Kurs befinden. *
Das Gewissen zeigt uns, wo es langgeht – völlig moralinfrei
Dieser innere Kompass zeigt ganz sachlich und amoralisch stets genau nach Norden. Was aber »Norden« ist, wo es also entlanggeht in einem Unternehmenssystem, kann sich von anderen, ähnlichen Systemen radikal unterscheiden. In einem traditionsreichen, mittelständischen deutschen Familienunternehmen können z. B. Pünktlichkeit, Genauigkeit und engagierte Leistungsbereitschaft im »Norden« liegen, also die gemeinsame Orientierung für alle Systemmitglieder darstellen. Werte wie Pünktlichkeit und Genauigkeit, dazu Normen wie freiwillige, unbezahlte Mehrarbeit geben in diesem System das »Was« und das »Wie« an. Also: »Was wollen wir erreichen? Exakt gefertigte Produkte pünktlich an den Kunden ausliefern. Wie wollen wir es erreichen? Mit hohem individuellen Einsatz.«
Ob nun extrem hoher Einsatz auch effektiv ist und wirtschaftlichen Erfolg bringt, ist zumindestens fraglich. Aber darum geht es nicht. Denn »Effektivität« liegt nicht im »Norden« dieses Unternehmens. Keine Frage also, dass alle Unternehmensangehörigen, vom jüngsten Azubi bis zum Chef, auf systemeigene Weise »eingenordet« sind. Jedes Mitglied dieses Systems hat ein gutes Gewissen, wenn es voll engagiert in den Abend und ins Wochenende hinein arbeitet, und ein schlechtes, wenn es sich einmal eine längere Pause gönnt. So weit durchaus nichts Ungewöhnliches, denn die beschriebene Orientierung ist bei uns gesellschaftlich, also in einem größeren systemischen Zusammenhang, akzeptiert und sehr verbreitet.
Die amoralische (nicht un moralische) Qualität des systemischen Gewissens wird deutlich, wenn wir uns jetzt im Kontrast zu obigem Beispiel einer Mafiaorganisation zuwenden. Dieses Gewissen arbeitet keinen Deut anders. Ein Angehöriger dieser kriminellen Vereinigung hat ein völlig reines Gewissen, wenn er beispielsweise von den Restaurantbesitzern seines Reviers ein hohes Schutzgeld erpresst. Sowohl das »Was« als auch das »Wie« liegen exakt im »Norden« seines Systems. Er wird von seinen Kollegen und Vorgesetzten neben seinem Anteil ein anerkennendes Schulterklopfen ernten, das ihm sagt: »Du machst es richtig. Du gehörst zu uns!«
Dazugehören – koste es, was es wolle
Zugehörigkeit zum eigenen System bedeutet Überleben. Dieses Erbe bringen wir aus dem Tierreich mit, dessen verschiedene Evolutionsstadien in unseren Verhaltensprogrammen gespeichert sind. Für unsere nächsten Verwandten, die Säugetiere, ist die Zugehörigkeit zum Rudel oder zur Herde lebensentscheidend. Das verirrte Schaf ist ebenso verloren wie der ausgestoßene Junglöwe.
Da wir die denkbar stärkste Motivation besitzen, zu unserem jeweiligen sozialen System zu gehören, ist es enorm schwierig, kontraproduktives Verhalten, das im gesamten Unternehmen auftritt, zu verändern!
Wenn z. B. hochwertige, präzise mechanische Fertigung im Gegensatz zur gefragten Schnelligkeit und Kostengünstigkeit steht, gibt es Probleme. Was nützen perfekte, hochwertige Produkte, wenn niemand sie kauft, weil der Kunde mit schnell lieferbarer und zudem billigerer Elektronik sein Ziel auch erreicht? Es wäre höchste Zeit zur Umorientierung! Dazu müssten die Unternehmensführer und Mitarbeiter jedoch gegen ihr systemisches Gewissen verstoßen.
Beispiel Maschinenbau
Die Krise des deutschen Maschinenbaus hat in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass sie genau das nicht tun, selbst wenn der Untergang die unausweichliche Folge ist. Lieber zahlen Mitglieder eines zwischenmenschlichen Systems diesen Preis, als gegen ihr systemisches Gewissen zu verstoßen. Verstärkt wurde diese Haltung im deutschen Maschinenbau mit einer in den Jahren des Erfolgs aufgebauten überheblichen Überzeugung, dass gute deutsche Wertarbeit durch Elektronik nicht zu ersetzen sei – schon gar nicht durch asiatische. Wäre zu Beginn der Maschinenbaukrise eine systemische Simulation mittels Aufstellung erfolgt, hätte man sehen können, welche Wirkung die Einstellung der deutschen Industrie zu elektronischen Neuerungen und zur asiatischen Konkurrenz auslösen musste. Ein klarer Blick auf zukünftige Folgen hätte rechtzeitiges Gegensteuern ermöglicht.
1.3 Die verborgenen Führungsleitlinien
Systemgesetze wirken im Verborgenen
Wer oder was bestimmt eigentlich Ihre Unternehmensstrategien? Betriebswirtschaftliche Berechnungen allein sind es wohl kaum. Im letzten Jahrzehnt haben wir einen Boom von »weichen« Faktoren erlebt. Corporate Identity, Unternehmensphilosophie und Visionsentwicklung sind in aller Munde. Aus den USA importieren wir jetzt den Trend, im »Humankapital« den eigentlichen betriebswirtschaftlichen Engpass zu erkennen. Wie auch immer Sie Ihre Ziele definieren und Ihre Strategien ableiten: Ihr Unternehmen arbeitet nicht nur nach selbst gestellten Aufgaben und Zielen. Es ist auch von unsichtbaren Gesetzen bestimmt, die im Verborgenen äußerst kraftvoll wirken – zum Guten wie zum Schlechten.
Weil sie im Verborgenen wirken, sind diese Gesetze den Menschen in Unternehmen meist nicht bewusst. Wie spüren Sie dann ihre Wirkung? Nun, woran merken Sie, dass Sie, beispielsweise auf einer Silvesterfeier, bestimmte biologische Gesetze Ihres eigenen Körpers übertreten haben? An einer Kater-Rückmeldung am Neujahrsmorgen! Wenn Sie die biologischen Grenzen und Gesetze respektieren, fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut. Ebenso fühlen Sie sich als Mitglied eines zwischenmenschlichen Systems unterstützt und gestärkt, wenn Sie dessen Gesetze einhalten, aber persönlich geschwächt, wenn Sie sie missachten.
Im Unternehmen sind typische Symptome für die Missachtung von Systemgesetzen plötzlich kündigende Mitarbeiter und Kunden, interne Machtkämpfe, Sabotage, massive Umsatzeinbrüche oder lähmende Stagnation.
Ohne systemische Einbindung steht Sanierung auf schwachen Füßen
Diese Alarmzeichen werden bisher meist missdeutet. Was tun Unternehmensführer, wenn es hakt und bremst, wenn Motivation, Marktanteile und Umsätze sinken und die Fluktuation steigt? Sie rufen nach Sanierern und Kostendrückern! Doch deren Erfolg ist fraglich – wie manche »Star«-Sanierer öffentlich bewiesen haben. Denn erstens sind nicht alle Probleme durch Controlling in den Griff zu bekommen. Und zweitens verschlimmern viele Sanierer trotz bester Absichten in Unkenntnis ihrer systemischen Wirkung die Situation. Das System reagiert wie auf Eindringlinge und verbraucht so kontraproduktiv seine letzten Kräfte. Ähnlich einem menschlichen Immunsystem wehrt es sich mit Warnsymptomen gegen den Angriff.
Menschliche Systeme – Familien ebenso wie Unternehmen und Organisationen – wollen überleben und schützen deshalb sich und ihre Mitglieder gegen Angriffe von außen. Wird eines ihrer systemerhaltenden Prinzipien massiv verletzt, folgen daher unbewusste Ausgleichsbewegungen mit unkontrollierbaren Wirkungen. Woran liegt das?
Ein Unternehmen funktioniert wie ein Netzwerk aus Menschen, Informationen und Technologien und ist mit anderen Netzwerken (Kunden, Markt) eng verbunden. Jede Handlung hat eine Auswirkung auf alle Beteiligten. Deshalb gibt es im Netzwerk ein unausgesprochenes Wissen darüber, was gut ist, was stört und was das Ganze schwächt oder stärkt. Wenn Teile des Netzwerks gegeneinander arbeiten oder sich aus dem Ganzen lösen, funktioniert das System schlecht. Ein Problem bildet sich dann häufig wie ein Warnsymptom und weist auf ein »überzogenes Konto« hin.
Читать дальше