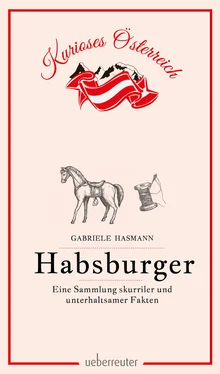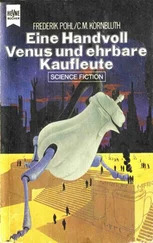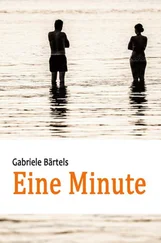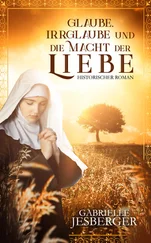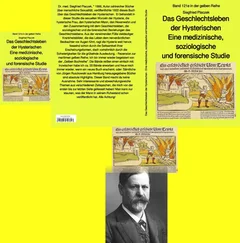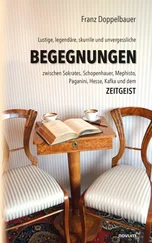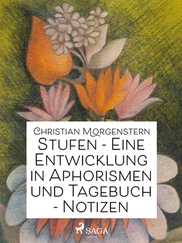Der royale Erbschleicher Der royale Erbschleicher Zwei lukrative Vormundschaften Friedrich III. übernahm nach dem Tod seines Onkels Herzog Friedrich IV. und seines königlichen Vorgängers Albrecht II. die Vormundschaft über deren minderjährigen Söhne Sigmund und Ladislaus. Seine Ambition war jedoch nicht Wohltäterschaft, sondern die Einverleibung des ererbten Vermögens der beiden. Sigmund und Ladislaus – Letzterer kam erst nach dem Tod seines Vaters zur Welt und trug daher den Beinamen „Posthumus“– sahen nie auch nur eine Silbermünze. Da Albrecht II. vor seinem überraschenden Tod keine Zeit mehr gehabt hatte, sich um die finanzielle Versorgung seiner Gattin Elisabeth zu kümmern, musste diese nach und nach das Familiensilber veräußern. Ein Pfandhändler kam auf diese Weise in den Besitz eines goldenen Diadems und anderen Schmucks sowie von 50 Rubinen und 56 Saphiren. Es ist nicht schwer zu erraten, wer die Schätze auslöste und damit seinen Reichtum weiter vergrößerte. Auch die Stephanskrone, das Herrschaftssymbol Ungarns, bekam Friedrich auf ähnliche Weise in seine Finger. Er musste sie allerdings wieder herausrücken, als der Ungarnkönig Matthias Corvinus politischen Druck auf ihn ausübte und ihn sogar anzugreifen drohte. Als der junge Ladislaus seine Regentschaft antrat und den ungarischen Thron bestieg, erfuhr er die Geschichte der auf zwielichtige Weise angeeigneten Krone. Aufgestachelt und zornig schickte er ein ziemlich grobes Schreiben an seinen ehemaligen Ziehvater und forderte ihn zur Herausgabe seines Erbes auf. Da der Kaiser jedoch kurz zuvor nach einem Angriff der ständischen Opposition die Vormundschaft des Jungen hatte abgeben müssen, weigerte er sich und behielt sowohl das Geld als auch die Wertgegenstände. Knapp bei Kasse musste nun auch Ladislaus seine letzten Kleinodien beim Pfandleiher zu Geld machen. Friedrich eilte sofort los und holte die Kostbarkeiten zurück – um auch diese seinem Schatz hinzuzufügen.
Bildungslücken Bildungslücken Der lesefaule und asketische Kaiser Friedrich III. verschenkte, wenn er denn schon Präsente überreichen musste, gern Bücher. Dabei handelte es sich im Mittelalter um durchaus wertvolle Gaben, da der Buchdruck noch nicht erfunden war und es sich bei jedem einzelnen Werk um ein Unikat handelte. Der Monarch selbst zeigte wenig Interesse am Lesen, wie ein Zeitgenosse einmal spöttisch anmerkte: „Der Kaiser gibt den Lorbeer, aber er kann ihn nicht schätzen. Eher liebt er das Lied, wie der Barbar es singt.“ Dennoch hat der Monarch Die Geschichte Österreichs bei Historiker Thomas Ebendorfer in Auftrag gegeben – ein Prestigeobjekt für seine „Scheinbibliothek“. Als der Autor seinen umfangreichen Wälzer im Jahr 1451 bei Friedrich III. ablieferte, verschlug es diesem die Sprache. Erschrocken bat er um eine Kurzfassung des Inhalts, damit er Auskunft geben konnte, sollte ihn jemand über die Vergangenheit des Landes befragen. Zum Desinteresse gesellte sich bei Friedrich schon bald rigorose Askese. Seine hübsche und temperamentvolle Gemahlin Eleonore von Portugal verbitterte zunehmend an der Seite ihres Mannes, der Musik, Tanz, gutes Essen, Alkohol und Sex verschmähte. Der Kaiser hatte zudem die spleenige Angewohnheit, niederzuschreiben, was ihn den ganzen Tag über bewegte – und dabei handelte es sich selten um helle Geistesblitze. Auf diese Weise entstand ein Sammelsurium an Textfragmenten mit Inhalten zu wissenschaftlichem Halbwissen, religiösem Glauben und antiker Mystik. Hinzu kamen selbst erdachte Lebensweisheiten und irgendwo aufgeschnappte Sprichwörter. Im Alter befasste sich der Monarch mit Alchimie, in der Hoffnung, selbst Gold herstellen zu können. Das einzige konkrete Ergebnis seiner Labortätigkeit war ein Trank, der bei allen Leiden Heilung herbeiführen sollte. Seine Hofbediensteten bekamen dieses Elixier zu Versuchszwecken häufiger verabreicht als ihnen lieb war.
Ein rätselhafter Code Ein rätselhafter Code Des Kaisers Vorliebe für eine Vokalreihe Kaiser Friedrich III. hegte eine fast schon kindliche Vorliebe für ausgefuchste Rätsel – sein größtes hat er der Menschheit hinterlassen: AEIOU! Mit dieser kryptischen Buchstabenfolge, deren Geheimnis bis heute nicht gelüftet ist, versah der schlitzohrige Monarch neben seinem Wappen alle möglichen Gegenstände in seinem Regentenhaushalt, egal ob es sich dabei um Kleinodien, Tafelgeschirr oder Wäsche handelte. Ebenso platzierte er die Vokalreihe als mystisches Besitzzeichen an diversen Bauwerken wie an seinen österreichischen Burgen in Wiener Neustadt, Graz und Linz sowie an der Orgelempore der Ruprechtskirche, dem ältesten Gotteshaus in Wien. Sie befinden sich darüber hinaus am Marmorgrab Friedrichs III. im Wiener Stephansdom. Auf Initiative Maria Theresias hin ziert das AEIOU seit 1752 außerdem das Wappen der Militärakademie Wiener Neustadt sowie die Siegelringe ihrer Absolventen. Übermittelte der listige Habsburger mit der mysteriösen Signatur seinen Nachfolgern eine Botschaft oder handelte es sich um einen Code für seine Verbündeten? Interpretationsversuche wie unter anderen „Alles Erdreich ist Österreich Untertan“ oder „Austria erit in orbe ultima“ (lat. für „Österreich wird bestehen bis ans Ende der Welt“) stellen lediglich Theorien und keinesfalls des Rätsels Lösung dar. Sie sind sogar relativ unwahrscheinlich, da den Phlegmatiker Friedrich eher Ängste vor Räubern quälten als imperialistische Visionen. Es existiert außerdem eine Deutung die Geburtsdaten Friedrichs III. und seines Vorbilds Rudolf IV. betreffend. Auch die Tatsache, dass König Salomo – sein Bruder im Geiste, was die Jagd nach Gold betrifft – diese Kürzel schon rund 450 Jahre zuvor verwendet hat, könnte hinter Friedrichs Ambition stehen. Am wahrscheinlichsten aber ist: Der Habsburger war einfach zu einfallslos, um sich eine schlauere Signatur auszudenken.
Die Tricks des Kaisers Die Tricks des Kaisers Zwietracht säen und Köder auslegen Da der an sich eher lethargische Friedrich III. absolut kein Talent zum Herrschen hatte, musste er sich hin und wieder der einen oder anderen List bedienen, um als Monarch glaubwürdig zu bleiben. Wollte er beispielsweise das Volk daran erinnern, dass er die Allgewalt besaß, griff er zu folgendem Trick: Wer seine Regeln missachtete oder Gesetze brach, wurde vorerst nicht bestraft, sondern in Sicherheit gewiegt. „Die Rache ist die Wirtschafterin der Zeit“, stand in des Kaisers Notizbuch, und daran hielt er sich auch – er zog die Betreffenden erst dann zur Rechenschaft, wenn sie dachten, noch einmal davongekommen zu sein. Zudem säte der Habsburger still und leise, vermutlich mit einem schadenfrohen Grinsen im Gesicht, Zwietracht zwischen jenen, die sich in ihrer Abneigung gegen ihn einig waren. Bis eine der beiden Seiten seine Hilfe im Kampf gegen die andere benötigte und ihn um Unterstützung bat – woraufhin der Kaiser freundlich, aber bestimmt darum ersuchte, den Streit ohne sein Zutun und möglichst friedlich beizulegen. Oder er half der einen oder anderen Partei und forderte anschließend eine Gegenleistung. Eine im krassen Gegensatz zu seiner beruflichen Durchtriebenheit stehende kindlich List wandte Friedrich III. in seinem Privatleben an: Als den alternden, nörgelnden Griesgram in seinen späten Jahren kaum jemand mehr ertrug, ihm sogar die Dienstboten wegzulaufen drohten, versteckte der Kaiser in den Räumen seiner Burgen winzige Goldschätze als Köder, die man behalten durfte, wenn man sie fand. Das funktionierte – zumindest eine Zeit lang. Als sich das royale Manöver erst einmal herumgesprochen hatte und die Motivationsklunker auch immer kleiner ausfielen, verstaubten seine Gemächer wieder zusehends. Auch die Küche blieb kalt und so verstarb der Kaiser tatsächlich an den Folgen übermäßigen Obstgenusses mit folgendem ruhrartigen Durchfall.
Читать дальше