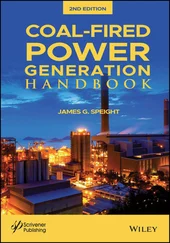23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken!
24 Sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin, leite mich auf dem Weg der Ewigkeit!
Psalm 139,1–4.16–18.23–24
Wenn es uns gut geht, wenn unser Leben munter und kinderleicht verläuft, könnten wir womöglich meinen, dass wir Gott nicht nötig hätten. Dass wir auch ohne ihn ganz gut klarkommen würden. Doch das ist fatal und ein Trugschluss! Wir sollten uns immer eng an Gott halten und mit Jesus leben. Auch hier gilt „in guten wie in schweren Zeiten“. Eine Sache stimmt jedoch: Dass es uns nämlich in schwierigen Zeiten näher zu Gott hinzieht. Es fällt uns dann leichter, uns ihm zuzuwenden. Weil wir wollen, dass Dinge wieder gelingen, Beziehungen funktionieren, Zustände sich wieder verbessern. Die Not bringt Menschen somit oft und fast schon unmittelbar zu Gott. Schon morgens beim Aufwachen denken wir dann an das Problem, das uns so bedrängt. An eine Niederlage. Die verpatzte Prüfung. Die zerbrochene Liebschaft. Die verlorene Arbeitsstelle. Wir spüren stechenden Schmerz, körperlich oder seelisch. Wir befinden uns in tiefer Trauer. Oder wir sind total einsam, halten uns selbst kaum aus. Dann fällt es leichter, dass wir Gott morgens direkt bitten, dass er eingreifen möge. Wenn wir krank sind und mit verschnupfter Nase und dickem Kopf erwachen, dann ist ganz klar, was wir uns wünschen. Wir wollen wieder gesund sein. Also bete ich dann sofort darum, dass ich rasch wieder gesund werde. Interessanterweise gibt es eine schleichende Übergangszeit, die ich oft schon beobachtet habe. Eines Tages ist man wieder gesund – geworden – ohne, dass man das zunächst so ganz explizit sofort bemerkt hätte. Wir bewegen uns einfach weiter, funktionieren, machen und tun. Und wie aus dem Nichts fällt uns dann vielleicht und hoffentlich, fast mit Schrecken, auf, dass wir wieder gesund sind. Mit Schrecken fällt es mir deshalb auf, weil ich ja schon einige Zeit gesund gewesen sein musste, ohne es richtig bemerkt zu haben. Da schleicht sich so eine Gewohnheit ein, dass man das nicht mehr richtig wahrnimmt, nicht mehr richtig wertschätzt. Schon allein deshalb könnten wir eigentlich im Umkehrschluss an jedem Morgen, an dem wir gesund erwachen dürfen, dankbar sein – Gott für diesen guten, da gesunden Morgen danken.
Dieses Buch entstand in den unwägbaren anfänglichen Corona-Zeiten. Wie oft habe ich mit Freunden und Glaubensgefährtinnen telefoniert. Wir waren richtig fertig, oft verärgert, dann wieder entmutigt, wütend, ungläubig ob der ganzen Verbote, Umstände, Zustände. Und wiederum eines Morgens – ausgerechnet beim Haarebürsten – fiel es mir fast wie Schuppen von den Augen: Es könnte noch schlimmer sein, ich könnte das Virus haben. Doch – ich – bin – gesund. Ich darf gesund sein. Wenn ich mich jetzt schon, im gesunden Zustand, morgens zermürbt fühle – wie viel zermürbter wäre ich, wenn … Das allein hat mich ermutigt, meine Situation wertzuschätzen. Auch wenn unbestritten viele Einschränkungen dagewesen sind. Doch diese Einschränkungen plus die Erkrankung, das wäre in Kombination richtig heftig. Dennoch halten andere Menschen das aus. So war ich fortan, meistens zumindest, dankbar für meinen aus dieser Perspektive ganz annehmbaren Zustand. Das darf jetzt freilich nicht heißen, dass wir alles relativieren sollen, uns mit sterbenskranken Menschen vergleichen. Das wäre allein diesen leidenden Menschen gegenüber nicht fair. Für diese können und sollten wir beten. Wir für uns jedoch können unseren kleinen Mikrokosmos durchleuchten, was da drin los ist. Was in uns los ist. Wie wir den Fokus umlenken können auf die guten Dinge in und um uns herum. Das alles gelingt in einem Schnell-Merker-Modus, indem wir morgens noch im Bett liegen, kurz vorm Aufstehen. Indem wir ganz entspannt, vor der Arbeit des Tages, erstmal eine Runde beten.
Das Wichtigste kommt vor dem Frühstück
Versuchen Sie, wenn Sie aufgestanden sind, eine „Stille Zeit“ für sich und Gott einzurichten. Das kann am Küchentisch sein, auf dem Sofa oder am Schreibtisch. Hauptsache, Sie haben Ruhe und fühlen sich wohl. Übrigens muss man dafür nicht geschminkt und top gestylt am Tisch sitzen. Doch vielleicht mögen Sie eine Kerze anzünden, bevor Sie Ihre Bibel oder ein Buch mit Gebetsimpulsen aufschlagen. Womöglich ist es draußen noch dunkel, ein verhangener, ruhiger Tag. Das Haus schläft. Oder draußen geht die Sonne auf – ein magischer Moment. In diesem Moment sprechen Sie zu Jesus und Gott. Wie mit einem Menschen. „Guten Morgen Jesus, da bin ich. Diese Zeit gehört uns beiden.“ Man muss nicht immer etwas zu sagen haben. Wir dürfen auch einfach in dieser Stille verweilen. Hineinhorchen, ob Jesus uns etwas mit auf den Weg für den Tag geben will. Oft ist nichts zu hören, weil wir zu unruhig sind. Möglicherweise bekommen wir aber mehr Klarheit, wissen nach einem Gebet, wie wir eine Situation lösen können, deretwegen wir zuvor ratlos gewesen sind. Mit dem Stillsein ist das manchmal gar nicht so leicht. Vielleicht kommen wir nicht zur Ruhe, oder rasende Gedanken lenken uns ab. Wir sind gedanklich schon bei den verschiedenen Tagesaktionen, die von uns heute erwartet werden. Doch dann halten wir genau das Jesus hin. Das, was gerade mit oder in uns los ist, das halten wir ihm hin: „Jesus, heute kann ich nichts fühlen. Jesus, heute kann ich Dich nicht hören. Jesus, heute kann ich mich selbst nicht leiden, heute bin ich verzweifelt. Jesus, heute fühle ich mich gehetzt und kann keine lange Stille Zeit abhalten, vielleicht muss ich gleich abbrechen, bitte vergib mir.“ Diese Stille Zeit ist Gebet. Auch wenn Sie nichts sagen, wenn Sie nicht innerlich ununterbrochen beten, reden, sich austauschen. Es ist die Haltung und das Dasein vor und für Gott, vor und für Jesus, auf die es ankommt. Das geht nur, wenn wir es einrichten. Wenn wir Zeit freiräumen, damit ein Gebetsraum entstehen kann. Erfahrungsgemäß geht das am frühen Morgen leichter als im Trubel des Tages oder in den Schlummerstunden des Abends. Für mich klingt das fast wie „gestohlene Zeit“, weil sie so besonders ist. Glauben Sie nicht, dass ich jeden Morgen eine Stille Zeit hätte. Ganz oft habe ich diese nicht, bin traurig und betrübt darüber. Es will mir einfach nicht gelingen. Doch wenn ich sie einmal einrichten kann, dann frage ich mich, wie ich all die anderen Tage nur aushalten und durchlaufen konnte – ganz ohne diesen intensiven Gottesmoment. Ganz ohne den Kontakt aufgefrischt zu haben. Unserer Familie wünschen wir doch auch täglich aufs Neue einen Guten Morgen, besprechen kurz den Tageslauf, freuen uns aufs Wiedersehen am Mittag oder Abend. Jesus gehört auch zu unserer Familie. Deshalb sollte er einfach dabei sein. Ohne ihn geht es nicht. Also leben wir auch entsprechend. „So Jesus, guten Morgen, ich sage Dir jetzt, was heute bei mir ansteht. Und ich freue mich immer, wenn wir beide uns austauschen können, Du und ich. Also, ich muss jetzt los, bis später, und danke für alles!“
Mir geht es so, dass ich oft überlege, wie mir das mit dem Beten besser gelingen kann. Wie man sich dazu fast schon „überlistet“. Deshalb mache ich mir viele Gedanken dazu. Die müssen natürlich raus. So kommt es, dass ich mit verschiedenen Freunden und Bekannten darüber spreche. Und so kam es, dass mir jemand eines Tages nach dem Gottesdienst von einer herrlichen Analogie berichtet hat. Das hat mich deshalb so begeistert, weil es so logisch für mich klang, so lebensnah. Das ging mir direkt ins Ohr und ans Herz. Es ging um die persönliche Beziehung zu Jesus und darum, wie viel Zeit man mit ihm verbringen sollte. Mit „man“ meine ich Sie, mich, uns alle. Also wie viel Zeit sollten wir mit Jesus verbringen? Schon komisch, wenn man so was fragen muss. Wir würden wohl kaum auf die Idee kommen zu fragen, wie viel Zeit wir mit einem lieben Menschen verbringen müssen … doch Zeit mit Jesus verbringen, mit ihm reden, ihm begegnen – das genau ist Beten. Wie oft müssen wir beten? Kann das unser Ernst sein? Und doch ist es so oft mein – unser – Ihr Ernst. Und so waren wir seinerzeit bei genau dieser Frage des Betens angekommen. Dieser Jemand, am Sonntag nach dem Gottesdienst, verglich das folgendermaßen: Wenn er sonntagmorgens vor dem Gang in die Gemeinde am Frühstückstisch mit seiner Frau sitzt, dann wäre es doch völlig kurios, wenn er nicht mit seiner Frau reden würde. Wenn nichts stattfände. Keine Interaktion, keine Kommunikation, einfach nichts. Stumm dasitzen, sich anschweigen. Oder wenn man nicht mal einen gemeinsamen Raum teilen würde. Er sitzt im Wohnzimmer. Sie in der Küche. Jeder frühstückt allein und stumm vor sich hin. Keine Ansprache. Keine Gemeinschaft. Obwohl es doch das Gegenüber gibt – greifbar nah – wenige Schritte, ein Gespräch weit entfernt. So war es für diesen Jemand total wichtig, dass er mit seiner Frau beim Frühstück und auch sonst spricht. Sonst wäre das einfach nicht normal, unnatürlich, völlig fremd. Und man würde sich dadurch fremd, irgendwann. Man würde nicht so eng verbunden bleiben. Das genau verglich er im nächsten Atemzug mit der Verbindung eines jeden zu Jesus. Dass da auch eine Verbindung da sein müsste. Dass es sonst komisch wäre. Eben nicht normal, sondern unnatürlich, völlig fremd. Genau deshalb sollten wir immer im Dialog bleiben. Mit unseren Partnern, Freunden und ebenso mit Jesus. Klar kann man nicht ständig quatschen. Irgendwann müssen wir auch mal die Luft anhalten, sei es beim Zahnarzt, bei einem Vortrag oder anderswie. Irgendwann müssen wir natürlich auch arbeiten, uns konzentrieren. Oder wir schlafen. Entspannung muss sein. Da kann man nicht unentwegt reden. Doch wenn die Basis stimmt, kann man sich auch im Schweigen verstehen. Darauf kommt es an! Denn das Herz funkt weiter, die Liebe und Wertschätzung zum anderen hält nicht an, wenn wir einfach mal leise sind. Die geht weiter. Es ist die Herzenshaltung, die uns Lust macht, uns mit dem anderen zu beschäftigen. Mit dem Verlangen nach Austausch, nach Beziehung, nach gemeinsamem Wachstum. Austausch geht bekanntlich übers Reden und den Dialog – mit dem wertvollen Gegenüber. Im Lukasevangelium gibt es im Kapitel 6 im Vers 45 einen Teilsatz, der es auf den Punkt bringt.
Читать дальше