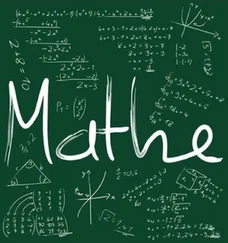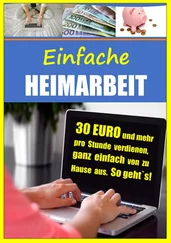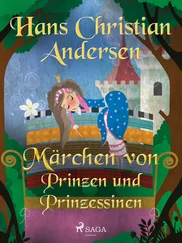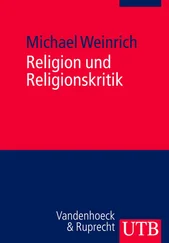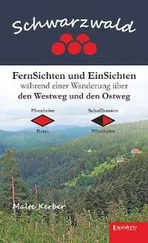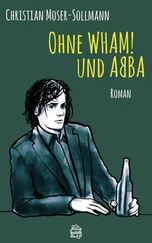Weil die wichtigsten Konzepte säkularer politischer Ethik bereits aufgearbeitet wurden (vgl. Jäggi 2017a, Schockenhoff 2018 sowie Jäggi 2018a) und zentrale religiösen Texte des Judentums, des Christentums und des Islams auf unsere Fragestellung hin analysiert und diskutiert worden sind (vgl. Jäggi 2019a; Jäggi 2020a sowie Schockenhoff 2018; Jäggi 2021a), liegt das Schwergewicht dieses Bandes auf der Gegenüberstellung, dem Vergleich und der Synthese 1jüdischer, christlicher und islamischer Texte auf der einen Seite und säkularer Denkansätze auf der anderen Seite. Ein Grundproblem eines solchen Vorgehens in Bezug auf säkulare und religiöse Friedensvisionen liegt im völlig unterschiedlichen Bezugsrahmen säkularer und religiöser Friedensethiken und in deren stark divergierenden Ausrichtung.
Nur am Rand berücksichtigt wird in diesem Band die gegenseitige Rezeption religiöser und säkularer Friedens- und Heilskonzepte und die Wirkungsgeschichte dieser Auseinandersetzungen. Dagegen liegt das Gewicht auf gemeinsamen und übergreifenden Konzepten und auf Bausteinen der einzelnen Weltanschauungen und religiösen Vorstellungen, die sich möglicherweise zu einem gemeinsamen Weltfriedensverständnis und zu einer übergreifenden Friedensordnung zusammenfügen lassen.
Dabei sollen auch die Schwierigkeiten eines solchen Vorgehens nicht verschwiegen werden: Viele Bezüge in religiösen und auch in säkularen Texten sind auf frühere Lebenskontexte ausgerichtet, der Fokus liegt oft auf einzelnen Postulaten oder Verhaltensnormen, vielfach werden frühere Ereignisse literarisch so dargestellt oder gar narrativ konstruiert, dass sie zur Intention des Erzählers passen, der keinesfalls heutige Problematiken und Fragestellungen im Blick hatte. Darum sind immer nur indirekte Vergleiche oder Bezüge möglich, also punktuelle Aussagen und Denkfiguren, aber keinesfalls eine unkritische und umfassende Übernahme früherer Normenvorstellungen in globo, etwa im Sinne einer engen Glaubensethik oder einer politischen Utopie irgendwelcher Art. Trotzdem scheint es berechtigt, frühere Texte oder Textfragmente auf heutige Fragen zu beziehen – etwa um Abstand zu heutigen, oft unkritischen Sichtweisen zu gewinnen und vielleicht im besten Fall zu einem Perspektivenwechsel zu gelangen, der gar neuen Raum für innovative Lösungen schafft.
1Mit Synthese ist hier nicht die Konstruktion einer „Über-Religion“ etwa durch ein synkretistisches religiöses System gemeint, sondern eher der Zusammenbau oder die Zusammenschau einzelner Bausteine säkularer und religiöser – konkret jüdischer, christlicher und islamischer – Provenienz gemeint.
Teil 1: Transsäkulare und transreligiöse Friedensethik
Gertrud Brücher (2002:159) hat vorgeschlagen, die unterschiedliche säkulare und religiöse Sicht als „Generaloptik durch Ein- oder Ausschluss des Immanenz/Transzendenz-Schemas“ zu definieren. Doch trifft das zu? So kann auf der einen Seite auch eine säkulare Sicht eine immanente Transzendenz beinhalten, nur dass diese nicht auf ein Jenseits ausgerichtet sein muss, sondern auch auf ein diesseitiges Kollektiv hin orientiert sein kann, wie etwa im Marxismus auf die „Arbeiterklasse“ oder in einer republikanischen Vision auf „das Volk“. Umgekehrt gibt es nicht wenige religiöse Sichtweisen, welche das Diesseits ins Zentrum stellen – etwa die klassische jüdische Sicht oder auch befreiungstheologische Strömungen im Christentum.
Der Säkularismusbegriff gewinnt dann seine Schärfe, wenn es um die Begründungsstruktur geht: Religiöse Ethiken nehmen in der Regel Bezug auf eine ausserhalb des Menschen gedachte oder vorgestellte und kommunizierte Heilsstruktur, während säkulare Ethiken vom Axiom der Eigenverantwortlichkeit und Autonomie des Menschen ausgehen. Die Unterscheidung verläuft also weniger zwischen Transzendenz und Immanenz, sondern eher zwischen Heteronomie und Autonomie des Menschen. Historisch bezeichnet der Begriff des Säkularismus auch die Entflechtung von religiösen und weltlichen Machtstrukturen, weshalb der Säkularismus immer auch eine religionskritische Dimension hatte oder gar zu einer Art „nicht-religiöser Quasi-Religion“ (vgl. Jäggi und Krieger 1991:138ff. sowie 143ff.) wurde, also zu einer mit den Religionen konkurrierenden Weltanschauung. Entsprechend schwang und schwingt bei allen „legitimen und illegitimen“ Kindern der Aufklärung – also vom Humanismus über den Liberalismus bis zum Marxismus – eine religions- oder besser theokratiekritische Denkweise mit.
Interessant ist in diesem Zusammenhang der Ansatz des iranischen Theologen Mujhahid Shabestari (z.B. 2012:196ff.), der – so Vahdat 2015:166 – versuchte, göttliche und menschliche Subjektivität zu versöhnen (vgl. auch Jäggi 2021a:38).
Dabei ist zu bedenken, dass religiöse Zugänge zu ethischen Überlegungen oft andere sind als Zugänge säkularer, also nicht religiöser Ethik. Dagmar Fenner (2016:62) hat das wie folgt formuliert: „Typisch für den hermeneutisch-verstehensorientierten Zugang religiöser Ethik sind Erzählungen, denen in vielen Religionen eine entscheidende Rolle für die Heranbildung und Festigung des religiösen Ethos zukommt. Religiöse Moral und Ethik sind statt begründungsorientiert wesentlich narrativ, also erzählend. Sie manifestieren sich in den von Generation zu Generation weitergegebenen rituellen Zeremonien, erzählten oder inszenierten Geschichten, Gleichnissen und Bildern. Im Unterschied zu einem nüchternen, möglichst knappen und präzisen Argumentationsstil philosophischer Ethik fehlt religiösen Texten zu ethischen Themen ein systematischer Aufbau …“ (Fenner 2016:62). Doch diese Tatsache hat auch einen entscheidenden Vorteil: Narrative Texte sprechen im Unterschied zu logisch-rationaler Argumentation besonders das Gefühl und die Empathie an, die oft tiefer gehen und nachhaltiger wirken als logisch-vernunftmässige Begründungen – die übrigens nicht selten nachträgliche Rationalisierungen spontan entschiedener Gefühlsentscheide darstellen.
Umgekehrt kann eine Ausschaltung vernunftmässiger Reflexion auch zu Fehlentscheidungen führen, wie man etwa aus der Vorurteils- und Stereotypieforschung kennt. Deshalb ist wohl – wie oft – die Kombination von beidem optimal: narrative und gefühlsbezogene Geschichten und rationale Reflexion der entsprechenden Texte, und zwar immer im Sinne und vor dem Hintergrund autonomer Moral.
Jedoch soll damit nicht einer blinden Gefühlsethik (vgl. Fenner 2016:64) das Wort geredet werden, welche „gute“ oder „richtige“ Entscheide nur auf ein allgemeines Gefühl – etwa ein vages „Wohlwollen“, „Mitleid“ oder „Güte“ – zurückführen wollen und dieses als „Quelle und Gradmesser von Moralität“ (Fenner 2016:64) sehen. Positive Gefühle sind zweifellos wichtige Träger von moralischen Handlungen, aber sie helfen oft in konkreten Situationen, etwa in ethischen Dilemmata, nicht weiter.
Das grosse Problem glaubensgestützter Ethiken besteht darin, dass die Unterscheidung von grundlegenden ethisch-moralischen Prinzipien und situativ-praktischen Normen oft nur schwer zu machen ist – insbesondere, wenn die Gläubigen die gesamte Schrift wortwörtlich nehmen, ohne daran zu denken, dass – gerade narrative Texte – oft metaphorisch gemeint sind und Meta-Aussagen enthalten, die weit über die anwendungsorientierte, direkte Übertragung einer religiösen Aussage hinaus gehen. Diese Problematik kann auf der einen Seite zu religiösem Fundamentalismus und auf der anderen Seite zu einem religiösen Relativismus führen (vgl. dazu auch Fenner 2016:71).
Franz Segbers (1999:71) hat die Forderung aufgestellt, dass christliche Ethik einen doppelten Anspruch habe: Sie wolle einerseits Christen in ihrer theologisch-ethischen Handlungsorientierung unterstützen und anderseits einen Beitrag für den übergreifenden gesellschaftlichen Diskurs leisten. Das gilt im Grunde für jede religions- oder weltanschauungsbasierte Ethik 2.
Читать дальше