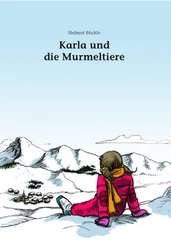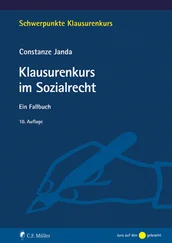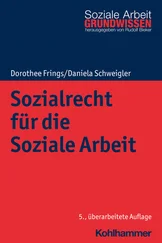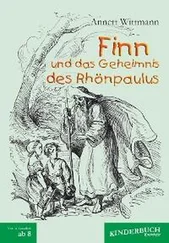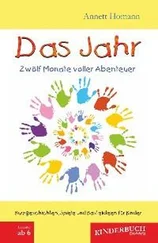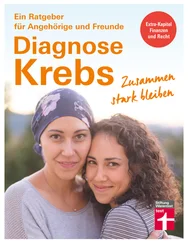Im Rahmen der Arbeitslosenversicherung gab es bis 2004 neben den weiterhin bestehenden Leistungen in Form von Arbeitslosengeld die Leistungen der Arbeitslosenhilfe. Beide Leistungen waren abhängig von vorherigen Beitragszahlungen, und die Höhe der Leistungen richtete sich danach, in welcher Höhe vorher Beiträge gezahlt wurden. Außerdem war die Dauer der Leistungsgewährung zeitlich befristet. Die Arbeitslosenhilfe war geringer als das Arbeitslosengeld und reichte häufig nicht aus, um den Lebensunterhalt der Empfänger und ihrer Familien zu decken, sodass zusätzlich Sozialhilfeleistungen erbracht wurden. Mit der Einführung der Sozialgesetzbücher II und XII zum 01.01.2005 wollte der Gesetzgeber erreichen, dass die o. g. Fälle, in denen zusätzlich zur Arbeitslosenhilfe noch Sozialhilfe gezahlt wird, nicht mehr vorkommen. Die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft. Nun gibt es bedarfsdeckende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II und dem SGB XII. Grob gesagt erhalten Personen, die erwerbsfähig sind oder mit erwerbsfähigen Personen zusammenleben, Leistungen nach dem SGB II und nicht erwerbsfähige Personen Leistungen nach dem SGB XII. Die private soziale Sicherung umfasst z. B. die eigene Vorsorge durch Vermögensbildung und den Abschluss privater (Zusatz-)Versicherungen gegen Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Berufsunfähigkeit o. Ä., die Vorsorge durch Arbeitgeber in Form von betrieblicher Altersvorsorge sowie freiwillige Leistungen durch Verwandte, Freunde, Kirchen usw.
1.3Bedeutung und Aufbau des Sozialgesetzbuchs 1.3BEDEUTUNG UND AUFBAU DES SOZIALGESETZBUCHS 1.3.1Zielsetzung und Entwicklung des SGB Die Bundesrepublik Deutschland hat sich zum Sozialstaatsprinzip bekannt und dies verfassungsrechtlich verankert und verfassungsrechtlich vor Änderungen geschützt. Eine konkrete Ausformulierung des Prinzips ist in der Verfassung nicht zu finden. Mit dem Verzicht, dieses Prinzip auszuformulieren und somit als starres Prinzip einzuführen, lässt man Spielraum und Gelegenheit, auf die gesellschaftliche Entwicklung reagieren zu können. Die Gesetzgeber können dieses Prinzip konkret ausformulieren. Für die Umsetzung des Sozialstaatsprinzips wurden viele soziale Gesetze geschaffen, die zur sozialen Absicherung dienen und den sozialen Ausgleich wahren sollen. Mit der Schaffung eines Sozialgesetzbuchs soll die Vielzahl der Einzelgesetze vereinheitlicht werden und die Durchführung des Verwaltungsverfahrens gemeinsamen gesetzlichen Regelungen unterworfen werden. Seit den 70er-Jahren wird daran gearbeitet, die unterschiedlichen Sozialgesetzbücher in einem Sozialgesetzbuch zu vereinheitlichen. Der Bürger soll Rechtsansprüche einfacher erkennen und somit Vertrauen in den sozialen Rechtsstaat erlangen. Der ausführenden und der Recht sprechenden Gewalt soll die Zusammenführung der sozialrechtlichen Einzelgesetze in ein einheitliches Buch die Verwaltungsarbeit erleichtern, eine einheitliche Rechtsanwendung der verschiedenen Institutionen ermöglichen und die Rechtsprechung erleichtern. Durch einheitliche Verwaltung und einheitliche Rechtsprechung soll das Ziel der Rechtssicherheit erreicht werden.
1.3.1Zielsetzung und Entwicklung des SGB
1.3.2Überblick über die SGB I–XII
1.3.3Besondere Teile des SGB im Überblick
1.3.4Anwendung des SGB I und SGB X im Bereich der sozialen Sicherung
1.3.5Allgemeine Grundsätze des Leistungsrechts
1.3.6Mitwirkungspflichten (§§ 60–67 SGB I)
2SYSTEMATIK UND GRUNDSÄTZE DES SGB II UND DES SGB XII
2.1SGB II
2.1.1Rechtsgrundlagen, Aufgabe und Inhalt der Grundsicherung für Arbeitsuchende
2.1.1.1Rechtsgrundlagen
2.1.1.2Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 1 SGB II)
2.1.1.3Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 4 SGB II)
2.1.1.4Grundsätze der Leistungsgewährung
2.2SGB XII
2.2.1Rechtsgrundlagen, Aufgabe und Inhalt der Sozialhilfe
2.2.1.1Rechtsgrundlagen
2.2.1.2Aufgabe und Ziel der Sozialhilfe (§ 1 SGB XII)
2.2.1.3Leistungen der Sozialhilfe (§ 8 SGB XII)
2.2.1.4Grundsätze der Leistungsgewährung
2.3Vorrangige Leistungen im Überblick
2.3.1Leistungen der Rentenversicherung nach SGB VI
2.3.2Leistungen der Krankenversicherung nach SGB V
2.3.3Leistungen der Pflegeversicherung nach SGB XI
2.3.4Wohngeld
2.3.5Kindergeld und Kinderzuschlag
2.3.6Unterhaltsvorschussleistungen
2.3.7Elterngeld
2.3.8Arbeitslosengeld nach SGB III
2.3.9BAföG/BAB/AbG
2.3.10Kurzarbeitergeld
2.4Leistungsträger
2.4.1SGB II
2.4.1.1Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 6 SGB II)
2.4.1.2Besonderheit zugelassener kommunaler Träger (§ 6a SGB II)
2.4.2SGB XII
2.4.2.1Örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe (§ 3 SGB XII)
2.4.2.2Überblick über die Zuständigkeiten
ZWEITER TEIL GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSUCHENDE NACH DEM SGB II
3ABGRENZUNG DER LEISTUNGSBERECHTIGTEN PERSONEN NACH SGB II UND SGB XII
3.1Überblick und Entstehung der drei Existenzsichernden Leistungen
3.2Leistungen nach mem SGB II – Leistungsberechtigte (§ 7 SGB II)
3.2.1Arbeitslosengeld II
3.2.2Sozialgeld
3.3Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) – Leistungsberechtigte
3.4Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII – Leistungsberechtigte
3.5Abgrenzung der Bereiche – Prüfschema
3.5.1Merksätze zur Abgrenzung der Leistungen
3.5.2Übungsfälle zur Abgrenzung der Bereiche
4LEISTUNGEN ZUR SICHERUNG DES LEBENSUNTERHALTS IM SGB II
4.1Antrag/Bedarfszeitraum/Berechnung der Leistung bzw. Abgrenzung der Leistungsbereiche
4.1.1Antragserfordernis (37 Abs. 1 SGB II)
4.1.2Leistungsbeginn/Berücksichtigung von Schulden (§ 37 Abs. 2 SGB II)
4.1.3Berechnung der Leistung/Bedarfszeitraum (§ 41 SGB II)
4.1.4Zuständigkeit (§§ 6, 6a, 6d SGB II, § 36 SGB II)
4.1.5Abgrenzung der Leistungsbereiche im SGB II – Markt und Integration und Leistungsabteilung
4.2Anspruchsberechtigter Personenkreis (§ 7 Abs. 1 Satz 1 SGB II)
4.2.1Altersbeschränkung (§ 7a SGB II)
4.2.2Erwerbsfähigkeit (§ 8 SGB II)
4.2.3Hilfebedürftigkeit (§ 9 SGB II)
4.2.4Gewöhnlicher Aufenthalt (§ 30 Abs. 3 SGB I)
4.2.5Ausschlusstatbestände (§ 7 Abs. 1, 4–6 SGB II)
4.2.5.1Ausländerinnen und Ausländer (§ 7 Abs. 1 Satz 2 SGB II)
4.2.5.2Stationärer Aufenthalt (§ 7 Abs. 4 SGB II)
4.2.5.3Altersrente (§ 7 Abs. 4 SGB II)
4.2.5.4Ortsabwesenheit (§ 7 Abs. 4a SGB II)
4.2.5.5Auszubildende (§ 7 Abs. 5 SGB II)
4.2.6Anspruchsberechtigter Personenkreis Sozialgeld
4.2.7Abgrenzungen zu Leistungen SGB XII/Prüfschema
4.2.8Übungsfälle
4.3Bedarfsgemeinschaft (§ 7 Abs. 3 SGB II)
4.3.1Definition Bedarfsgemeinschaft – Personenkreis
4.3.2Abgrenzung zur Haushaltsgemeinschaft
4.3.3Mischfälle/Mischbedarfsgemeinschaften
4.3.4Vertretung der Bedarfsgemeinschaft (§ 38 SGB II)
4.3.5Übungsfälle zur Bildung einer Bedarfsgemeinschaft
4.4Leistungsspektrum, Bedarfe
4.4.1Bedarfsdeckungsprinzip – Existenzminimum
4.4.2Überblick Bedarfsspektrum
4.4.3Regelbedarf (§ 20 SGB II)
4.4.4Mehrbedarfe (§ 21 SGB II)
4.4.4.1Mehrbedarf für werdende Mütter (§ 21 Abs. 2 SGB II)
4.4.4.2Mehrbedarf für Alleinerziehende (§ 21 Abs. 3 SGB II)
4.4.4.3Mehrbedarf für behinderte Menschen (§ 21 Abs. 4 SGB II)
4.4.4.4Mehrbedarf für kostenaufwendige Ernährung (§ 21 Abs. 5 SGB II)
4.4.4.5Mehrbedarf für besondere Bedarfe (§ 22 Abs. 6 SGB II)
4.4.4.6Mehrbedarf für Anschaffung von Schulbüchern
4.4.4.7Mehrbedarf für dezentrale Warmwasseraufbereitung (§ 22 Abs. 7 SGB II)
Читать дальше