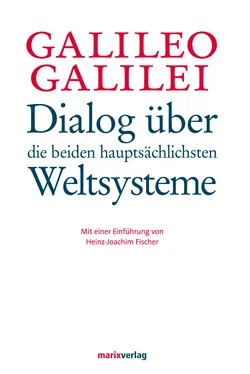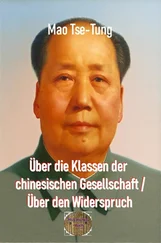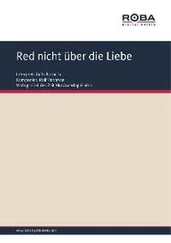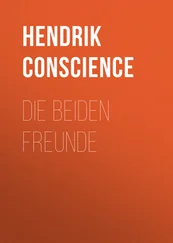Galileio Galilei - Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme
Здесь есть возможность читать онлайн «Galileio Galilei - Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Auch die im Dialog enthaltene Polemik gegen Scheiners Disquisitiones scheint erst spät, wahrscheinlich im Jahre 1629 niedergeschrieben worden zu sein. Denn ohne besonderen Anlass würde G. dem herzlich unbedeutenden Büchlein, das schon 1614 erschienen war und keineswegs großes Aufsehen erregt hatte, schwerlich solche Aufmerksamkeit gewidmet haben. Ein solcher Anlass lag aber für ihn doch wohl erst vor, als er im Jahre 1629 hörte, dass Scheiner ein großes Werk über die Sonnenflecken, die Rosa Ursina , drucken lasse. 118Es steht zwar nicht fest, wieviel Galilei von dem polemischen und sachlichen Inhalt der Rosa vor ihrem Erscheinen wusste, aber dass Angriffe gegen ihn und gegen seine Prioritätsansprüche auf die Sonnenfleckenentdeckung zu erwarten waren, konnte nicht zweifelhaft sein. So versuchte denn Galilei dem Gegner im Dialog zuvorzukommen und dazu bot sich kein besserer Anlass als eine Besprechung des Werkchens, das u. a. auch die kopernikanische Lehre bekämpfte. Eine Anspielung auf die 1630 vollendete Rosa Ursina findet sich hingegen nicht im Dialog. Da nun Galilei, wäre ihm Scheiners Werk bekannt gewesen, den triftigsten Grund gehabt hätte, auf den von ihm vorausgesagten Umschwung in den Ansichten Scheiners, der zwar teilweise schon in den letzten Briefen an Welser, mit voller Deutlichkeit aber erst in der Rosa sich dokumentiert, triumphierend hinzuweisen, so haben wir anzunehmen, dass der 1632 veröffentlichte, aber schon im Mai 1630 druckfertig gewordene Dialog an den auf Sch. bezüglichen Stellen seit 1630 keine Änderung mehr erfuhr. Das Erscheinen der Rosa Ursina rechtfertigte die Erwartungen Galileis und seiner Freunde; sie brachte wirklich eine äußerst erbitterte Polemik, deren Ausgangspunkt die Stelle in der Einleitung des Saggiatore bildet 119, wo sich Galilei beklagt hatte, dass ihm andere den Ruhm der Sonnenfleckenentdeckung streitig machten. Ein ganzes äußerst weitschweifiges und langweiliges Buch des dickleibigen Folianten ist mit dieser Polemik angefüllt. Was die Prioritätsfrage betrifft, so sind Scheiners Ansprüche Galilei gegenüber, wie oben bemerkt, zwar nicht berechtigt, sie können aber, obgleich dies nicht wahrscheinlich ist, bona fide erhoben sein; in der Veröffentlichung durch den Druck ist ja Sch. unzweifelhaft Galilei zuvorgekommen, während Fabricius ihnen beiden voranging. Hingegen spricht Sch. nirgends davon, dass seine seit 1612 völlig veränderten Anschauungen über die Natur der Sonnenflecken nur durch die Auseinandersetzungen Galileis in den Lettere intorno alle macchie solari veranlasst sind, und dieses Schweigen ist es, was auch die Aufrichtigkeit seiner übrigen, zum Teil unkontrollierbaren Behauptungen verdächtig erscheinen lässt. Andererseits ist aber in der Rosa viel sachlich Neues und Richtiges enthalten, vor allem die genauere Festlegung des Sonnenäquators und die damit zusammenhängende Erkenntnis von der periodischen Formveränderung der scheinbaren Fleckenbahnen; aber auch sonst eine Menge auf die Flecken bezüglichen dankenswertesten Details, das zum Teil in unserer Zeit neu entdeckt werden musste, da es in Vergessenheit geraten war. Nun findet sich auch im Dialog, der zwei Jahre nach der Rosa erschien, die Neigung der Sonnenachse gegen die Ekliptik nebst den daraus fließenden Folgerungen erörtert 120, und zwar in einer Weise, die offenbar dartun soll, Galilei habe schon vor 1614 von dieser Tatsache Kenntnis gehabt. Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Darstellung sehr auffällig ist 121und mindestens den Schein gegen sich hatte. Die Empfindungen Scheiners, als ihm der Dialog zuerst zu Gesichte kam, sind daher nicht ganz unerklärlich: Die vernichtende Kritik der Disquisitiones und gleichzeitig der scheinbare Raub an der Rosa versetzten ihn und das ganze jesuitische Lager in grenzenlose Wut, die nur umso gefährlicher war, weil sie sich zunächst nicht literarisch austobte.
Das Erscheinen des Dialogs schob sich infolge einer Menge von äußeren Schwierigkeiten lange hinaus. Am 24. Dezember 1629 hatte Galilei an Cesi geschrieben, er sei im Wesentlichen fertig, er habe fast nur noch die Verbindungsglieder zwischen die einzelnen Erörterungen einzuschieben und die Einleitung abzufassen. Gleichzeitig spricht er die Absicht aus, nach Rom zu kommen, um den Druck, der aus den gleichen Gründen wie beim Saggiatore dort stattfinden sollte, selbst zu überwachen. Am 12. Januar 1630 schreibt er an Marsili, er sei mit der Revision des Manuskripts beschäftigt; am 16. Februar teilt er ihm mit, dass er Ende des Monats nach Rom abzureisen gedenke. Die Aussichten auf die Erlangung der Druckerlaubnis schienen günstig zu sein, da einerseits Galileis einflussreicher Freund und Fürsprecher Ciampoli den Papst zu gewinnen suchte, andererseits seit 1629 derselbeR i c c a r d ials Magister Sacri Palatii an der Spitze der römischen Zensur stand, der das Imprimatur für den Saggiatore in so schmeichelhaften Ausdrücken abgefasst hatte. Vor allem sah Castelli, der sich inzwischen in Rom niedergelassen hatte, die Dinge im rosigsten Lichte und hoffte, dass sich auch die letzte Schwierigkeit durch Galileis persönliche Anwesenheit in Rom beseitigen lasse.
Die Abreise Galileis verschob sich indessen bis zum Beginne des Mai. In Rom angekommen, wurde er wiederum vom Papste huldvoll empfangen. Auch Riccardi, dem das Manuskript übergeben wurde, machte anfänglich keine erheblichen Schwierigkeiten; er meinte zwar, die hypothetische Auffassung der kopernikanischen Lehre im Dialog sei nicht dieselbe, welche bei der Korrektur des Buches von Kopernikus im Jahre 1620 für die Index-kongregation maßgebend gewesen sei, aber er hielt es für möglich, durch Beifügung einer geeigneten Einleitung und Schlussbetrachtung und durch Korrekturen im Einzelnen das Werk auf diesen hypothetischen Standpunkt zu bringen. Zu diesem Behufe wurde die Korrektur des Dialogs dem Dominikanerpater Raffaello Visconti, dem sachverständigen Kollegen Riccardis, aufgetragen. Nachdem dieser die notwendig scheinenden Änderungen vorgenommen und seine Approbation ausgesprochen hatte, welche noch der Bestätigung von seiten des Magister Sacri Palatii bedurfte, versprach Riccardi den Papst zu Gunsten Galileis zu stimmen. Der Widerstand des Papstes war hauptsächlich gegen die Zurückführung der Gezeiten auf die Erdbewegung gerichtet; er hatte dafür nämlich eine eigene Theorie, er meinte, man dürfe die göttliche Allmacht nicht beschränken wollen, es müsse für Gott auch auf anderem Wege als auf dem von Galilei gelehrten möglich sein, jene Erscheinungen hervorzurufen. Galilei musste sich darum vor allem dazu verstehen, den beabsichtigten Titel des Buches, der Ebbe und Flut ausdrücklich erwähnte, abzuändern. Abgesehen davon, so meinte Riccardi, werde es sich nunmehr nur um Kleinigkeiten handeln. Um indessen schon jetzt wegen des Drucks mit einem Verleger verhandeln zu können, bemühte sich G. mit Erfolg, dass Riccardi die formelle Approbation für den Druck in Rom ausstellte, mit der Klausel freilich, dass jeder Bogen noch einer Durchsicht unterworfen werden sollte, ehe er der Presse übergeben würde; außerdem wurde die Vorrede skizziert, die in ihrer fertigen Gestalt zwar als ein Werk Galileis zu gelten hat, die aber den Weisungen Riccardis in dem, was sie ausspricht, und noch mehr in dem, was sie verschweigt, durchweg Rechnung trägt. Mitte Juni kehrte Galilei nach Florenz zurück, nachdem die Verabredung getroffen worden war, Galilei solle dort Widmung, Register u. s. w. fertig stellen und im Herbste sich nochmals in Rom einfinden.
Inzwischen aber hatten die Verhältnisse sich in der Weise geändert, dass es Galilei wünschenswert erschien, sein Buch in Florenz statt in Rom drucken zu lassen. Angeblich und zum Teil auch wirklich war es die mittlerweile ausgebrochene, allen Verkehr zwischen Florenz und Rom erschwerende Pest, welche die Übersendung des Manuskripts oder gar eine abermalige Reise Galileis verhinderte. Noch mehr aber mag der Tod des allezeit für Galilei tätig gewesenen Fürsten Cesi, des Begründers der Accademia dei Lincei, sowie die in Rom beginnende Verfolgung der Astrologen, mit welchen die Astronomen vielfach in einen Topf geworfen wurden, zu jenem Entschlusse beigetragen haben. Dadurch aber entstanden fernere Weiterungen. Galilei fand zwar in Landini mit Leichtigkeit einen florentinischen Verleger, auch die Approbation der geistlichen und weltlichen Zensur für Florenz scheint ohne Schwierigkeit erlangt worden zu sein; denn bereits am 11. September 1630 erteilten der Generalvikar des Erzbischofs von Florenz, Pietro Nicolino, und der Generalinquisitor von Florenz, Clemente Egidio, am Tage darauf auch der großherzogliche Zensor Niccolò Antella das Imprimatur. 122Galilei und sein Verleger wären damit rechtlich befugt gewesen, den Druck in Florenz vorzunehmen. Indessen schien es rücksichtsvoller und sicherer, von dem veränderten Vorhaben dem römischen Oberzensor, der sich so eingehend mit der Sache beschäftigt hatte, Kenntnis zu geben; ein zwingender Grund zu diesem Verhalten lag aber durchaus nicht vor, und die Folge lehrte, dass eine solche Rücksicht im Interesse Riccardis besser unterblieben wäre. Wenn Riccardi jetzt streng korrekt verfahren wollte, musste er es ablehnen, sich mit der Zensur eines in Florenz erscheinenden Buches zu befassen; es fehlte ihm dazu an jeder Kompetenz; dass Galilei anfänglich das Werk in Rom wollte drucken lassen, konnte ihm doch unmöglich eine solche verleihen. Ging er also gleichwohl auf Unterhandlungen ein, so konnte dabei nur die Absicht ausschlaggebend sein, durch Abdruck seiner besonders wertvollen Anerkennung der Ungefährlichkeit des Buches diesem den Weg zu erleichtern. Es ist daher schwer begreiflich, wie man aus dem Abdruck dieser Approbation Galilei später einen Vorwurf machen konnte, wiewohl man ja zugeben muss, dass dieselbe rechtlich wertlos war. 123Irrig ist es also, wenn man sagt, Galilei sei nicht befugt gewesen, das Imprimatur Riccardis dem Dialog beizufügen; vielmehr war Riccardi nicht befugt, den Druck in Florenz zu begutachten. Wenn er dies dennoch tat, und wenn der römische Oberzensor das Zensurrecht selbst nicht kannte oder es nicht strenge handhabte, so brauchte Galilei gewiss nicht ihn an Korrektheit zu überbieten. Riccardi also lehnte die Einmischung in die Sache nicht ab, sondern stellte verschiedene Forderungen auf; namentlich handelte es sich um Einleitung und Schluss, die nochmals zur Begutachtung nach Rom geschickt werden mussten. Im Übrigen wurde nach etlichem Hin- und Widerreden auf Verwendung Nicolinis, des großherzoglichen Gesandten in Rom, und seiner Gattin Caterina die erneute Durchsicht des Dialogs dem Dominikanerpater Giacinto Stefani übertragen. Gab dieser seine Zustimmung und war der Padre Maestro mit Einleitung und Schluss zufrieden, so trat damit, vom Standpunkte Galileis betrachtet, das schon früher erteilte Imprimatur des römischen Oberzensors in Kraft. Denn an Stelle der oben erwähnten Klausel, von welcher die Gültigkeit des römischen Imprimatur abhängig gemacht worden war, trat nunmehr die Approbation Stefanis und die Billigung von Vorrede und Schluss durch den Magister Sacri Palatii. Was konnten alle diese Förmlichkeiten, die an und für sich überflüssig waren, anderes bedeuten, als dass durch ihre Erfüllung Galilei das Recht erhielt, auch die Druckerlaubnis Riccardis dem Dialoge beizufügen? Trostlos ist es freilich, die Konfusion des armen Paters zu sehen, der in einer Zeile schreibt, er sei nicht kompetent, die Druckerlaubnis zu erteilen und gleichwohl in der nächsten verspricht, ein Zeugnis darüber auszustellen, dass er das Buch approbiere, wofern er nur Einleitung und Schluss zugeschickt erhalte 124; dabei hatte er diese Stücke auf seinen Wunsch mindestens seit einem Vierteljahre in Händen. 125Am 24. Mai 1631 endlich setzte sich Riccardi in Verbindung mit dem florentinischen Inquisitor Clemente Egidio, der in Wahrheit schon vor drei Vierteljahren das Imprimatur erteilt hatte. Er schreibt 126: »Da der Verfasser dort [in Florenz] die Sache zu erledigen wünscht, so kann Euer Hochwürden von Ihrer Autorität Gebrauch machen und das Buch unabhängig von meiner Revision approbieren oder nicht approbieren; wobei ich jedoch in Erinnerung bringe, dass es die Meinung unseres Herrn [des Papstes] ist, dass als Titel und Gegenstand des Buches nicht Ebbe und Flut gelten soll, sondern unbedingt nur die mathematische Erörterung der kopernikanischen Lehre von der Erdbewegung; diese soll den Zweck haben zu beweisen, dass abgesehen von der göttlichen Offenbarung und der Kirchenlehre die Erscheinungen von jenem Standpunkte aus sich erklären lassen, unter Widerlegung aller gegenteiligen Überzeugungen, welche die Erfahrung und die peripatetische Philosophie an die Hand geben: in der Art, dass niemals jener Meinung die absolute Wahrheit, sondern nur die hypothetische, und zwar ohne Bezugnahme auf die Heilige Schrift, zugestanden werden darf. Auch muss darauf hingewiesen werden, dass das Buch bloß geschrieben wird, um zu zeigen, dass man alle Gründe kenne, die für diesen Standpunkt sich anführen lassen, und dass man nicht aus mangelnder Kenntnis derselben diese Ansicht verurteilt habe, entsprechend dem Anfang und Schluss des Buches, welche ich später korrigiert übersenden werde. Unter diesen Vorsichtsmaßregeln wird dem Buche hier in Rom niemand etwas in den Weg legen.«
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.