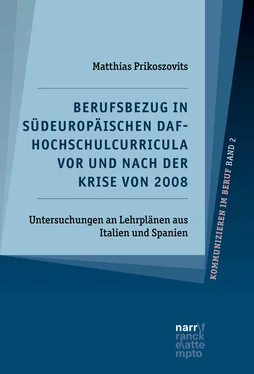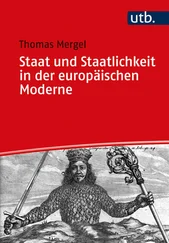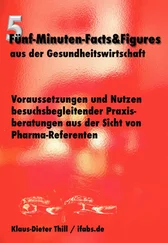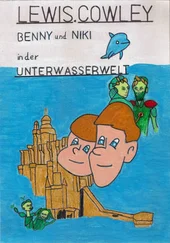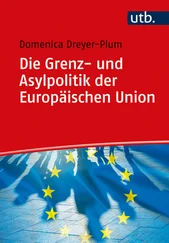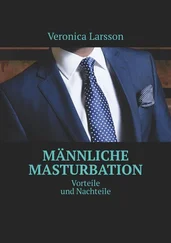Doyé (1995, S. 161) unterscheidet zwischen von Individuen selbst gesteckten Lern zielen und Lehr zielen, die Menschen bei der Lenkung von Lernprozessen anderer zu erreichen suchen. Laut Neuner (2001, S. 805) wird allerdings häufig nicht zwischen Lehrzielen, die er als durch „[…] Bildungsinstanzen […]“ verankert beschreibt, und Lernzielen, die eine „[…] Analyse pragmatischer Bedürfnisse der Fremdsprachenverwendung […]“ als Basis hätten bzw. von Lernenden selbst entworfen würden, unterschieden. Krumm (2007, S. 116) plädiert dort, wo Lernende eine Sprache nicht aus freiem Willen lernen, für den Terminus Lehrziele. Im außerschulischen FSU, in den Lernende häufig eigene Interessen und Vorstellungen mitbringen, sollte eher von Lernzielen die Rede sein.
In diesem universitären Lehrplänen verpflichteten Band wird fortan entweder der Dualismus „Lehr-/Lernziele“ zur Gänze ausgeschrieben, oder es ist generell von „Zielen“, „unterrichtlichen Zielen“ oder „Unterrichtszielen“ die Rede, womit dann sowohl Lehr- als auch Lernziele gemeint sind. In Zitaten wird die darin verwendete Terminologie beibehalten.
Projektarbeiten haben Strategien zur curricularen Zielfindung und -explizierung hervorgebracht (s. Zimmermann, 1995, S. 136), dazu zählen etwa Befragungen, in berufsbezogenen Kontexten jedoch auch Analysen des Sprachbedarfs an verschiedenen Arbeitsplätzen. Die Auseinandersetzung mit den Mitteln einer gezielt lernerorientierten Curriculumentwicklung beschreibt Neuner (2001, S. 806) Anfang des neuen Jahrtausends in der Fachforschung allerdings immer noch als verhältnismäßig neu. Er rückt diese in die Nähe der Entwicklung der Kommunikativen Fremdsprachendidaktik seit Mitte der 1970er Jahre.
Die Curriculumforschung der letzten 30 Jahre (Doyé 1995, S. 165), also ab den 1960er Jahren, habe sich um die Entwicklung von Methoden zur Zielfindung bemüht. Ab den 2000er Jahren ist hierfür auch der GER ein fundamentales Instrument. Doyé stellt sodann die von Robinsohn initiierte dreiteilige Zielfindung vor, die den Auftakt der Beschreibungen der Ansätze zur Zielfindung im kommenden Kapitelabschnitt bildet.
Robinsohn (1971, S. 31) spricht in diesem Kontext auch von einer „Vorbereitung von Curriculumentscheidungen“. Seinen Überlegungen liegt zugrunde, dass Bildungsreformen in engem Zusammenhang mit Curriculumentwicklung und -forschung stehen müssen. Dabei geht er von einer laufenden Revisionsbedürftigkeit der „[…] Bildungsziele […]“ und „[…] Bildungsinhalte […]“ aus, der die Didaktik etwa anhand der Entwicklung geeigneter Revisionsinstrumente noch in keiner adäquaten Form begegnet ist. Er wirft die Frage auf, wie solche Instrumente aussehen sollten und wie sie erarbeitet werden sollten. Im Folgenden werden solche teils älteren, teils jüngeren Instrumente vorgestellt und hinsichtlich ihres Potenzials für das Auffinden berufsbezogener Lehr- und Lernziele diskutiert.
2.5.1 Lebenssituationen – Qualifikationen – Bildungsinhalte
Gemäß Robinsohn (1971, S. 45) erfordert Bildung, die auf künftige Lebenswirklichkeiten vorbereiten soll, ein dreistufiges Planungsvorgehen. Es müssen dabei zunächst für Lernende relevante „Situationen“ fokussiert werden, dann „Qualifikationen“, die zur Bewältigung dieser Situationen benötigt werden, und schließlich „Bildungsinhalte“ und „Gegenstände“, die diese Qualifizierungen zur Folge haben sollen.
Zimmermann (1995) führt dazu mit Blick auf den FSU aus:
Das Modell hat auch erheblichen Einfluss auf die Curriculumentwicklung der Fremdsprachenfächer gehabt. Schon sehr bald wurden allerdings seine Grenzen deutlich, insbesondere die Schwierigkeit, künftige Situationen überhaupt und besonders angesichts des raschen gesellschaftlichen und ökonomischen Wandels zu diagnostizieren und außerdem eine stringente Deduktion von Qualifikationen, Zielen/Inhalten1 und der Unterrichtsorganisation aus Lebenssituationen vorzunehmen. Selbst wenn eine solche Ableitung möglich wäre, ist sie schwerlich in Einklang zu bringen mit emanzipatorischen und Selbststeuerungszielsetzungen von Schule. (S. 136)
Robinsohn nennt seinen Ansatz „Strukturkonzept für Curriculumentwicklung“ und erläutert im Vorwort zur dritten Auflage seiner Schrift (1971, S. IX), dass dieses Strukturkonzept bei der ersten Auflage 1967 noch nicht berücksichtigt, sondern erst im Sommer 1969 ergänzt wurde.
Die drei Planungsvariablen Lebenssituationen, Qualifikationen und Bildungsinhalte sind insbesondere bei der Erstellung berufsbezogener Lehrpläne für den FSU mit Bedacht einzusetzen. Wenn es generell schon als schwierig bzw. unmöglich gilt, bei der Unterrichtsplanung künftig notwendige Qualifikationen und relevante Bildungsinhalte vorauszusehen, um Lernende bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten, so ist diese Unmöglichkeit bei der Erarbeitung berufsbezogener Lehrpläne als noch problematischer einzustufen, da sich die Arbeitswelt nicht zuletzt wegen rapider technologischer Entwicklungen und der damit einhergehenden Schaffung neuer Berufsfelder laufend wandelt bzw. ständig im Umbruch ist. Somit sind in der Berufswelt auch kommunikative Anforderungen ebenso wie fremdsprachliche kommunikative Anforderungen einem unentwegten Wandel unterworfen. Kuhn (2007) widmet ein gesamtes Kapitel ihrer Dissertation den kommunikativen Anforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt (Abschnitt 3.1), was zum einen zeigt, als wie wesentlich sich Kommunikation in der Arbeitswelt erweist, und zum anderen verdeutlicht, wie sehr der beständige Wandel der Arbeitswelt Arbeitnehmer herausfordert.
Schmidt beschäftigt sich 2010 (S. 923) jedoch immer noch mit diesen drei Variablen der Curriculumplanung. Er schreibt in diesem Zusammenhang von Robinsohns Programm zur Ermittlung von Inhalten, welches „[…] durch die Aneignung von Kenntnissen, Einsichten, Haltungen und Fertigkeiten […]“ (Robinsohn, 1971, S. 45) vor allem für die „[…] Bewältigung von Lebenssituationen […]“ (ebd., S. 45) qualifizieren soll.
Vorerst ist jedoch festzustellen, dass die Trias Lebenssituationen, Qualifikationen und Bildungsinhalte zwar ein langjährig eingesetztes und auch überwiegend bewährtes, wenn auch immer wieder kritisiertes Instrument für die Curriculumentwicklung darstellt, für die Erstellung berufsorientierter DaF-Lehrpläne jedoch als nur bedingt erfolgversprechend angesehen werden kann, da sich die kommunikativen Anforderungen insbesondere in der Berufswelt in ständigem Wandel befinden. Das zu Überwindende an diesem Ansatz scheint die stark situationsorientierte Basis zu sein. Dem hält Doyé (1995) entgegen:
Gegen Robinsohns Strukturkonzept ist immer wieder eingewendet worden, dass der von ihm vorgeschlagene, anscheinend so rationale Weg eine unsichere Ausgangsposition habe, weil die Situationen, in die die jetzt Lernenden in Zukunft kommen werden, nicht sicher vorhersagbar sind. Wer so argumentiert, übersieht, dass bei jeder Lehrplanung Wahrscheinlichkeitsüberlegungen angestellt werden müssen und dass es hauptsächlich darauf ankommt, sie so fundiert wie möglich anzustellen. Dies liegt im Wesen der Erziehung begründet und kann auch von anderen, hier nicht vorgestellten Zielfindungsstrategien nicht ausgeschaltet werden. (S. 166)
Es ist zweifelsohne zutreffend, dass bei jeder Curriculumplanung „[…] Wahrscheinlichkeitsüberlegungen angestellt werden müssen […]“, doch dass die Hauptsache sei, die Planung der Lehre „[…] so fundiert wie möglich anzustellen“, ist eine unscharfe Formulierung Doyés. Was in einem Kulturkreis als fundierte Curriculumerstellung gilt, kann in einem anderen Kulturkreis als nicht akzeptabel gelten (Abschnitt 2.1).
2.5.2 Zielfindung nach Prinzipien
Die Wirtschaftspädagogen Gerholz und Sloane (2011, S. 1) setzen sich den einem Wandel unterworfenen Bildungsauftrag der Hochschulen – also verstärkt hin zu beruflicher Bildung – als Ausgangspunkt für Überlegungen zum Curriculumdesign für Bachelor-Studiengänge. Ihre Abhandlung fokussiert nicht konkret die Fremdsprachenfächer, sondern Hochschulkurse generell. Sie rücken dabei das so genannte „Lernfeldkonzept“ (s. Huisinga, 2003, S. 11–13), dessen Basis reale berufliche Handlungen sind, in den Mittelpunkt der Gestaltung universitärer Curricula. Das ursprünglich durch die Berufsbildung hervorgebrachte Lernfeldkonzept soll in ihrer Abhandlung der Hochschulbildung angepasst werden (Gerholz & Sloane, 2011, S. 1). Dies wird folgendermaßen begründet: „Wenn universitäre Bildung stärkere Züge einer Berufsfeldbildung annimmt, so ist es relevant zu untersuchen, inwiefern Konzepte der beruflichen Bildung auf die universitäre Bildung hin adaptiert werden können“ (ebd., S. 1). Zu dieser universitären Bildung gehört auch der FSU. Gerholz und Sloane (ebd., S. 4–7) gehen in ihren Untersuchungen der Frage nach, nach welchen in der Wissenschaft bewährten Prinzipien Lehr- und Lernziele für Curricula gefunden und strukturiert werden sollen.
Читать дальше