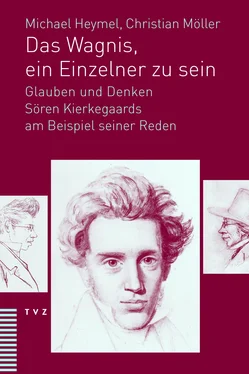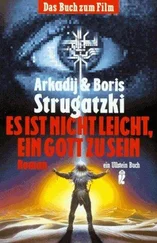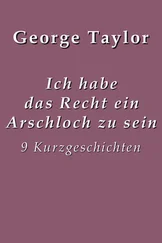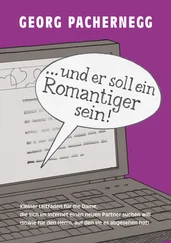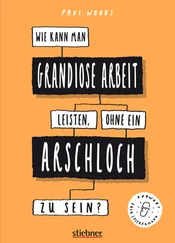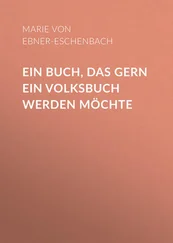Der Streit mit dem Weisen
Mit einer direkten Anrede des Lesers zeigt Kierkegaard an, dass er nun in das Zentrum seiner Rede eintritt, auf das sich auch der exemplarische Textausschnitt in diesem Kapitel bezieht. Ein Vergleich steht im Mittelpunkt, wie ihn Kierkegaard oft wählt, wenn er bei seinem Leser eine Evidenz des Gedankens und die Phantasie der Einbildungskraft entzünden will: »Mein Leser, hast du niemals mit einem Menschen gesprochen, der an Weisheit dir weit überlegen dennoch es wohl mit dir meinte, ja mehr oder doch besser (und somit mehr) besorgt war um dein Wohl als du selbst; hast du es nicht, |51| nun wohl so bedenke, was dir wie mir widerfahren könnte, so wie ich es nun darlegen will.«
Es ist des Vaters dialektische Kunst, auf die Kierkegaard hier anspielt.68 Der Vater ist der Weise, der im Streit die Übersicht behält, während sein Widerpart heftig wird, um den Vater für seine Ansicht zu gewinnen. Als am Ende des Streits der Punkt klar ist, auf den es ankommt, gibt der Weise zu verstehen: »Das war es ja, was ich von Anfang an sagte, während du in der Hitze des Gefechts mich nicht verstehen konntest noch wolltest.« Dennoch war der Streit nicht vergebens, denn er führt dazu, dass der dem Weisen Unterlegene selber zur Einsicht kommt und entdeckt, was dem Weisen von Anfang an klar war.
Kierkegaard folgert aus dieser gleichnishaften Erfahrung: »Wer aber die Innerlichkeit nicht fahren lässt, mit seinem Streit sich nicht aus dem Verhältnis mit Gott herausstreitet, sondern sich hineinarbeitet in Gott, ihm geht es ganz so, wie es erklärt worden ist, indem die innerliche Einkehr des Gebetes in Gott ihm die Hauptsache wird und nicht Mittel zum Erreichen eines Zwecks.« Was ist das – »innerliche Einkehr des Gebetes in Gott«? Am besten wird es wohl im Gegensatz zur Äußerlichkeit klar, mit der ein Mensch im Gebet nur an seinem Wunsch klebt oder auf seiner Ansicht Gott gegenüber beharrt. Dann bleibt er Gott noch gegenüber, arbeitet sich nicht in Gott hinein. Die innerliche Einkehr des Gebetes in Gott ist aber die Hauptsache.
Deshalb fragt Kierkegaard eher rhetorisch: »Sollte der nicht ein Beter sein, ja der rechte Beter, der spräche: Mein Herr und Gott, eigentlich habe ich gar nichts, dich darum zu bitten; verhießest du mir gleich, mir jeden meiner Wünsche zu erfüllen, ich weiß dennoch eigentlich nicht, was ich mir ausdenken soll, nur daß ich bei dir bleiben möge, so nahe, wie es möglich ist in dieser Zeit des Getrenntseins, in welcher du und ich leben, und ganz und gar bei dir möge sein in der Ewigkeit?«
Damit ist Kierkegaard ganz nahe bei dem Beter von Psalm 73, der sich in seinem Eifer über die »Ruhmredigen« mehr und mehr in Gott hinein arbeitet, so dass er schließlich bekennt: »Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde« (Ps 73, 25). Das ist die »innerliche Einkehr«, auf die es beim Gebet ankommt. Die Wünsche des Menschen fallen dann mehr und mehr ab, die Frage nach Himmel und Erde verstummt, weil am Ende nur noch die Anbetung Gottes bleibt, das innerliche Erfülltsein von Gottes Nähe. Das Du Gottes hat nun das Ich des Menschen mit seinem |52| Trotz, seiner geheimen Rechthaberei, seinen Wünschen ganz aufgesogen, so dass es in Psalm 73 nur noch heißt: »Du hältst mich … Du leitest mich … du nimmst mich an.« Dieses dreimalige Du versammelt sich in dem »Wenn ich nur dich habe …«. Kierkegaard sagt es so: »So wird denn der Mensch minder und minder glühend, zuletzt ist seine Zeit vorüber, so stirbt denn der Wurm des Verlangens klein bei klein, und das Verlangen stirbt ab, so schlummert denn die Wachsamkeit der Besorgnis allmählich ein, um niemals mehr zu erwachen, die Zeit der Innerlichkeit aber ist niemals vorüber.«
Innerlichkeit heißt also, dass ein unruhig auf seine Wünschen pochender Mensch zur Ruhe kommt, weil ihn eine Dankbarkeit für Gottes Nähe erfüllt. Alles Wünschen ist dann Nebensache geworden, ja, mehr noch: Alles Wünschen wird so kleinlich, so armselig und gering, dass es wie von selbst angesichts der »unbeschreiblichen Freude« an Gott verschwindet. Das ist der Sieg im Streit des Gebets. Der Mensch siegt durch seine Niederlage, weil er selbstvergessen auf Gott schaut und sich selbst mit seiner verzehrenden Sehnsucht auf glückliche Weise vergessen kann.
Im Gebet verändert sich die Gottesbeziehung
Schließlich fragt Kierkegaard, was denn nun durch den Streit anders geworden sei. Ist Gott vielleicht ein anderer geworden? Nun, es habe sich im Streit gezeigt, dass Gott unveränderlich sei, aber diese Unveränderlichkeit sei nicht mehr jene eisige Gleichgültigkeit, jene tödliche Erhabenheit, jenes kalte Schicksal, das noch der Verstand gepriesen habe. »Nein, im Gegenteil, diese Unveränderlichkeit ist innerlich und warm und allenthalben gegenwärtig, ist unveränderlich in der Sorge für den Menschen und eben darum lässt sie sich nicht verändern durch des Beters Schreien, so als ob nun alles vorüber wäre.«
Und der Beter? Hat er sich durch den Streit des Gebetes verändert? Dessen Veränderung sei nicht schwer einzusehen, meint Kierkegaard, denn am Beginn des Streits sei der Beter ja von seinen Wünschen umgetrieben gewesen. Dann aber, als sein Gebet innerlicher und innerlicher wurde, sammelte sich alles in ihm auf einen Wunsch, bis er auch mit diesem Wunsch zu nichts wurde, weil Gott ihn völlig erfüllte, ein Wechsel, den Kierkegaard mit einem wunderbaren Bild veranschaulicht: »Wenn das Meer alle seine Kraft anstrengt, so kann es das Bild des Himmels gerade nicht widerspiegeln, auch nur die mindeste Bewegung, so spiegelt es den Himmel nicht rein; doch wenn es stille wird und tief, senkt sich das Bild des Himmels in sein Nichts.«
Es braucht freilich zunächst viel Leiden, Kampf und Streit, um zur Innerlichkeit des Gottesverhältnisses vorzudringen. Auch das Gebet ist dazu nicht in der Lage, wenn es aus einem zerstreuten und nicht aus einem gesammelten |53| Herzen kommt. Wo die Innerlichkeit in Kierkegaards Sinn fehlt, da gleicht der Mensch einem Bogen, der nicht gespannt ist, so dass die abgeschossenen Pfeile kraftlos zu Boden fallen und ihr Ziel nicht erreichen.
Wie ist »Innerlichkeit« zu erlernen? Kierkegaard schreibt in seinem Tagebuch69 einmal von der »Methode der Innerlichkeit« und weist auf Hebr 5,8 hin, wo von Christus gesagt wird: »Er lernte an dem, das er litt«. Dies sei die »Methode der Innerlichkeit«, die von Christus als dem »Vorbild« zu erlernen sei. Durch Leiden ist Innerlichkeit zu erlernen, genauer: dadurch, dass ein Mensch dem Leiden nicht ausweicht, das ihm bestimmt ist. Und wie erkenne ich, welches Leiden mir bestimmt ist? Es lässt sich wohl nur im Nachhinein, d. h. im Rückblick auf erlittenes Leiden sagen, was mir an Leiden zugedacht war. So hat ja auch Kierkegaard zeitlebens sich seiner Schwermut gestellt und dadurch »an dem gelernt, was er litt«. Das war für ihn die Schule der Innerlichkeit. »Solange das Leiden dauert, ist es oft ungeheuer qualvoll. Doch nach und nach lernt man mit Gottes Hilfe, glaubend bei Gott zu bleiben, selbst im Augenblick des Leidens, oder doch so hurtig wie möglich wieder zu Gott hinzukommen, wenn es gewesen ist, als hätte er einen kleinen Augenblick einen losgelassen, während man litt. So muß es ja sein, denn könnte man Gott ganz gegenwärtig bei sich haben, so würde man ja gar nicht leiden.«70
C Bezug zur Gegenwart
Missverstandene Innerlichkeit
Der Begriff »Innerlichkeit« wird seit Hegel häufig als selbstgenießerische Sentimentalität bzw. als ein »Verhausen« der Subjektivität in sich selbst abgetan. Stattdessen komme es auf eine Vermittlung von innen und außen an. Kierkegaard lehnt jedoch Hegels Vermittlungsdenken ab, weil es Abgründe (sc. der Schwermut) überspringt, über die hinweg nichts zu vermitteln ist. Der im Äußerlichen zerstreute Mensch kann vielleicht gedanklich, aber nicht existenziell mit dem Inneren vermittelt werden, es sei denn, er arbeitet sich mit Hilfe des Gebets in Gott hinein.
Читать дальше