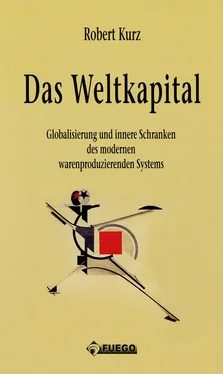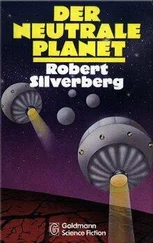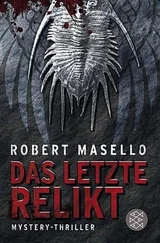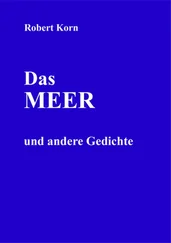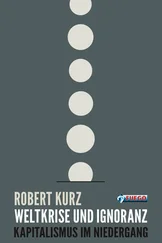Die Globalisierungskritik von Bové läuft auf viel zu kurzen Beinen, weil er bloß zurück will zu einem sowieso idealisierten »traditionellen« Zustand der Warenproduktion, der den anonymen Mächten weltkapitalistischer Vergesellschaftung gegenüber als Imagination des »kleinen« Warenproduzenten geltend gemacht wird. Das ist aber noch nicht alles. Denn die von Bové geschürte Pogromstimmung gegen »die Spekulanten« und die Rede von den »Parasiten« knüpft bewusst an die schlimmsten Ideologiebildungen der Modernisierungsgeschichte an. So naiv kann dieser Bauernführer mit durchaus intellektueller Geschichte gar nicht sein, dass er von diesen Zusammenhängen als Unschuld vom Lande nichts wüsste. Jedem Schulkind ist heute bekannt, dass eine auf Spekulation und zinstragendes Kapital verkürzte Kapitalismuskritik, die mit Begriffen wie »Parasiten« und »Geldjunkies« operiert, unvermeidlich an den antisemitischen Wahn anschließt und ihn füttert. Nach Auschwitz kann man nicht mehr ungestraft eine derart dumpfe Spekulantenhetze betreiben. Auch die Nazis stellten den Gegensatz des »schaffenden« (produktiven) und des »raffenden« (spekulativen, als »jüdisch« konnotierten) Kapitals ins Zentrum ihrer Mordideologie. Bei den Aussagen von Bové kann einem nur noch übel werden. »Die Welt ist keine Ware«, diese scheinbar griffige und weiterführende Parole, knüpft so in Wahrheit an die Naziparole an: »Der Jude (der Spekulant) macht den Menschen zur Ware«. Es ist geistiges Malbouffe, was Bové da verbreitet. Der Ausgangspunkt der Globalisierungskritik von Naomi Klein ist nicht die Landwirtschaft, sondern das Marketing. »No Logo!« bezieht sich auf eine Entwicklung innerhalb des globalen warenproduzierenden Systems hin zu »Markennamen«, bei denen der Gebrauchswert der Ware hinter dem Logo verschwindet und eine virtuelle Pseudorealität aufgebaut wird, die dann auf das wirkliche Leben abfärbt. Die Globalisierung sieht sie vor allem unter diesem Aspekt:
»Die Markenpolitiker gewannen, und ein neuer Konsens wurde geboren. Die Produkte, die in Zukunft florieren, werden nicht mehr als ›Waren‹ präsentiert, sondern als Ideen: die Marke als Erfahrung, als Lifestyle ... Die Markenmanie hat einen neuen Typ des Geschäftsmanns hervorgebracht. Er verkündet mit stolzgeschwellter Brust, die Marke X sei kein Produkt, sondern ein Lebensstil, sei eine Haltung, ein Wertesystem, ein Aussehen, eine Idee ... ›Nike‹, verkündete Phil Knight in den Achtzigerjahren, sei ein ›Sportunternehmen‹; seine Mission bestehe nicht darin, Schuhe zu verkaufen, sondern ›das Leben der Menschen durch Sport und Fitness zu verbessern‹ und ›den Zauber des Sports am Leben‹ zu erhalten. Der Präsident und Turnschuhschamane des Unternehmens Tom Clark erklärt, dass ›wir uns dank der Inspiration des Sports ständig neu gebären können‹. Berichte über solche Erleuchtungen hinsichtlich der ›Markenvision‹ wurden an allen Ecken und Enden laut. ›Das Problem von Polaroid‹, diagnostizierte John Hegarty, Chairman der Werbeagentur des Unternehmens, ›bestand darin, dass man sich immer als Kamera präsentierte, doch der Prozess der (Marken-)Vision hat uns etwas gelehrt: Polaroid ist keine Kamera, sondern ein soziales Schmiermittel‹. IBM verkauft keine Computer, sondern ›Problemlösungen‹ für Unternehmen, Bei Swatch geht es nicht um Uhren, sondern um die Idee der Zeit ... Die radikale Markenpolitik lässt sich keineswegs als bloße Spielwiese für die Vermarkter von modischen Konsumgütern wie Turnschuhen, Jeans und New-Age-Getränken abtun. Caterpillar, eigentlich ein Hersteller von Traktoren und bekannt für seine Gewerkschaftsfeindlichkeit, stürzte sich mit Feuereifer in die neue Markenpolitik und brachte die Cat-Accessoires auf den Markt: Stiefel, Rucksäcke, Hüte und alles Mögliche andere, das nach einem postindustriellen je-nesais-quoi schreit ... Seit Mitte der Neunzigerjahre sind die global operierenden Konzerne ... mit geradezu religiösem Eifer auf den Markenboom eingeschwenkt. Nie wieder wird die Wirtschaft vor dem Altar des Gebrauchsgütermarktes das Haupt beugen. Von nun an wird sie nur noch den durch die Medien geschaffenen Götzenbildern huldigen...« (Klein 2005/2000, 42-46, Hervorheb. Klein).
Ähnlich wie Bové und seine Bauerngewerkschaft trifft auch Naomi Klein mit ihrer Kritik bestimmter Erscheinungen durchaus ein qualitatives Krisenproblem des sich globalisierenden Kapitalismus. Die universelle Warenproduktion, wie sie aus der Logik der Verwertung von Kapital folgt, tendiert dazu, sich vom Gebrauchswert zu entkoppeln. Die französischen Situationisten und ihr Haupttheoretiker Guy Debord hatten schon in den 60er Jahren die scheinhafte Medialisierung und Virtualisierung kapitalistischer Reproduktion mit dem Begriff der »Gesellschaft des Spektakels« bezeichnet. Streckenweise liest sich die Analyse von Naomi Klein wie eine Reminiszenz an die Situationisten im Kontext des beginnenden 21. Jahrhunderts. Nicht nur bei den Nahrungsmitteln in Gestalt des »Malbouffe«, sondern generell bei allen Gegenständen des Bedarfs und bei allen Dienstleistungen überlagern eine oft infantile »Botschaft«, eine Lifestyleimagination, die Suggestion eines Lebensgefühls etc. die Nützlichkeit und den realen Genuss. Zunehmender »Gebrauchswertschrott«, an sich peinlich, ungenießbar, bloß noch zum schnellen Wegwerfen bestimmt, wird mit Gefühlen aufgeladen, wie sie die Leere des kapitalistischen Daseins überspielen sollen (»Erlebniseinkauf« etc.; inzwischen gibt es sogar schon »Erlebnisbäckereien«). Diese Entwicklung geht weit über die traditionellen Reklametechniken hinaus, auch wenn sie ursprünglich darin wurzelt.
dass der Gebrauchswert in gewisser Weise »verschwindet« bzw. völlig verzerrt und sekundär besetzt wird, diese Einsicht tauchte in der Reflexion des »westlichen Marxismus« außer bei den Situationisten in verschiedener Weise auf, konnte jedoch nicht zu einer grundsätzlichen Kritik der Warenform und ihrer globalen Entfaltung zugespitzt werden. Naomi Klein ist dieser Gedankenweg erst recht völlig fremd; ihre Reflexion verbleibt ganz selbstverständlich im Rahmen des warenproduzierenden Systems. Was sie beklagt, ist »die Übermacht des Marketings gegenüber der Produktion« (a.a.O., 43). Die Wirtschaft soll wieder »vor dem Altar des Gebrauchsgütermarktes das Haupt beugen«, der dann eben ein Markt für die Warenprodukte der »abstrakten Arbeit« bleibt.
Das gilt im weiteren auch für die Produktionsbedingungen selbst: Klein sieht die Erscheinungen des Billiglohns, der miserablen Arbeitsbedingungen, der Privatisierung, der Zwangsmigration usw., wie sie sich im Zuge des Globalisierungsprozesses ständig verschärfen, ebenfalls nur im Kontext der auf »Markenmanie« geeichten, weltweit operierenden Konzerne, die sich hinter den Imaginations- und Identifikationsmustern ihrer »Logos« moralisch verstecken. So richtig die Kritik an der negativen praktischen Erfahrung ist und die Phänomene benennt – sie dringt nicht bis zum Wesen und damit zur immanenten Logik des Gesellschaftsverhältnisses vor, das jene Erscheinungen erst hervorgebracht hat.
Wie Bové stellt auch Klein eine idealisierte »Produktion« (von Gebrauchsgütern, deren Warenform ausgeblendet bleibt) dem Marketing und der Politik der »Logos« entgegen; und wie dieser erkennt sie nicht, dass die beklagte negative Entwicklung aus dieser Produktion selbst hervorgegangen ist. Und abermals wie Bové kritisiert sie so nicht die globalisierte Warenform als solche, sondern bloß die Tatsache, dass
»heute so viel Macht im Virtuellen konzentriert ist – in Devisenhandel, Aktienkursen, geistigem Eigentum, Marken und geheimen Handelsabkommen. Indem sich die Protestaktionen auf Symbole konzentrierten, von der berühmten Marke wie Nike bis zum internationalen Gipfeltreffen führender Politiker, wurde das Ungreifbare zeitweise konkretisiert, der riesenhafte Weltmarkt auf ein menschlicheres Maß zurechtgestutzt« (Klein, a.a.O., 507).
Читать дальше