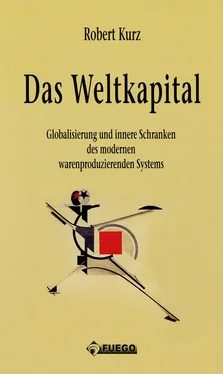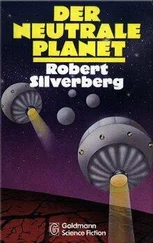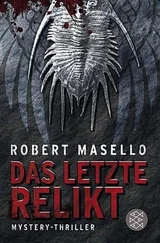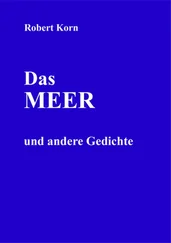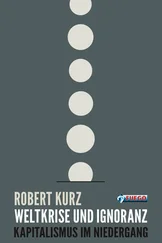»Die Zeit dürfte kommen, in der die meisten Steuerberater von Expertensystemen ersetzt sein werden. Der Mensch als solcher aber wird nicht überflüssig werden. Nach wie vor werden Tausende wirklich schwieriger, komplexer – und gut bezahlter – Dienstleistungen zu verrichten sein, wie Gartenarbeiten (!), Reinigungsarbeiten (!) usw. Solche Dienstleistungstätigkeiten werden einen immer größeren Anteil unserer Ausgaben ausmachen ... Die Hochqualifizierten, denen es in den letzten zwanzig Jahren so gut ging, könnten sich irgendwann als das moderne Gegenstück der Weber des frühen neunzehnten Jahrhunderts wiederfinden ... Ich vermute daher, dass das derzeit zunehmende Lohngefälle (und damit die Entwertung gewöhnlicher Arbeit) eine Entwicklung von begrenzter Dauer sein wird ... Meine Prognose lautet also, dass auf das momentane Zeitalter der Ungleichheit eine goldene Zeit der Gleichheit folgen wird...« (Krugman 1999, 220 f.).
Leider verrät uns Krugman nicht, wer nach der Wegrationalisierung der kapitalistisch »Hochqualifizierten« und sogar der Steuerberater eigentlich jene famosen persönlichen Dienstleistungen im großen gesellschaftlichen Maßstab kaufen wird. Ebenso wenig macht er sich die Mühe, zu begründen, warum diese weltweit elend bezahlten Dienste sich plötzlich ausgerechnet deswegen einer »guten Bezahlung« erfreuen sollten, weil die »Hochqualifizierten« durch Expertensysteme ersetzt werden. Das Ergebnis könnte nur eine Angleichung auf niedrigem, um nicht zu sagen armseligem Niveau sein. Aber auf Begründungen kommt es hier gar nicht mehr an. Krugman zieht die längst ausgereizte Karte der kapitalistischen »Dienstleistungsgesellschaft« sowieso nur, um sie gegen den Globalisierungsdiskurs auszuspielen. Charakteristischerweise springt er von einer Ebene (Globalisierung des Kapitals) einfach auf eine andere (strukturelles Verhältnis von Industrie- und Dienstleistungskapital). Die bloß vorübergehenden Krisenerscheinungen sollen nicht durch die Globalisierung, sondern durch die neue Qualität des technischen Fortschritts bedingt sein.
Ganz ähnlich der französische Ökonom Daniel Cohen: In seinem Buch »Fehldiagnose Globalisierung« (Cohen 1997) kommt er zu dem Schluss, dass es allein die Revolutionierung der Produktionstechniken sei, die zu einer Aufspaltung der Qualifikationen und damit zu gesellschaftlichen Problemen geführt habe, »nicht« jedoch weltwirtschaftliche Veränderungen, Deregulierungen etc. dass die Globalisierung in Wirklichkeit ein Produkt der dritten industriellen Revolution selbst ist und beides zusammenhängt, wird so im Unklaren gelassen.
Dieses Vorgehen hat in der ganzen Debatte Methode. Stets werden nur die Erscheinungen auf den verschiedenen Ebenen gegeneinander ausgespielt, statt nach ihrem inneren Zusammenhang zu fragen. Die richtige Problemstellung in diesem Sinne müsste dagegen lauten: Wie bedingen sich die mikroelektronische Revolution der Produktivkräfte und der Prozess der Globalisierung wechselseitig? Welcher Strukturbruch vollzieht sich in diesen Vorgängen tatsächlich, und inwiefern haben wir es dabei mit einer Zäsur in der kapitalistischen Geschichte zu tun, die sich auf der Ebene der »abstrakten Arbeit« (Marx) selbst manifestiert? Vor allem aber darf die Frage nicht ausgeklammert werden, ob der damit verbundene globale Krisenprozess nicht auf eine innere Schranke des modernen warenproduzierenden Systems verweist und alle systemkonformen Billigrezepte hinfällig macht. Wenn es sich so verhält, dann ist nicht Lebens-, Politik- und Unternehmensberatung angesagt, sondern eine neue radikale Systemkritik, die über den zu Ende gegangenen traditionellen Marxismus hinausgeht.
Globalisierungskritik auf zu kurzen Beinen
Natürlich gibt es durchaus Kritik, und die so genannte Anti-Globalisierungsbewegung hat bereits Millionen Menschen in aller Welt auf die Straße gebracht. Seit den späten 90er Jahren deuten die internationalen Großdemonstrationen von Seattle, Genua usw. und das jährliche Weltsozialforum als Gegeninstitution zur offiziellen neoliberalen Weltöffentlichkeit darauf hin, dass sich eine globale soziale Bewegung formiert, deren Konturen noch undeutlich sind. Es ist verständlich, dass eine solche soziale Bewegung von bestimmten unmittelbaren und negativen Erfahrungen ausgeht; von handfesten materiellen Problemen, für die nach einer Bewältigung gesucht wird, ohne dass zunächst die gesellschaftlichen und historischen Bedingungsgründe in den Blick kommen.
Auf dem Weg von der scheinbaren Unmittelbarkeit des sinnlich und sozial Erfahrenen zur weitergehenden Reflexion und zur Transzendierung des herrschenden gesellschaftlichen Systemzusammenhangs lauern aber die Fallgruben affirmativer Ideologiebildung, die den spontanen Protest in den Grenzen der tradierten und verinnerlichten Ordnung festhalten. Insofern muss eine weitergehende Reflexion die Oberfläche der Erscheinungen und Erfahrungen durchstoßen, um einen Blick für das Wesen des bestehenden Systems und die diesen Erfahrungen zu Grunde liegende gesellschaftliche Logik zu bekommen, die nicht so ohne weiteres ersichtlich ist.
Diese Aufgabe finden die sozialen Bewegungen des beginnenden 21. Jahrhunderts nicht nur im Kontext der Globalisierung als einer neuen Qualität der kapitalistischen Entwicklung vor, sondern auch im Kontext eines historischen Bruchs in der Gesellschaftskritik. Mit dem seit langem absehbaren Ende der westlichen so genannten Arbeiterbewegung sowie dem Zerfall der südlichen nationalen Befreiungsbewegungen und dem Untergang des östlichen Staatskapitalismus als obsolet gewordenen Formen einer »nachholenden Modernisierung« an der Peripherie des Weltmarkts ist das bisherige marxistische Paradigma der Kapitalismuskritik an historische Grenzen gestoßen
– ironischerweise zusammen mit seinem Gegenstand, dem globalen Kapitalismus selbst. Diese Gemeinsamkeit der historischen Schranke von traditionellem Marxismus und kapitalistischer Weltgesellschaft verweist darauf, dass die bisherige linke Gesellschaftskritik sich selber noch im Gehäuse kapitalistischer Kategorien bewegte, dass sie eben im wesentlichen immer nur eine Kraft der weiteren »Modernisierung« innerhalb der gesellschaftlichen Formen des warenproduzierenden Systems war.
Die neuen sozialen Bewegungen stehen also vor einer gewaltigen Herausforderung: Sie können sich in der Auseinandersetzung mit den negativen und destruktiven Phänomenen der Globalisierung nicht auf einen schon in einem historischen Prozess herausgearbeiteten Rahmen, ein Muster, ein Paradigma der Kritik mit einem vertrauten Begriffsapparat beziehen. Vielmehr muss die radikale Kritik selbst neu erfunden werden. dass dabei die präzise Marxsche Analyse der kapitalistischen Formen und gesellschaftlichen Bewegungsgesetze immer noch eine große Rolle spielt und nicht einfach als eine Art ideeller historischer Müll zu entsorgen ist, scheint evident. Aber die Marxsche Theorie muss selber transzendiert, in einem neuen Bezugssystem reformuliert, erweitert und in bestimmten Punkten auch kritisch überwunden werden. Die Aufgabe ist also eine doppelte: Die Bewegungen müssen sich den neuen sozialen Phänomenen und Problemlagen stellen wie alle sozialen Bewegungen zuvor, aber sie müssen gleichzeitig das Paradigma, das Interpretationsmuster und die Begriffe der Kritik neu bestimmen.
Es gibt im Kontext der Globalisierung eine grundsätzlich veränderte Situation nicht nur für die soziale Praxis, sondern auch für die kritische Theorie. Das spiegelt sich in der akademischen Theoriebildung etwa eines Ulrich Beck ebenso wie in den Reflexionen der Bewegungsaktivisten. Wenn aber Becks begriffliches Konstrukt der angeblichen »zweiten Moderne« eine Verlegenheitslösung und eine Mogelpackung darstellt, dann fragt sich natürlich, wie es damit bei den neuen sozialen Bewegungen selbst steht. Auf den ersten Blick scheint hier zumindest ein Impuls wirksam, der über den traditionellen Marxismus und die akademische Gesellschaftswissenschaft hinausgeht. Die bekannte Parole »Eine andere Welt ist möglich« wird nämlich inzwischen durch die ebenso bekannte Parole »Die Welt ist keine Ware« ergänzt und perspektivisch bestimmt.
Читать дальше