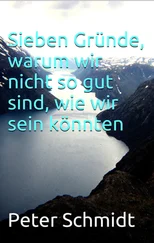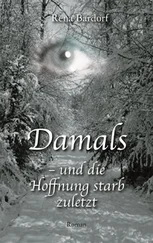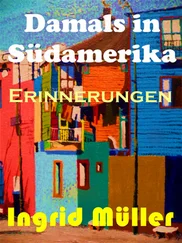So feierten wir damals
Здесь есть возможность читать онлайн «So feierten wir damals» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:So feierten wir damals
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
So feierten wir damals: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «So feierten wir damals»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
So feierten wir damals — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «So feierten wir damals», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
„Honorar“: Dieses Wort kannte ich. Honorar bekam meine Mutter auch von den Eltern ihrer Klavierschüler. Honorar war Geld! Aber gleich ein Sack voll Geld? Das konnte wohl nicht sein. Und selbst wenn der Sack voller Geld wäre: Was sollten wir damit anfangen? In den Geschäften gab es nicht viel zu kaufen.
Herr Krause, unser Nikolaus, trank noch eine Tasse Tee, dann verabschiedete er sich. Erst jetzt durfte ich dabei helfen, den Sack aufzubinden. Er war mit einer dicken, roten Schleife verschnürt, in der ein Tannenzweig steckte. Vorsichtig knotete ich die Schleife auf. Wenn man sie bügelte, wäre sie wie neu. Dann würde sie in den Kasten gelegt, in dem wir Bänder und Schleifen aufbewahrten.
Und welche Schätze fanden wir im Nikolaussack? Es waren geräucherte Würste, Butter, Eier, Speck, Mehl und Honig!
An diesem Nikolaustag gab es zum Abendbrot ein dickes Wurstbrot: ganz viel Wurst mit wenig Brot! Und am nächsten Tag würde ich ein Butterbrot essen, bei dem man den Abdruck der Zähne in der Butter sehen sollte.
Santa Claus 1960
Waltraud Schäfer
Am 6. Dezember holten wir für gewöhnlich meine Großmutter ab, um mit ihr zusammen Nikolaus zu feiern. Bischof Nikolaus besuchte uns im Kindergarten, zu mir nach Hause kam jedoch der amerikanische Santa Claus. Verwirrt hat mich das nicht.
An diesem besonderen Nikolaustag im Jahre 1960 saß ich zusammen mit meinen Eltern und der Oma im Wohnzimmer. Wir tranken Kaffee und aßen die ersten Plätzchen, die ich mit meiner Mutter und der Großmutter zusammen gebacken hatte. Als es dunkel wurde, polterte es heftig im Treppenhaus. Dann klopfte es laut an unserer Tür. Mein Vater schaute mich an und sagte: „Na, ich glaube, der Nikolaus besucht dich heute Abend persönlich!“ Daraufhin versteckte ich mich erst einmal hinter der Oma. Vater rief laut „Herein!“, die Tür öffnete sich und ein großer Mann in einem roten Samtmantel erschien. Auf dem Kopf eine rote Mütze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Es sah aus, als hingen große Wattebäusche an ihrem Rand. Ein langer weißer Bart verdeckte die untere Gesichtshälfte. Unter dem linken Arm trug er ein goldenes Buch und in den weiß behandschuhten Händen links eine Rute, rechts einen ebenfalls weißen Sack. Mir verschlug es die Sprache.
Der Nikolaus kam näher. Vorsichtig schaute ich hinter der Oma hervor. Er schlug das Buch auf und begann mit kräftiger Stimme vorzulesen: „Du bist in letzter Zeit nicht immer brav gewesen! Du hast nicht gemacht, was deine Mama dir aufgetragen hat! Im Haushalt könntest du mehr helfen!“
Ich suchte meine Stimme wieder. Schließlich antwortete ich zaghaft: „Lieber Nikolaus, ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben!“
Immerhin stand auch Gutes im Buch: „Im Kindergarten trocknest du die gespülten Becher nach dem Frühstück ab. Du hast schöne Bilder gemalt und auch gebastelt!“
Nun war meine Mutter dran. Der Nikolaus schaute sie mahnend an und verkündete: „Ich habe gehört, dass du zu langsam nähst!“ Meine Mutter war Schneiderin. Sie besserte unseren Haushaltsetat auf, indem sie privat für andere Leute nähte. Der Nikolaus nahm seine Rute und klopfte meiner Mutter tüchtig aufs Hinterteil. Meine Mutter gelobte Besserung.
Anschließend wandte er sich wieder mir zu. „Kannst du ein Gedicht oder ein Gebet aufsagen? Falls ja, dann hätte ich für dich noch etwas in meinem Sack.“ Vor Schreck hatte ich mein Gedicht vom Nikolaus vergessen, das ich mit meiner Großmutter zusammen gelernt hatte. Dafür fiel mir mein Abendgebet ein. „Kann ich das auch aufsagen?“ „Ja, das geht!“
Getreulich faltete ich die Hände, wie ich es abends immer tat, wenn ich mit meinem Vater betete: „Ich bin klein, mein Herz ist rein, es darf niemand drin wohnen als Jesus allein.“
Damit war der Nikolaus sehr zufrieden. Er öffnete endlich seinen Sack. Ich bekam Erdnüsse, Plätzchen, zwei große Apfelsinen und eine Tafel Schokolade. Ich freute mich riesig. Apfelsinen bekam ich nur selten, und Schokolade liebte ich über alles. Der Nikolaus ermahnte mich noch einmal, brav zu sein, dann machte er sich auf den Weg zu den anderen Kindern.
Der 8. Dezember
Maria Adler
Geboren in Mannheim und im Wesentlichen in einem Vorort davon groß geworden, war meine Muttersprache „Mannemerisch“ oder vielleicht „Friedrichsfelderisch“, eine leichte Abwandlung.
So kam es, dass der 8. Dezember für mich lange ein rätselhaftes Datum blieb. Zu Hause und im Kindergarten hatte ich einiges über die wichtigen Daten der Adventszeit gelernt: Nikolaustag, Barbaratag, Adventssonntage. Was aber war das mit dem 8. Dezember? Warum nur musste Maria ins Gefängnis? Was ihr vorgeworfen wurde, war nicht rauszukriegen. Sie tat mir so leid.
Von Maria war ich angetan, von den wunderschönen Bildern, die ich von ihr gesehen hatte, stolz darauf, denselben Namen wie sie zu tragen, auch ihn fand ich ganz besonders schön. Und dann so was! Ich getraute mich nicht nachzufragen, um mir Klarheit darüber zu verschaffen, was sie wohl verbrochen hatte. Zu oft schon hatte ich Fragen gestellt, deren unverständliche oder widerwillige Beantwortung mir das Gefühl vermittelt hatte, ich sei nicht besonders klug.
Also Jahr für Jahr dieses entsetzliche Datum, mitten in der schönen Adventszeit! Wie genau und wann Maria aus ihrem Gefängnis befreit wurde, weiß ich nicht. Nur den Grund für ihren unrühmlichen Aufenthalt: Mein „Friedrichsfelderisch“ war dafür verantwortlich. Mit „Empfängnis“ wusste ich nichts anzufangen. Was ich stattdessen verstand, war: „Maria im G’fängnis“.
Advent in den 50ern
Mechthild Müller
Anfang der 1950er Jahre lebten wir im Elternhaus meiner Mutter in der ersten Etage. Im Erdgeschoss wohnten meine Oma Anna, Onkel Heini und die Tante mit zwei Kindern. Eine echte Großfamilie und ein Kinderparadies. Onkel Heini besaß eine Wagnerei, in der die Bauern des Dorfes ein und aus gingen, außerdem gab es einen Holzplatz, einen Stall mit zwei Kühen, mit Schweinen und Hühnern und einen großen Hof: unser Spielplatz. Nebenan die Metzgerei und der Bäckerladen mit einem stattlichen Backhaus: Überall hatten wir Kinder unsere Nasen drin.
Der Wechsel der Jahreszeiten prägte unseren Alltag. Im Sommer lebten wir „auf der Gass“. Wenn es kälter wurde, begann die Zeit der Bilderbücher – gepaart mit leichter Langeweile. Mit dem ersten Adventssonntag wurde es erneut spannend und – geheimnisvoll.
Sonntags war Papa zu Hause. Er war es, der die erste Kerze anzünden durfte, nach dem voll Ungeduld gesungenen „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Tannenduft verbreitete sich, Wachsgeruch, wohlige Wärme. Dann erzählte Papa alljährlich dieselbe Begebenheit von seiner Gefangenschaft in Amerika:
Die Überfahrt in einem kleinen Schiff war so stürmisch gewesen, dass alle sicher waren, nach den überstandenen Schrecken des Krieges jetzt im weiten Atlantik ertrinken zu müssen. Doch es ging gut. In den USA gab es dann erstaunlich viel zu essen. Mein Vater war mit den anderen Gefangenen beim Bau einer Brücke eingesetzt, in Texas. Nun hatte meine Mutter bereits im September eine Blechdose mit Weihnachtsplätzchen abgeschickt. Angekommen sind sie jedoch erst im Januar, als Krümel. Mein Vater öffnete die Dose, sah die Krümel und sagte zu seinen Freunden: „Holt Löffel. Die Krümel werden gegessen! Sie sind von daheim!“ Und schweigend löffelten die Gefangenen im fernen Texas die deutschen Krümel.
In der Adventszeit waren auch die Werktage außergewöhnlich. Wir Kinder durften den Plätzchenteig durch den Fleischwolf Marke „Alexanderwerk“ drehen. Aus den Teigresten formten die Mütter eine Brezel, die wir sogleich nach dem Backen verspeisen durften. Die Plätzchen dagegen wurden in bunten Blechdosen gut verwahrt und versteckt: unterm Sofa nämlich und auf dem Speicher. Wir taten so, als würden wir diese Verstecke nicht kennen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «So feierten wir damals»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «So feierten wir damals» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «So feierten wir damals» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.