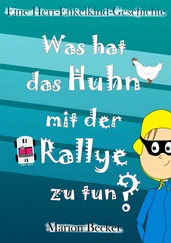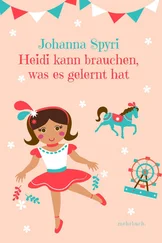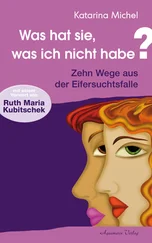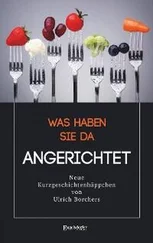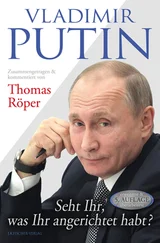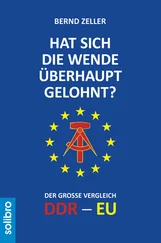Aber der Gang der Kirchengeschichte im späten Mittelalter lässt Zweifel an diesem Urteil aufkommen. Zunächst, weil die Kirche durch ihre Unterstellung unter die Könige von Frankreich („Babylonische Gefangenschaft“ in Avignon, 1309 – 1376) keine Chance bekam, den weltlichen Händeln der großen Politik zu entkommen, ja womöglich noch mehr in diese verstrickt wurde, und das nicht einmal als eine triumphierende Kirche (ecclesia triumphans) wie im 13. Jahrhundert, sondern eben im Schatten der Könige von Frankreich. Das bedingte einen Verlust an Autorität und Ansehen, und der schwindelerregende Ausbau des kirchlichen Finanzwesens gerade in der Avignoneser Zeit sowie die juristisch aufwendige Kultivierung der doch eigentlich verpönten „Simonie“ schufen zusätzliche Ressentiments.
Die Rückkehr von Papst Gregor XI. nach Rom hatte ein 37-jähriges Schisma zur Folge, da die Franzosen sich nicht mit ihrem Verlust an Einfluss abfanden. Am Ende amtierten drei Heilige Väter gleichzeitig, mit gegenseitiger Exkommunikation, was auf die Kirchengläubigkeit der Frommen einen verheerenden Eindruck machte und die Institution des Papsttums noch mehr in die Strudel der Politik hineinriss.
Das Heilmittel zur Beilegung des Schismas schien zu sein, der päpstlichen Monarchie durch die Etablierung der Autorität von Konzilien eine Art konstitutioneller Fesseln anzulegen, von Versammlungen aller Gläubigen, nicht nur der Kardinäle und Kirchenfürsten, sondern auch der Gelehrten von den großen Universitäten, damit – idealiter – das gesamte Gottesvolk seine Kirche, an der es nach wie vor hing, reformieren konnte. Dieses Projekt umfasste neben der Beseitigung des Schismas die Abstellung der in der Kirche aufgekommenen Missbräuche.
So trat, eine diplomatische Meisterleistung des römisch-deutschen Königs und späteren Kaisers Sigmund (1410 – 1437, vielfach auch Sigismund genannt), das Konzil von Konstanz zusammen (1414 – 1418). Die drei Päpste mussten sich zugunsten Martins V. (1417 – 1431) ihre Absetzung gefallen lassen. Man stellte 30 Artikel „Irrtümer des Johannes Hus“ zusammen, die der neue Papst nach seiner Wahl absegnete. Am 6. Juli wurde Jan Hus vor den Toren von Konstanz öffentlich verbrannt. Der daraufhin ausbrechende Aufstand seiner Anhänger in Böhmen war durch verschiedene „Kreuzzüge“ aus dem Reich heraus nicht zu bändigen. Die „Hussiten“ gewannen ihre Dynamik durch nationale (tschechische, d. h. antideutsche), soziale und religiöse Motive, die, über die Lehren von Jan Hus hinaus, bis hin zu einem kämpferischen Chiliasmus reichten.
Auf dem Konzil von Basel (1431 – 1449) sah sich die Kirche daher zu vertraglichen Konzessionen genötigt, die in den Prager Kompaktaten von 1433 festgehalten wurden. Die religiöse Hauptsache war dabei die Einräumung der Kommunion unter beiderlei Gestalt, nachdem die Kirche in den letzten Jahrhunderten, und noch einmal bekräftigt auf dem Konstanzer Konzil, die Kommunion an die Laien nur unter der einen Gestalt des Brotes gespendet hatte. Dafür versprachen die Gemäßigten unter den Hussiten, sich wieder mit der Kirche vereinigen zu wollen, und die Radikalen wurden von ihnen selbst bald niedergekämpft. 1452 erklärte Papst Nikolaus V. die Prager Kompaktaten für kassiert, doch die Machthaber in Böhmen hielten sich nicht daran. Das war der erste dauernde Verlust, den die römische Kirche an ihrer Glaubens-Autorität hinnehmen musste, in seiner Dimension allerdings ungleich geringer als der durch die spätere Reformation.
Die Kirchenreform nahm man sich in Konstanz mit großem Fleiß vor, weniger als religiöses (da glaubte man, mit der Verdammung der Lehren von Wiclif und Hus sowie mit der Verbrennung des Letzteren genug getan zu haben), denn als organisatorisch-moralisches Problem, und über den Kopf des Papstes hinweg. Das war jedoch ernsthaft genug. Die Diskussion auf dem Konzil war materialreich: Entweder das Kardinalskollegium sollte umfassendes Mitspracherecht am Thron des Nachfolgers Petri erhalten, oder dieses Kollegium war abzuschaffen, da es mit den kritisierten simonistischen Umtrieben zu eng verflochten war. Es oblag dann den Konzilien und Synoden, den Papst streng zu überwachen. Man gelangte nach unendlichen Verwicklungen zu folgenden, hier nur in Auswahl erwähnten Ergebnissen:
Alle zehn Jahre war, vom Papst einberufen, ein Konzil abzuhalten, nach Konstanz aber im fünften und dann im siebenten Jahr. Im Falle eines weiteren Schismas automatischer Zusammentritt. Der Papst darf Prälaten nur mit Zustimmung der Kardinäle versetzen. Nachlass der Geistlichen (Spolien) und Gebühren für Visitationen (Prokurationen) stehen der Kurie nicht mehr zu, ebenfalls nicht mehr die Einkünfte aus vakanten Pfründen. Aktive und passive Simonie zieht die Exkommunikation nach sich, die simonistisch erworbenen Gelder müssen zurückerstattet werden. Residenzpflicht für Bischöfe und Äbte, ohne jegliche Befreiung davon. Weitgehende Beschränkung der Erfindung und Erhebung päpstlicher Sonderabgaben, am Ende: sittsame Regeln über Tonsur, Kleidung und äußeres Auftreten der Kleriker. Regelungen zu der Vergabe von Pfründen, mit der interessanten, auf die mangelnde Bildung des damaligen Klerus Rückschlüsse erlaubenden Einzelheit, dass an Dom- und Stiftskirchen sowie bei größeren Pfarreien ein Sechstel der Stellen für wissenschaftlich Gebildete vorgesehen war. Auch das Konzil von Basel erging sich in detaillierten Änderungsdekreten. Aber es fehlte im Allgemeinen der kirchenpolitische Wille, diese in die Wirklichkeit umzusetzen.
Solche Versuche zeugten von der Einsicht in die Missstände im Schoße der Kirche, hatten aber zur Folge, dass die Päpste nach Konstanz einen erheblichen Teil ihrer Arbeitskraft in das Bemühen investierten, die Folgekonzilien, um deren Einberufung sie freilich nicht herumkamen, so ergebnislos wie möglich zu machen. Sie brachten sogar die in Konstanz beschlossene, grundsätzliche Überordnung des Konzils über den Papst zu Fall. Pius II. (1458 – 1464) erließ 1460 ein Dekret, das den Bann über alle aussprach, auch Kaiser, Könige oder Päpste, die es wagten, an die übergeordnete Instanz eines Konzils zu appellieren.
Das war politisch möglich, weil die Kurie sich inzwischen mit der zweiten im Mittelalter bestehenden Universalgewalt, mit dem Kaisertum, ins Benehmen gesetzt hatte. Kaiser Friedrich III. (1440 – 1493) war im Reich so schwach, dass er die Bedeutung seines Amtes nur im Zusammengehen mit dem römischen Papst wahren zu können glaubte. Daraus folgte, dass die Fürsten des Reiches im Widerstand gegen die weiter erfolgenden Eingriffe der Kurie finanzieller, personeller und machtpolitischer Art nicht auf die Unterstützung ihres Oberhauptes zählen konnten. Es ergab sich also ein durch das gesamte weitere 15. Jahrhundert beständig fortbrodelnder Unmut, der dann den Erfolg der Reformation Luthers nicht unwesentlich begünstigte.
Und je mehr der Papst seinen nach den Wirren des Schismas quasi neu gebildeten Kirchenstaat in der Mitte Italiens als eine der weltlichen Mächte auf dieser Halbinsel verstand, desto mehr geriet er wieder in den Bannkreis der großen Politik, wie ehedem. Desto mehr war er auch an seiner Einflussnahme im Heiligen Römischen Reich interessiert, die seine Kontrolle über die Besetzung der geistlichen Fürstentümer einschloss, einer Herrschaftsform, die es innerhalb der abendländischen Christenheit so nur mit dem Mittelpunkt in Rom und eben in Deutschland gab. Das oppositionelle (und weitgehend erfolglose) Ergebnis waren die „ gravamina (Beschwernisse) der deutschen Nation“, wie sie ab dem Frankfurter Reichstag von 1456 immer wieder vorgebracht wurden, auch von den geistlichen Fürsten und den Freien Reichsstädten. Nicht nur willkürliche Eingriffe in geistliche Stellenbesetzungen, auch finanzielle Zumutungen und Anmaßung geistlicher Gerichtsbarkeit in an sich weltlichen Angelegenheiten standen dauernd auf der Agenda. Da wehrte sich der allmählich entstehende, neuzeitliche Territorialstaat gegen Störungen seiner Konsolidierung durch eine Macht, die für sich Überordnung in Anspruch nahm. War partikularer fürstlicher Egoismus im Spiel, so fehlte es bei den gravamina auch nicht an nationalen Untertönen, wenn die auch bei Weitem noch nicht die ideologische Exklusivität im Stile des 19. Jahrhunderts für sich in Anspruch nahmen. Auch das wurde zum Treibsatz für den Erfolg der Reformation.
Читать дальше