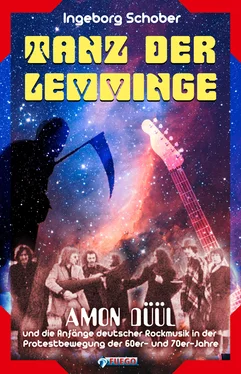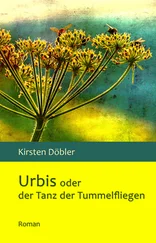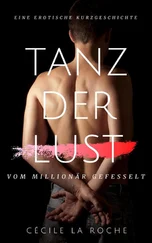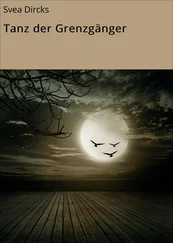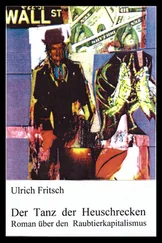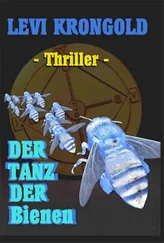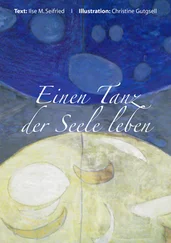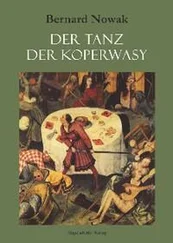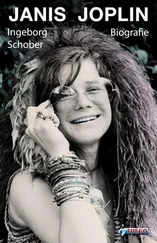Da war z. B. Peter Kaiser, der Theaterwissenschaft studierte und nebenher schon Assistenzen bei Filmemachern wie Peter Fleischmann (Herbst der Gammler) machte:
»Chris kannte ich aus dem Café Nest. Er war auf der Kunstakademie. Renate arbeitete im Büro und ich saß im Nest und hab mit Thorwald Proll ..., der später dann bei Baader landete, immer nur über das Sprengen geredet. Z. B. wollten wir gern das Siegestor sprengen. Wir fühlten uns als Anarchisten, aber nur verbal. Und dann sind wir mal in Chris’ alter Ente zu einer Demonstration gefahren. Chris hat immer indische und asiatische Musik gehört, ist total drauf abgefahren. Ich hab damals überhaupt kein Verständnis für so etwas gehabt und gedacht: Der spinnt! Wir sind in den Hofgarten gefahren, da war so eine amerikanische Geburtstagsfeier, und dort haben wir dann aus Protest mit Bonbons geworfen. Und dann haben sie uns verhaftet. Das war ein Spiel, das wussten wir ja. Da wurden dann die ›Bonbonschmeißer‹ abgeführt. Das war eine überlegte Aktion.«
Aus Blumen und Bonbons wurden Bomben. Aus den Multi-Medias wurde Amon Düül .
»Ich war damals beim SDS. Ein unheimliches Erlebnis war für mich, als die Uni zum ersten Mal besetzt wurde. Da war der erste Auftritt der Ur-Düül, das war ein wahnsinniges Erlebnis. Als wir die ganze Vorhalle besetzt hatten, waren die plötzlich da – mit den Kindern, der Uschi Obermaier, dem Helge, da sind sie zum ersten Mal überhaupt als Kommune aufgetreten. Das war alles sehr friedlich, die durften sogar ihre Verstärker in der Vorhalle der Uni aufbauen. Und wir sind fast ausgeflippt. Das war plötzlich etwas ganz anderes als das, was man sonst gehört hat. Dieses Ereignis gab wohl den Ausschlag, dass Amon Düül sich immer ein wenig politisch verstanden hat oder von manchen als politisch hingestellt wurde. Weil sie bei diesem riot, diesem mini-kleinen Aufstand umsonst gespielt haben und damit als Kommune an die Öffentlichkeit getreten sind. Da fing man an, überall Kommunen zu bilden.« Später wurde Peter Kaiser dann auch für einige Zeit der Manager von Amon Düül .
Die Bandmitglieder selbst können sich heute nur noch vage an ihren ersten Auftritt erinnern, wissen nicht einmal genau, wer nun eigentlich alles dabei war und Musik gemacht hat. Mit ziemlicher Sicherheit waren anwesend Chris, Peter, Uli, Rainer, Falk, Shrat, Ella, Angelika, die Kinder Romana und Joris. Ob Renate »Krötenschwanz« Knaup zu jener Zeit schon auftrat, weiß keiner genau. Sie war gerade erst zur Kommune in der Prinzregentenstraße gestoßen. Wie auch die anderen war sie im Allgäu geboren, am 1. Juli 1948 in Sonthofen, wo ich später mit ihr die erste Volksschulklasse besuchte. Als die Internatsfreunde sich in München sammelten, war sie als Au-Pair- Mädchen in London, kam dann über Al Gromer, ein ebenfalls aus Sonthofen stammenden Sitarspieler, mit Amon Düül in Kontakt, während sie anfangs noch ihr Geld im Büro verdiente.
Der Name Amon Düül entstand aus einem ägyptischen und türkischen Wort für Sonnengott: »Düül, na ja, das ist ein Wort, das bisher nie dagewesen ist, mit zwei ü, weder im Deutschen, noch im Englischen oder Japanischen oder sonst wo«, so die Band 1969 in einem Interview mit Underground. Der damalige Architekturstudent und heutige Filmverleiher und -produzent Gerd Stein bezeichnet den ersten Düül-Auftritt als Impuls für ein neues Leben. Er arbeitete damals nebenbei in einem Architekturbüro: »Ich war auf der Akademie gewesen und konnte schöne Zeichnungen machen, deshalb hatten die mich eingestellt. Das sah so künstlerisch aus! Ich wurde als Hofnarr gehalten.« Irgendwann flog er raus, kam in ein anderes Architekturbüro: »Da sollte ich eines Tages eine sinnlose Korrektur an einer Zeichnung vornehmen, hatte die ganze Nacht dran gearbeitet, wollte am nächsten Tag nach Spanien. Da bin ich dann mit meiner Kündigung nach Spanien gefahren. Ich hatte immer nur das gemacht, was man von mir erwartete, hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen wollte. Parallel hab ich dann angefangen zu fotografieren. Ich hatte zwei Freunde, einen Jurastudenten und einen Profi, die mich stark beeinflussten. Und es war eine echte Donald Duck-Situation: Studium – nicht mehr haltbar, Fotografieren – noch nicht professionell! Und dann kam ich in die Uni, und da stand dieser Typ und machte diese Bewegung! ... die Düüls spielten abends in der Vorhalle, rechts vom Siegestor rein in den Haupteingang der Uni. Besonders erinnere ich mich an diesen Typen mit der Brille und den Locken, Rainer Bauer muss das gewesen sein. Der bewegte sich so wie Johnny Rotten von den Sex Pistols , nur dreimal schneller. Das war völlig abstrus und für mich völlig fremd. Und das hab ich aber sofort verstanden. Das hat mir einen unheimlich starken Impuls gegeben. Ich kann gar nicht erklären, warum. Und diese Musik, die ich völlig unwirklich und abartig fand, aber die mir so gut tat! Ich hörte zu der Zeit so was wie Herb Alperts ›This Guy's in Love‹ und Quincy Jones. Rock ’n’ Roll gab’s weit und breit nicht, die Beatles und Stones waren nie so stark bei mir. Und rundherum eine völlig beschissene Situation – und dann kam das! Das war für mich die Befreiung.«
Baby, du hast nichts zu verlieren als den Verstand!
An mir jedoch ging die Geburt des deutschen Undergrounds erst mal vorüber, denn ich saß in einem Lehrzimmer in Frankfurt und schrieb Referate über Kafka, Handke, Villon und Sartre. Zwar hörte ich von P. G. Hübsch und Bernd Brummbär und ihrem »Heidi Loves You« - Shop, Treffpunkt der Frankfurter Szene, aber unsere Heimordnung war streng und die Buchhändler angepasst. Nur in die Pudding Explosion, Holzgraben 9, bin ich öfters, um neue Platten zu kaufen. Die hatten am 25. Januar mit einem Flugblatt eröffnet, das das berühmte Frank-Zappa-auf-dem-Klo-Plakat zeigte: » Join the Underground, Baby, du hast nichts zu verlieren als den Verstand! – Superplakate, Buttons, Hippiezubehör, Poppolitics, Undergroundzeitschriften, Psychedelikatessen, Freak Out und so was alles!!!« Dass ich in der verstaubt-akademischen Buchwelt, in der »lustbetontes Chaos« ein Fremdwort war, nicht alt werden würde, war klar. Mitte Juni kam ich in ein verändertes München zurück. Selbst bei meinen Heimbewohnern hatte sich was von den »Haschrebellen« an der Isar rumgesprochen. Damals gab es noch schöne, heiße Sommer, und dieser war eben nicht nur politisch heiß. Im Garten der Kunstakademie stiegen die legendären ›Akademiefeste‹ mit Musik, Happening, Freak Out!
Bei einem dieser Feste, wo meist die Düüls auftraten, hat der Filmemacher Wim Wenders die Band zum ersten Mal live gesehen. »Das war im Frühjahr 1968. Das war, glaub ich, überhaupt eines der ersten Male, wo die überhaupt aufgetreten sind: Ich hab sie dann später oft gesehen, an verschiedenen Plätzen in München und dann z. T. auch kennengelernt. Zum Beispiel den Shrat hab ich gut gekannt. Aber das erste Mal war in der Kunstakademie, und das war ungeheuer chaotisch. Es gab damals eine Platte, die irgendwie ganz wichtig war in der Münchner Szene. Das waren die Hapshash And The Coloured Coat . Und dann gab es natürlich auch die ersten beiden Velvet-Underground-LPs, und besonders die schwarze, diese chaotische schwarze LP, die auch nicht weit entfernt ist von der Hapshash-Musik. Und wie die Amon Düül zum ersten Mal zu spielen angefangen haben, das war halt schon wie die Velvet Underground oder Hapshash . Und ein Versuch, damit fertig zu werden, ein Versuch, mit diesen Erfahrungen selbst Musik zu machen. Und zwar halt nicht als Imitation, sondern da was eigenes draus zu machen. Das war entsetzlich chaotisch. Und ich erinnere mich, dass sie in diesen ersten Sessions auch plötzlich mittendrin aufgehört haben, weil keiner mehr wusste, wie es weitergehen soll. Und das hab ich gleichzeitig auch sehr, sehr geschätzt. Und deshalb waren auch die Amon Düül für mich ein richtiger Mythos in der Zeit, weil das eine Band war, die was gesucht hat. Das war der Sinn, der Inhalt dieser Musik – eine Suche. Und sie hatten ein paar Stücke, die sie immer wieder gespielt haben, die waren dann jedes Mal anders und jedes Mal ein Stück weiter. Die Stücke basierten auf ganz rhythmischen Fetzen und sind dann immer länger geworden in den rhythmischen Bögen, und immer ausgewogener und auch immer schöner. Und beim ersten Mal war’s absolut chaotisch. Shrat spielt auch eine Rolle in meinem Film Summer in the City und vorher noch in Alabama , das war Ende ’68. Den Shrat hab ich am Liebsten gemocht, weil er angefangen hat zu singen. Und eigentlich in der ersten Zeit von Amon Düül nur irgendwie so was ins Mikrofon geblökt hat. Und mittendrin dann aufgehört hat und von der Bühne gegangen ist. Und eigentlich nicht singen konnte und dann tatsächlich singen gelernt hat, im Verlauf von den ein bis zwei Jahren, in denen ich das verfolgt hab. Und das war die Geschichte von Amon Düül, dass die Leute, die da Musik gemacht haben, das eigentlich gar nicht konnten, sondern nur den Wunsch hatten, das zu machen. Falk, der immer nur hinter seiner Orgel stand und manchmal auf so eine Taste gedrückt hat. Man hat den auch gar nicht gehört. Und nach und nach, von Konzert zu Konzert, sind die Musiker geworden. Und allmählich hat man dann auch die Orgel hören können, und das waren dann nicht nur mehr einzelne Töne: Und so haben die sich nach und nach aus diesem Chaos rausgelöst und sind richtige Musiker geworden, so etwas wie die Jefferson Airplane von Deutschland. Und nicht nur, weil Renate dabei war und ähnlich ausgesehen hat wie Grace Slick, sondern von der ganzen Haltung her, der ganzen Auffassung. Am Anfang war das mehr Eastcoast-Musik und ist dann immer mehr und mehr eine Westcoast-Musik geworden. Eine sich immer mehr befreiende und losgelöste Musik.«
Читать дальше