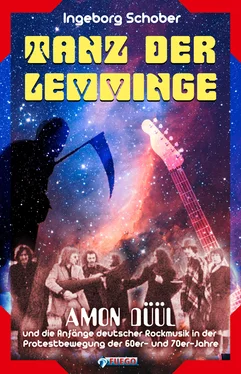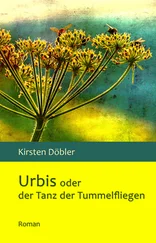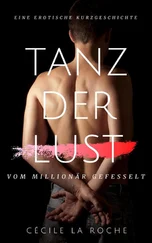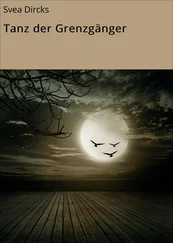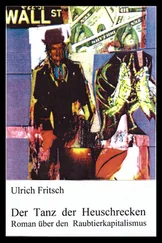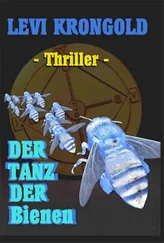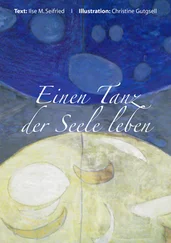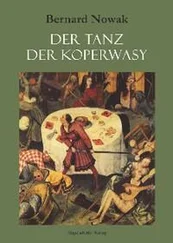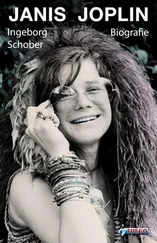Was nach den 70er-Jahren passierte, und damit meine ich nicht nur Amon Düül , sondern die neuere (musikalische) Geschichte Deutschlands, lege ich den jungen Schreibern ans Herz, falls sie für so was noch Muße, Zeit und Interesse haben. Weil Stillstand Rückschritt ist, wie Farin Urlaub von den Ärzten meint. Weil der Tanz der Lemminge in der Jugendszene nie aufhört — und eine/r ihn immer begleiten sollte. Weil es immer wieder Musiker gibt, die das Lebensgefühl ihrer Generation auf einen Nenner bringen, wie Element Of Crime 1993 mit »Immer unter Strom«:
»Wer sich bewegt, ist nicht zu fassen, ...
Wo wir war'n, war immer alles fade
wo wir hinfahr'n wird es wunderbar ...
Immer unter Strom
Immer unterwegs und niemals zu spät.«
Was hoffentlich auch auf dieses Buch zutrifft.
Ingeborg Schober
München, im November 1993
»There’s something happening here
what it is ain't exactly clear
there’s a man with a gun over there
tellin me I’ve got to be aware
I think it’s time we stop ...
There’s battlelines being drawn
nobody’s right if everybody’s wrong
young people speakin their minds
getting so much resistance from behind
I think it’s time we stop …
What a field day for the heat
a thousand people in the street
singing songs and a-carring signs
mostly say hooray for our side
it’s time we stop …
Paranoia strikes deep
into your life it will creep
it starts when you are always afraid
step out of line
the men will come and take you away
you better stop …«
Stephen Stills, 1967
In diesem Lied beschrieb Stephen Stills mit seiner Band Buffalo Springfield eine Straßenschlacht zwischen Hippies, der Polizei und den Bürgern in Hollywood 1967. Das Lied wurde zur Demonstrations-Hymne der Hippies, die noch an eine Veränderung der Welt durch Liebe glaubten. »Make love not war«. Für sie war Revolution noch ein Spiel, an dem jeder teilhaben konnte. Spiel und Spaß war es anfangs auch für die Studenten, nicht nur in Kalifornien. Als Jerry Rubin 1970 in seinem Buch Do It! die Leute aufforderte: »Jeder schreibe seinen eigenen Slogan, jeder protestiere gegen das, was ihn persönlich stört«, war das nur noch ein Fazit dessen, was längst passiert war — persönliche Anarchie bis zur Selbstzerstörung.
KAPITEL 1
Dieses Buch beginnt in München, wo es auch endet. Es berichtet von Musikern, Lebenskünstlern, Genossen, Freunden (und auch mir), die viel gewinnen wollten und dadurch manches verloren haben. Der Einsatz war entsprechend hoch, das Leben meist gefährlicher, als wir wahrhaben wollten.
Wir schreiben das Jahr 1967, die Beatles und fünf Jahre Popmusik, Protestmärsche der Atomwaffengegner und Antivietnamdemonstranten und die Gründung der APO liegen schon hinter uns, als Europas Jugend Kenntnis vom »Sommer der Liebe«, 1966, an der Westküste Amerikas erhält. » If you go to San Francisco, wear some flowers in your hair.« Die Botschaft wurde schnell zum Werbeslogan, um Ketten, Glöckchen, Ringe, Räucherstäbchen und indischen Firlefanz zu verkaufen. Wir empfanden uns als Teil der internationalen Studenten-, Jugend- und Musikbewegung, suchten aber gleichzeitig nach einem eigenen Sprachrohr. Überall saßen die Leute in den Startlöchern, warteten auf das entscheidende Signal. Es herrschte nur die trügerische Ruhe vor dem Sturm.
Nach Vorbild des Films nannte sich in München die Viva-Maria -Gruppe um Kunzelmann, Langhans, Teufel und Dutschke. Sie war Keimzelle der Kommune I, am 1. Januar 1967 in Berlin gegründet.
In San Francisco fanden sich 20.000 Gleichgesinnte zum ersten Free Concert »Gathering of the Trips« im Golden Gate Park zusammen. Schwere Studentenunruhen erlebte nicht nur Barcelona. Schwere Zusammenstöße zwischen Polizei und Hippies führten bei einem Peace-In in Los Angeles zu zahlreichen Verletzten, und Flugblätter mit der Frage »Wann brennen die Berliner Kaufhäuser?«, die nach dem Kaufhausbrand im Brüsseler A L'Innovation in Berlin auftauchten, lösten nationale Empörung aus. Günter Grass trug bei einem Protestmarsch gegen die polizeiliche Stürmung des Berliner SDS-Büros ein Plakat »Tausche Grundgesetz gegen die Bibel!« Und in München demonstrierten Studenten gegen die geplanten Tariferhöhungen der öffentlichen Verkehrsmittel. Beim Berliner Ostermarsch kam es erstmals zu Ausschreitungen gegen das Springer-Haus, kurz darauf wurden elf Kommunarden nach einem »Puddingattentat« auf US-Vizepräsident Hubert Humphrey verhaftet. So standen die Dinge, als am 2. Juni ein Ereignis die Idee von der friedlichen Veränderung der Welt, einer Politisierung mit Spaß und Happening, infrage stellte. Der Student Benno Ohnesorg war während einer Demonstration gegen den Schah von Persien das Opfer einer Polizeikugel geworden. Für viele war das die Initialzündung, manch einer hat seinen Glauben an die demokratische Bundesrepublik verloren, für viele wurde er zumindest angeknackst, andere, bis dahin eher gleichgültig, abwartend und distanziert, wurden durch diesen Schock emotional politisiert.
Für die späteren Mitglieder der Amon Düül und viele, die in diesem Buch vorkommen, begann der Tanz der Lemminge erst jetzt.
Als Buchhändlerlehrling im Szczesny-Verlag, München, lernte ich die Autoren Bertrand Russell, A. S. Neill, die Autoren der Club Voltaire -Reihe und ihre Bücher kennen, war als Mitglied der Humanistischen Union dementsprechend human-liberal orientiert. Mit 180 DM Lehrlingsgehalt wohnte ich in einem Jugendheim der Arbeiterwohlfahrt Rädda Barnen , kurz Schwedenheim genannt, in einem 1 ½ mal 2 Meter großen Zimmer bei 189 DM Miete. Die meisten der ca. 200 Heimbewohner waren, wie ich, Wohlfahrtsfälle in einem Wirtschaftswunderland. Wir fühlten uns von der Wohlstandsgesellschaft betrogen, und das verband uns – Lehrlinge, Schüler und Studenten. Und dann war da noch die Popmusik!
Auch wenn wir die Texte der Rolling Stones, Beatles, der Animals und Kinks nicht richtig verstanden, wir wussten, um was es ging. Es ging um uns, um unsere Probleme. Es war unsere Sprache, unsere Musik. Da begannen meine intellektuellen Freunde gerade diese Musik für sich zu entdecken. Dabei geholfen hat ihnen sicher der rührige und wohlinformierte Uwe Nettelbeck — freier Journalist, Autor und Produzent der Gruppe Faust — mit seinen Textinterpretationen und Musikanalysen, mit denen er nicht nur die Musik der Beatles auf das Niveau der »Neuen Modernen« hob. So war in Aspekte im November folgendes in einem Artikel über »Pot Music« zu lesen: »Dann kam Revolver. In › Tomorrow Never Knows ‹ , dem letzten Titel des Albums, zitierten John Lennon und Paul McCartney eine Zeile aus The Psychedelic Experience, einer Art Michelin für LSD-Trips, den die Havard- Drop-outs Timothy Leary, Ralph Metzner und Richard Alpert im August 1964 in New York veröffentlicht hatten: › Turn off your mind, relax and float downstream ... ‹ Das war das Signal.«
Die bis dato als trivial und proletarisch verpönte Popmusik wurde in einem elitären Kreis schick und gesellschaftsfähig. Auch die konservativen Medien stellten sich allmählich auf die neuen Bedürfnisse ein. Am 5. Juni 1967 startete der Bayerische Rundfunk nach etlichen Vorlaufsendungen die erste Jugendmusiksendung, den täglichen Club 16. Georg Kostya, Discjockey der ersten Stunde, erinnert sich:
Читать дальше