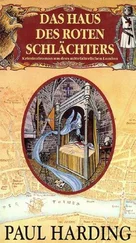Andererseits: Sie machten es einem ja auch wirklich nicht schwer. Wenn eine Horde Fünfzehnjähriger mit von tiefem Empfinden gezeichneter Miene und nach oben gereckter Faust über die Tanzfläche hoppelt und dazu grölt: Verdamp lang her, verdamp lang, verdamp lang her. Oder wenn eine Gruppe von Arztsöhnchen und Anwaltstöchtern mit adretten Scheiteln und steifkragigen weißen Hemden unter den V-Ausschnitt-Strick-Pullovern wie in Extase brüllt: Born to be wild. Oder wenn sich am Ende einer Fete alle umfassen, um gleichgeschaltet und mit Tränen der Ergriffenheit in den Augen zu singen: Freiheit, Freiheit, ist das Einzige, was zählt. Bevor dann um neun Uhr abends das Licht angeht und Mutti vor der Tür im Wagen wartet, um den Nachwuchs nach Hause und ins Bett zu bringen. Was könnte man dazu groß sagen, ohne zum Zyniker zu werden?
Wirklich nachvollziehbar wirkte die Begeisterung nur, wenn Herbert Grönemeyer erklang: Kinder an die Macht! Ich war damals schon dankbar, dass kein auch nur halbwegs bei Sinnen stehender Erwachsener diesen Quatsch in die Tat umzusetzen gedachte. Auch bei Männer aus gleichem Hause wirkte das Mitsingen glaubwürdig: Wann ist ein Mann ein Mann? – das dürfte unterm Strich die vielleicht entscheidende Frage für die meisten Jungs gewesen sein, wenn sie morgens vor dem Spiegel ihre Haut, auf der sie so etwas wie die flaumige Ahnung von Bartkeimung ausfindig gemacht zu haben glaubten, wie besessen abschabten, weil irgendwer ihnen erzählt hatte, dass so die Entstehung von nachweisbaren Stoppeln beschleunigt werden könnte. Und Wann ist ein Mann ein Mann? haben sich fraglos auch alle gefragt, die misstrauisch allabendlich den Baufortschritt ihrer Schambehaarung und der Geschlechtsteile beäugten.
Vielleicht deswegen legte sich die allgemeine Grönemeyer-Begeisterung recht bald wieder. Dafür kam Marius Müller-Westernhagen. Während Herbert unter dem Verdacht stand, eher von uncoolen Typen gut gefunden zu werden, galt Marius als total wild und authentisch. Der Mann wurde rasch ein weiterer Grund, warum ich Feten hasste. Denn ganz und gar nicht lächerlich wirkte es, wenn fünfzig Teenager wie im Wahn herumsprangen und -hantierten, dabei wie die Schweine schwitzten und mit vor Verachtung bebender Stimme brüllten: Dicke schwitzen wie die Schweine / Fressen, stopfen in sich rin. / Dicke, Dicke, Dicke, Dicke – na du fette Sau?
Das war für mich als jemand, der dem Sujet des Liedes unangenehm nahekam, ohne jede Frage eine unangenehme Situation. Natürlich war das irgendwie anders gemeint, das war mir damals schon klar, irgendwas mit Vorurteilen vorführen und so – aber so oder so rückte der Song unweigerlich meine Statur ins Rampenlicht, und das gefiel mir schon mal gar nicht. Und erst recht gefiel mir nicht, dass die Situation mich zwang, mich aus meiner Ecke begeben und mithopsen zu müssen. Denn es war ja ohnehin klar, dass alle bei dem Lied an mich denken würden, und wenn ich dann sauertöpfisch in der Ecke sitzen bleiben würde, könnte ich Bier trinken und intellektuelle Sprüche klopfen, so viel ich wollte, es würde meinen sozialen Status nicht mehr retten. Sie hätten mir meine Souveränität nicht abgekauft, intellektuelle Textexegese hin, Vorurteile vorführen her. In dem Moment war ich einfach der Dicke. Was blieb mir also übrig? Also Angriff.
Ungelenk, unrhythmisch und übellaunig sprang ich also in die Menge hinein und kam mir dabei vor wie eines dieser Barbapapa-Männchen, nur dass ich hier nicht süßlich-klebrig von heiler Welt säuselte, sondern mit der Menge schrie: Dicke müssen ständig fasten / damit sie nicht noch dicker werden / und ham sie endlich zehn Pfund abgenommen / ja dann kann man es noch nicht mal sehn, und wie einer dieser furchtbaren Hüpfbälle, auf denen wir immer durch die Turnhalle hopsen mussten, schlug ich eine Schneise durch meine zunehmend etwas verängstigten Mitschüler, die auch nicht so recht wussten, was sie von der Situation nun halten sollten. Aber ich sprang enthemmt durch den Saal und brüllte jedem, der sich nicht schnell genug wegducken konnte, hysterisch ins Ohr: Und darum bin ich froh, dass ich kein Dicker bin! Denn Dicksein ist ne Quälerei! Ich fühlte mich unwohl, aber ich wusste, ich musste es durchziehen. Ich bin froh, dass ich so’n dünner Hering bin / denn dünn bedeutet frei zu sein, schrie ich den verunsicherten Mitschülern ins Gesicht und bewegte mich dazu so energisch wie im Sportunterricht der gesamten Mittelstufe nicht, Dicke ham’s so schrecklich schwer mit Frauen / Denn Dicke sind nicht angesagt / drum müssen Dicke auch Karriere machen / Mit Kohle ist man auch als Dicker gefragt, blaffte ich den Mädchen ins Gesicht, mein Gesichtsausdruck bekam etwas Wahnhaftes, ich donnerte weiter wie eine Abrissbirne von einer Seite des Gemeindesaals zur nächsten, meine Mitschüler brachten sich zunehmend in Sicherheit. Als der beschissene Song endlich zu Ende war, sahen mich alle ein wenig furchtsam, aber auch erkennbar respektvoll an.
Außer Peter. Der war immer schon etwas schlicht gestrickt, halt einer von denen, die im Sport gut waren. Seine ganze Reputation zog er aus diesem Umstand, ansonsten hatte er wegen erwiesener Vollpfostigkeit keinen allzu guten Stand. Er guckte mich nur verwundert an: »Aber du bist doch selber dick?« »Das ist Ironie, du Vollidiot, der Song ist ironisch!«, fuhr ich ihn an. Er schaute nur verständnislos, und dann sagte er es: »Was ist denn daran bitte schön ironisch? Das stimmt doch alles!«
Ich sah ihn kurz fassungslos an, dann schlug ich zu. Er war so überrascht, dass er, vermutlich eher vor Schreck als durch meinen wenig professionellen geführten Kinnhaken, zu Boden ging. Mitschüler quiekten und giggelten, sofort stürzten sich einige auf uns und zogen uns auseinander, und jetzt ging auch gleich das nächste Lied los: The Final Countdown. Na also. Ich tanzte weiter. Mein Ruf als Intellektueller hatte womöglich etwas gelitten, aber in der Klassenhierarchie war ich eindeutig ein paar Stufen aufgestiegen. Zum Glück war Peter nicht nachtragend. Trotzdem ließ ich nach diesem Vorfall die nächsten zwei oder drei Feten ungenutzt verstreichen.
Aber irgendwann musste ich ja doch wieder hin, es half ja nichts. Also saß ich wieder in meiner Ecke und lästerte. Tobias mochte mich wegen meiner Kommentare und respektierte mich wegen meines Trinkvermögens, er erkannte aber, dass die Sache mit den Mädchen noch suboptimal lief und redete auf mich ein. Ich müsse halt auch mal wieder mittanzen. Aber vielleicht anders als beim letzten Mal. Am besten – huch, noch so ein Wort, bei dem ich heute ein bisschen zucken muss – am besten sollte ich einfach mal schwofen.
»Los jetzt«, zischte er mir ins Ohr, als Forever young ertönte. »Frag Jana, ob sie mit dir schwoft!«
Ich wollte lieber in meiner Ecke sitzen bleiben. Einerseits. Andererseits: Mit ausgerechnet Jana sprach er aber auch wirklich mal was an. Mit der hätte ich ja sehr, sehr gerne mal was zusammen gemacht. Also: nicht schwofen, natürlich, aber die Erfahrung der letzten Monate hatte mir gezeigt, dass von alleine ansonsten auch nicht so recht was begann.
Andererseits: Und wenn sie nein sagt? Ich fühlte mich ebenso hilflos wie zunehmend panisch, nachdem Tobias mir erneut in die Seite boxte. »Und wenn sie nein sagt?«, fragte ich ihn also. »Ach was, die sagt nicht nein.«
»Und was soll ich dann machen? Ich kann das nicht!«
»Meine Güte, ist doch nur Schwofen. Da muss man nichts machen. Das geht ganz von allein. Hör einfach auf die Musik, beweg dich ein bisschen, und vor allem: halte sie in deinen Armen. Die führt dich schon irgendwie. Das ist alles. Das kann jeder. Das kann sogar Hannes, Mensch!« Das saß. Hannes war modisch auf einem ähnlichen Level wie ich, in Sachen Mädchen wohl auch, aber er hatte ein paar wichtige andere Aspekte vernachlässigt. Er trank weiterhin nur Apfelsaft und sagte nie etwas Lästerliches über seine Mitschüler, sondern versuchte einfach, dazuzugehören. Weshalb er eben nicht dazugehörte, sondern einfach als doofer Außenseiter galt. Und selbst der, das stimmte allerdings, selbst der schaffte es immer mal wieder, mit einem Mädchen zu schwofen, wenn dieses sich danach auch meist albern kichernd davonmachte. Aber immerhin.
Читать дальше