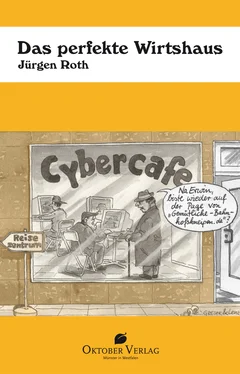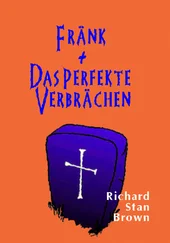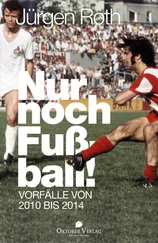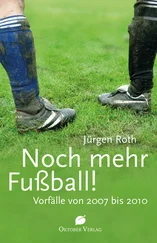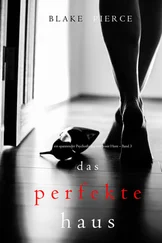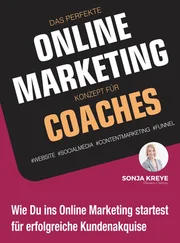Herr Tetzlaff sagte: »Hier muß mal saubergemacht werden.« Er wollte den halb versandeten Weg fegen, das war sicher eine gute Idee. Wir setzten uns aber bloß in den Sand. Der fühlte sich angenehm an, noch ein wenig erwärmt, und die nur angedeuteten Wellen wechselten sich sehr freundlich, ja irgendwie kommunistisch gesonnen ab in ihrem zwanglosen Herzu-und-Hinweg-Getue.
Es war eine klare Nacht, und irgendwann schaute ich in den Himmel, keine Ahnung, warum. Da standen unglaublich viele »schöne, helle, goldne Sterne« (Heinrich Heine). Das gefiel mir, ein wohliges Gefühl stellte sich ein. Da oben ihr, hier unten wir. Ätsch.
Es war, als hätte ich nie zuvor einen Sternenhimmel gesehen. Das ist natürlich Unfug. Aber hier, an der Ostsee, an einem Meer, das nichts von mir und, so glaube ich, für den Freund und Kollegen Tetzlaff sagen zu dürfen, nichts von uns wollte, an einem Meer, das sich nicht erhaben aufwarf und nicht schäumte und spuckte, hier leuchtete mir zum erstenmal ein, was der Königsberger Kant ans Ende seiner Kritik der praktischen Vernunft eigens fürs geflügelte Lexikon der Humanität hingeschrieben hatte: »Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.« Befriedung, Vernunft, Glück. Mag der Kosmos blöd sein, die Ostsee ist um so klüger.
Herr Tetzlaff erklärte mir dann die ganzen Sternbilder in ihrem sauber inszenierten »Schlummerleuchten« (Theodor Storm), den Großen Bären und den Großen Wagen, den Kleinen Wagen, den Polarstern und die Seeschlange. Das einzige, was zu diesen »Sternen wie Sand am Meer« (Barbara Häusler) und zu diesem Kant-Gedanken noch fehlte, war ein Rostocker Bier. Das haben wir aber auch noch gekriegt.
Das Plätschern, nein, das Gurgeln und Schnorcheln, das Sprotzeln oder eher Schwörlen des Wolgawassers bei nächtlicher Fahrt über den Spiegel des Wassers der Wolga ist schon – sehr schön. Auch schön ist der Brauch, in Samara am Mittellauf der Wolga Taxis dergestalt zu rufen und zu nutzen, daß man einen beliebigen Daumen raushält, daß umgehend ein Privat-Pkw stoppt, daß man das Fahrziel mit mehr als einem Daumen zu umschreiben versucht, daß man dem Fahrziel im Idealfall im Umkreis von fünf Kilometern nahekommt, daß man einen frei erfundenen Beförderungstarif entrichtet (Rückgeld gibt es nicht) und daß man dann läuft. Immer grob Richtung Wolga. Bis man, nur wenige Gehminuten vom Flußhafen entfernt, auf die Gastwirtschaft Auf dem Grund stößt.
Nichts schöner, als hier auf Grund zu gehen. Als hier abzutauchen, in aller russischen Ruhe vollzulaufen und schließlich abzusaufen. Dazu bediene man sich eines Getränks, das zu seligen Sowjetzeiten als der Inbegriff dessen galt, was man »Bier« nannte. Das hier verfertigte Schigulevskoje war eine Metonymie, eine mutmaßlich methylalkoholgeschwängerte.
Bereits unter Breschnew war das Bier als Volksernährungsmittel angepriesen worden, um dem Wodkawahnsinn ein moderates Narkotisierungsprogramm entgegenzusetzen, allerdings mit nicht unerheblichen geschmacklichen Fehlschlägen und Querschlägern. Gleichwohl, der Bedarf nach Bier = Schigulevskoje wuchs rasch, und die Schlangen vor den Kiosken nahmen die bei Vladimir Sorokin beschriebenen Ausmaße an. Da stand man, faltete aus Zeitungen trinkgefäßähnliche Auffangvorrichtungen, schüttete nach Aushändigung des Schigulevskojes das Schigulevskoje in sich hinein und stellte sich als armer Tropf mit tropfendem, aufgeweichtem Bierpapierbecher wieder hinten an. Wozu Zeitungen gut sein können!
Pivnaja hießen diese Ausschänke, und noch heute gibt es so eine Tränke neben dem roten Backsteingebäude der Schigulevskoje-Brauerei aus dem 19. Jahrhundert. Man lasse mithin die Brauereibar, die über den Haupteingang am Wolschki-Prospekt erreichbar und dem neureichen Geschwörl vorbehalten ist, scharf links liegen, schreite links um die Ecke und wohne dem Hausschanktreiben vor Auf dem Grund bei – dem Lungerleben mit Wolga- und komplementärem Wodkablick, dem Gewusel am Stockfischstand, dem diffusen Wartegebaren der Plastiksackträger, deren Einwegflaschen und Einmachgläser der Befüllung harren, und den sonstwie herumparkierenden Mannschaften, von denen vornehmlich jene überzeugen, die ihre Weibsbilder zum Putzen der Fensterscheiben verdonnern, während sie im Wageninneren ihre Schigulevskoje-Wodka-Tinkturen umnageln.
Im Auf dem Grund , in jener Lokalität, die in Gorkis Nachtasyl , das auf russisch nicht umsonst Auf dem Lebensgrund betitelt war, in ihrer früheren Topographie abgeschildert wird, kaut man zum betörend blonden Schigulevskoje von Wokano den prophylaktisch extrafetten Stockfisch, getrockneten, geräucherten und geflochtenen Käse sowie durstfördernd gesalzene, geröstete Brotwürfel Marke Kirijlschki oder Souchariki. Minderste Westradiomusik konkurriert mit der vorletzten Putin-TV-Rede, der Linoleumboden erwartet den ersten Erbruch, acht Bistrotische tragen allerhand Lasten, und eine Decke mit goldbeschlagaffiner Verzierung hält den Laden zusammen.
Zufrieden dreinschauende Mafiabosse der mittleren Ebene killen monströse Bierpokale, ein blau getäfelter Durchgang führt zum einzigen Gemeinschaftsklo oder in die Erdhölle. Und derweil einem beim Zermalmen der Brotwürfel die Backenknochen um die Ohren fliegen, ordert der Dicke nächst zur Toilettentür vier Weizen auf einen Schwung. Keine Minute später ist der Bestand halbiert – wie die Servietten, die Insignien der neuen Ökonomie.
Die »Strömung der Wolga«, sann Gorki, mache, »daß mein Denken lebhafter, schärfer wird«. Ein Bier im Abgrund Auf dem Grund tut’s aber auch.
Gegen Mitternacht zieht ein milder Nebel über die behaglich faule, durch allerlei in den fünfziger Jahren angelegte Stauseen zu derart artigem Müßiggang verführte Wolga. Auf dem Sonnen- respektive jetzigen Mondscheindeck blinken die erhobenen Gläser, und eine erschöpfte Bierflasche fällt um und rollt auf die Reling zu, als wolle sie dem drunten am Pier ertönenden frohgemuten Klimperspiel des Flaschengutes antworten.
Drunten, also gewissermaßen am Fuß des zirka dreihundert Passagiere fassenden und nach Georgij Shukow, dem Marschall der Sowjetunion, Heerführer der Roten Armee und späteren Verteidigungsminister benannten Flußkreuzfahrtschiffes, das unsereinen im Verbund mit einer dem Alter nach reifen Reisegemeinde von Kasan bis hinunter nach Astrachan am Kaspischen Meer schippert, immer zuverlässig brav tuckernd und ohne jede Andeutung von abenteuerlichen Überraschungen oder dräuenden Havarien – drunten also, wo uns die hölzerne Bordbrücke an Land und dort durch ein Spalier von schweigenden Menschen führt, die Stoffe, Bestecke, Batterien oder Kassetten verkaufen, da brummt und rappelt es richtig, bis in den Oktober hinein und dann spätestens ab Mai aufs neue.
Droben, wo die Reisegesellschaft mehr rechtschaffen schlapp denn aufgekratzt-fidel verweilt, zerschmilzt die Sonne am Horizont – wie eine Pfirsicheiskugel, die in ein aquarelliertes, glühend gelbes und aquamarinblaues Band zerfließt, als würden ihr die Prospekte der Tourismusbranche das vorschreiben. »Die Natur ist nie Kitsch«, bewundert manch einer zu Recht eine solche Anmutung, und doch zieht es einen nach unten. Abermals runter vom Schiff möcht’ man springen und hetzen hinein ins Gewusel und Gequirle.
Droben ist Natur, droben ist Tourismus, zu einem aparten Paar vereinen sie sich höchstens bei Einbruch der Dämmerung. Drunten ist, sobald unser Dampfer als das von der halben Stadt inklusive Brot, Bürgermeister, Salz und Trachtentruppe erwartete und jeden anderen im Hafen herumlungernden Rest- und Rostkahn zufriedenstellend überragende Symbol des Aufschwungs andockt, das Leben.
Beim buddhistischen Dahintreiben auf dem Fluß neigt sich die Wahrnehmung nach innen, sofern man das ewige, breite Fließen für ein Bild stiller Erhabenheit erachtet, das mythische Konnotationen transportiert. Es genügt indes genauso, einfach nur das sanfte, einnickende Ufer dahingleiten zu sehen und die Bezeichnung »Dampfer« als Euphemismus dingfest zu machen. Dampfen, brausen, rauschen tut’s wenige Schritte vom Pier entfernt.
Читать дальше