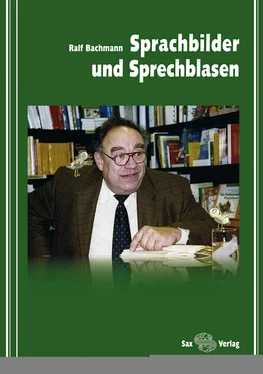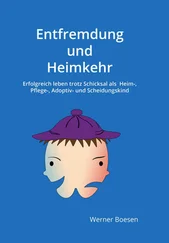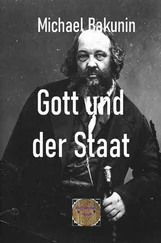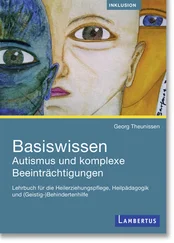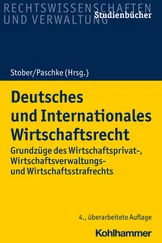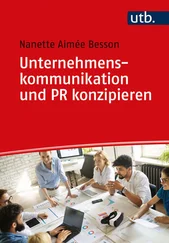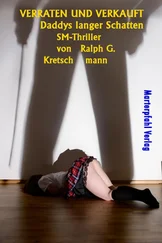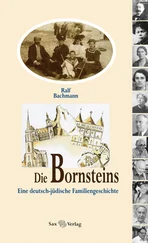(mocca faux = falscher Kaffee). Manches korrigierte das Leben, so wurde aus dem Billett das (englische) Ticket, das wiederum mit der Fahr- und der Eintrittskarte koexistiert. Die deutsche Sprache hat alles überlebt, nichts eingebüßt und sogar noch gewonnen.
Ohne Wortimporte weder Perestroika noch Schokolade
Ein knappes Drittel des deutschen Wortbestands hat einen Migrationshintergrund, wie man heute so korrekt wie unschön sagt. Manches importierte Wort ist ein Schmuckstück unserer Sprache geworden. Wer möchte schon auf Perestroika und Glasnost verzichten, die wir den Russen verdanken, auf den Tollpatsch, der aus Ungarn stammt, die Schokolade, der man Altmexiko nicht mehr ansieht, und gar die Hängematte, gegen die wohl nicht einmal die »Teutschgesinnten« etwas einwenden würden. Das, was sie bezeichnet, ist jedem bekannt. Aber wer weiß, dass die aufgehängten Schlafnetze eine Erfindung der Eingeborenen der karibischen Inseln sind, die von den nässe-, ratten- und mäusegeplagten Matrosen des Kolumbus vor 500 Jahren begeistert aufgegriffen wurde. Bei den Indianern hießen sie »hamaca« (in den karibischen Sprachen heute noch), die Holländer machten daraus zunächst Hangmac, was die Volkssprache der Logik wegen in Hangmat verwandelte. Nun blieb zur deutschen Hängematte nur noch ein Schritt. Ich gestehe gern, dass ich von alledem keine Ahnung hatte, bis ich die spannende Einsendung von Ulrich A. Schmidt aus Castrop-Rauxel im von Prof. Dr. Jutta Limbach herausgegebenen Buch »Eingewanderte Wörter« lesen konnte.
Zusammenfassend darf man für alle ängstlichen Gemüter konstatieren, unsere Sprache wäre arm ohne Griechen (Demokratie, Parallele, Patriot, Philosoph, Muse, Fantasie), Lateiner (Amulett, Zettel, Wein, Lokus, Tempo, Fenster), Italiener (Kredit, Giro, Mosaik, Posse, Adagio, Pizza, Kohlrabi, Trüffeln), Franzosen (Dessous, Pantoffel, Boutique, Resümee, Bonbon, Negligé, Rendezvous, Gourmet), Juden (Dalles, Massel, meschugge, Mischpoche, Schlemihl, beschickert), Russen (Sputnik, Datsche, Apparatschik, Kosmonaut, Wodka, dawai, nitschewo, in der DDR auch in der pikanten Variante Weltnitschewo), Türken (Sofa, Papagei, Tasse, Limonade, Fanfare, Spinat, Jogurt) und all die anderen. Mag mancher Politiker tönen, Multikulti sei endgültig gescheitert – die moderne deutsche Sprache atmet den Geist eines gesunden Multikultismus.
Sie wäre weltweit isoliert, würde sie auf die Anglizismen verzichten. Karl-Heinz Göttert spricht in seiner schon in Kapitel 1 zitierten Biografie der deutschen Sprache von einer Brückenfunktion des Englischen, sie sei eine »Lingua franca«, eine freie Sprache, geworden. Englisch verbindet als internationales Sprachwechselgeld die Kontinente und stellt in manchen Bereichen der Wissenschaft das dar, was früher Latein war. Göttert geht noch weiter. Er schreibt: »Englisch i s t das neue Latein.« Wer hätte die Chance, Computer durch elektronischer Tischrechner zu verdrängen, Link durch Verbindungsstück zu anderen Internetseiten, Laptop durch tragbarer Personalcomputer.
Auch im Zeitungsdeutsch kommt man ohne Anleihen bei Fremdsprachen nicht aus. So hieß es im Wissenschaftsteil einer Zeitung: »Die Simulation bestätigte, dass das Universum zu 70 Prozent aus ›dunkler Energie‹ besteht, einem mysteriösen Kraftfeld, dessen Struktur man noch nicht erfassen kann.« Wäre das klarer mit Nachahmung, Weltall, Antriebskraft, geheimnisvoll und Zusammensetzung? Es wäre nur deutscher. Der Sprache ist das egal. Sie hat kein Nationalgefühl. Wir sind nicht ausländerfeindlich, auch unsere Sprache nicht. Übrigens: Viele der übernommenen Wörter sind in Wahrheit Internationalismen. Und 80 Prozent der sogenannten Anglizismen wurzeln laut Göttert selbst im Griechischen, Lateinischen oder Romanischen.
Zum Orogasmusu nach Nippon
Wir sollten also, wenn wir gescheit sind, die fremden Sprachen vorbehaltlos nutzen, soweit sie Besseres als die eigene bieten. Wie aber ergeht es der deutschen Sprache jenseits der Grenzen, ohne die wärmende Obhut der Sachsen und der Schwaben? Das erwähnte Buch über Wortimporte hat einen Zwillingsbruder. Er heißt »Ausgewanderte Wörter« und bringt eine Auswahl aus 6000 Einsendungen und Belegen aus aller Welt zu einer Ausschreibung des Deutschen Sprachrates, bei der nach deutschstämmigen Wörtern in anderen Sprachen gefragt worden war. Das Lesen dieses Buches macht aus manchen Gründen Freude, nicht zuletzt, da es zeigt, dass unsere schöne Sprache kein Auslaufmodell geworden ist, nur weil man sich in allen Kontinenten vornehmlich des Englischen bedient. Herausgeberin Jutta Limbach bemerkt in einem Vorwort, die deutsche Sprache habe sich »mit ihren einfallfreudig zusammengesetzten Wörtern für andere Sprachen immer wieder als eine reichhaltige Fundgrube erwiesen«. Sie nennt als Beispiele solcher »Kombi-Wörter«, die sich in vielen Sprachen wiederfinden, Fingerspitzengefühl, Zeitgeist, Gratwanderung und Leitmotiv.
Wenn die meisten Einsendungen zu Deutschexporten aus dem englischamerikanischen und dem slawischen Sprachraum kommen, verwundert das kaum. Aber es gibt auch »exotische« Exempel. So ist es doch hübsch, auf Estnisch Lips für Schlips und Naps für Schnaps zu hören. In die westafrikanische Sprache Wolof hat man lecker übernommen. Und was könnte wohl aus unserer Sprache bis nach Japan gekommen sein? Nun zum Beispiel arubaito für Teilzeitarbeit, kirushuwassa für Kirschwasser, noirooze für Neurose und, siehe da, orogasmusu mit der gleichen Bedeutung, wie sie der eine oder andere von uns in Erinnerung hat.
Und nach Israel? Etwa Wischer (Mehrzahl: Wischerim) für Scheibenwischer, Schlafstunde für Siesta und Strudel für das @-Zeichen. Vigéc nennen die Ungarn die Hausierer. Die Redewendung »Was ist das« ist komischerweise zweimal ausgewandert, einmal nach Frankreich, wo es Dachfenster, Oberlicht, Türspion bedeutet, vielleicht eine Erinnerung an die auf der deutschen Rheinseite üblich gewesenen Guckfenster, durch die man vor dem Öffnen der Tür fragte: »Wer ist da? Was ist?« In der ungarischen Umgangssprache dagegen benutzt man es im Sinne von keine Kunst »Ez olyan nagy was-ist-das?«, wenn man fragen will: Was ist das schon? Ist das so schwer?
Auch wer was wo erfunden hat, erkennt man am Sprachgemisch. Wie es damit im Tschechischen aussieht, findet man in Lektion 12 des Kapitels »German for Sie«. Die Ukrainer trauen uns das feijerwerk zu, die Bulgaren den schteker, die Russen den schlagbaum und schtrejkbrechery , dazu buterbrody , rjukzak, galstuk (für Schlips / Halstuch), brandmauer (deutsch firewall), buchgalter und zejtnot (beim Schach). Für die Finnen sind wir der Prototyp des besservisseri und versessen auf kahvi paussi , für die Polen hochsztapler oder szlafmyca, womöglich gar im szlafrok , für die Serben štreber . Die Franzosen nennen einen Spaßvogel loustik , den Handball handball , Kitsch kitch und Nudeln nouilles , kennen aber auch le képi, le schnorchel, les neinsager und le waldsterben . Praktisch sind deutsche Wörter in der ganzen Welt kleben geblieben. In der südbrasilianischen Großstadt Blumenau saß ich im Lokal »Frohsinn« und fand zum Oktoberfest auf der brasilianischen (also portugiesischsprachigen) Karte Eisbein mit Sauerkraut. Man könnte einwenden, hier handle es sich um eine einst deutsche Siedlung. Jedoch Oktoberfeste, sznizil (das ist die türkische Schnitzelvariante), Kuchen, Zwieback, Kümmel und Schnaps kennt man wie Gneis und Zink, Nickel und Quarz auch anderswo, natürlich in unterschiedlicher Schreibweise.
In lederhosen zum beer fest
Читать дальше