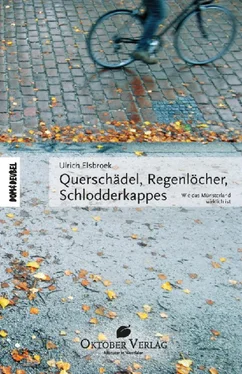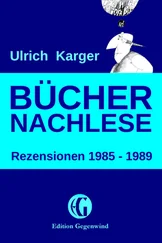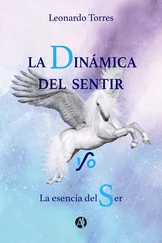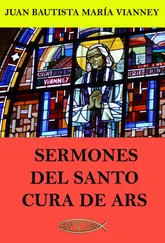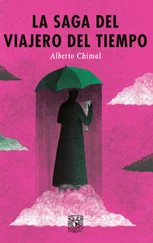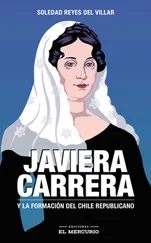Der auch Weking genannte Widukind verkleidet sich – so geht die Sage – nach den jahrelangen fränkisch-sächsischen Auseinandersetzungen als Bettler, um in das Lager der Franken zu gelangen. »Denn hier, meinte der königliche Bettler, könne er am unbeachtetsten den gepriesenen Karl schauen, wenn er in der Mitte seiner Helden und Gewaltigen aus dem Gotteshause trete. Als er nun, hart an die Pforte gelehnt, sich hinüberbiegt und hineinblickt in die geweihte Wohnung, da soll ihn vom Altare das Jesuskind angelächelt haben. Und hier, sagt man, sei ihm zuerst der Gedanke entstanden, auch wohl ein Christ zu werden. Als dann Karl heraustrat, ist ihm die hohe Gestalt und der gewaltige Gliederbau des fremden Bettlers aufgefallen, und er hat wohl geahnet, wer es sei. Weking aber ist in Frieden und in tiefen Gedanken zu den Seinen heimgekehrt.«
Man spürt sofort, dass hier zwei ganz Große sich auf den ersten Blick ganz doll lieb haben. Sie spiegeln einander ihre Ebenbürtigkeit und sehen, dass der einzige Unterschied zwischen ihnen der unterschiedliche Glaube ist. Aber das ist kein Nachteil. Es bedurfte geradezu dieses Gegensatzes, um dem christlichen Glauben insgesamt zum Sieg zu verhelfen. Hören wir hierzu noch einmal unseren Kartäuser Rolevinck, der nahezu enthusiastisch schreibt: »Den Ruhm, mein liebes Sachsenland, hast du Gott dem Allmächtigen zu verdanken, daß du von keinem anderen besiegt werden konntest als von diesem Manne! Niemand anders hätte dich läutern, bilden, im Glauben erleuchten und festigen können als der Fürst, der alle andern weit überragte an Macht und Reinheit, an Frömmigkeit und Edelmut, an Tapferkeit und Wissenschaft, an Gottesfurcht, Weisheit und Heiligkeit.« Das ist Hegel pur, weit vor Hegel: Widukind ist die fleischgewordene Antithese, die zur Verwirklichung des göttlichen Heilsplans unumgehbar notwendig gewesen war.
Zumindest in der idealisierten Form. In Wirklichkeit rumort es in unserem Gemüt seit jenem Tag im Jahre 785, an dem Widukind in Attigny zum Christenmenschen getauft wurde und mit ihm alle Westfalen den neuen Glauben annahmen. Denn eines liegt ganz offen zutage: Die münsterländische Seele ist ein Ort, dem weder mit der Fackel der Vernunft noch mit dem Zauberglanz des Glaubens beizukommen ist. Sie will immer nur selbst – von innen her – leuchten. Das ist der Kern unserer Querschädeligkeit. Deshalb haben sich die hegelschen Gegensätze in uns auch zu keiner höheren Einheit harmonisieren lassen.
Finden wir Spuren dieses Kampfes nicht auch in der Dichterin Seele, als sie begann, ihr »Geistliches Jahr« zu verfassen? So unterschiedlich und »schwankend in sich selbst« die Gedichte dieser Sammlung auch sind, so drücken sie doch eines immer wieder und in immer anderen Worten aus: erhebliche Glaubenszweifel. Es scheint, als tue sich hier jemand schwer damit, seinen münsterländischen Querkopf auszuschalten und die überlieferte christliche Lehre unhinterfragt anzunehmen. Das Ergebnis ist das mit sich kämpfende, also leidende Ich.
Ein Ich allerdings, das bei weitem nicht allein ist in seinem Kampf. Dies machen vier für das Gesamtkonzept der Gedichtsammlung äußerst bedeutsame Verse deutlich. Die junge Dichterin schreibt: »Meine Lieder werden leben, / Wenn ich längst entschwand, / Mancher wird vor ihnen beben, / Der gleich mir empfand.« Unsere Dichterin sieht sich mit ihren Glaubenszweifeln also nicht allein auf weiter Flur. Heute nicht und auch in unabsehbare Zukunft nicht, denn wie gesagt: »Meine Lieder werden leben, / Wenn ich längst entschwand.«
Damit ist der weitere Weg unserer Seele vorherbestimmt: Nie und nimmer wird sie je wieder zur Ruhe kommen. Beide – der altheidnische und der neuchristliche Münsterländer – kämpfen auch weiter ihren ewigen Kampf und werden ihn kämpfen bis ans Ende der Tage.
Von Gedichten und Wurstbändern
Münsterländisches Platt
Dass es sich bei uns alten Sachsen um einen Menschenschlag mit ganz eigenem Kopf handelt, musste auch die hochdeutsche Sprache höchstpersönlich erfahren. Als sie zwischen dem 6. und 8. nachchristlichen Jahrhundert von Süden her kommend ihren Siegeszug antrat und immer mehr deutsche Landstriche erfasste, kam sie eines Tages auch an unsere Grenze, sah uns und spürte instinktiv: Diesen sächsischen Querschädeln ein neues Sprechen beizubiegen, nein, einfach unmöglich. Diese mürrischen Gesichter, diese ungeübten Sprechwerkzeuge! Und so kehrte die hochdeutsche Sprache dem Münsterland den Rücken und kümmerte sich nicht weiter um uns. Fürs Erste.
Das war der Grund, warum wir mehr oder weniger einheitlich beim ›maken‹, ›Dag‹, ›eten‹, ›Timmermann‹, ›sitten‹, ›Schipp‹, ›Wiev‹ und ›Peper‹ geblieben sind, statt zu den hochdeutschen Formen ›machen‹, ›Tag‹, ›essen‹, ›Zimmermann‹, ›sitzen‹, ›Schiff‹, ›Weib‹ und ›Pfeffer‹ überzugehen. Aber auch von anderen liebgewonnenen Phänomenen konnten wir nicht lassen. Warum auch? Ist denn der ›Smiärlappen‹ nicht viel ehrlicher als der ›Schmutzfink‹, ist denn die ›Füörsterkunte‹ nicht viel stärker als der ›Frosthintern‹, reizt denn der ›Blubberbaort‹ nicht viel eher zum Lachen als der ›Nuschler‹, und hat die Formulierung, nach der jemand aus einem ›Fuorts en Düennerslag‹ macht, nicht mehr mit der norddeutschen Lebenswirklichkeit zu tun, als wenn dieser Jemand aus einer ›Mücke einen Elefanten‹ macht? Na also.
Die zitierten Begriffe dokumentieren zweierlei: Zum einen den enormen Erfindungsreichtum, wenn es darum geht, uns gegenseitig mit Komplimenten zu umschmeicheln. Zum anderen eine Besonderheit, die das westfälische Platt etwa vom ostfriesischen, holsteinischen oder mecklenburger Platt unterscheidet: die auffallende Anhäufung von Vokalen und Umlauten. Wörter wie »Mauenfrieerie«, »Quaogelerie«, »Uott« oder »Wuoddelbuil« versteht zwar niemand – aber mit Stolz können wir sagen: Das gibt‘s nur bei uns!
Das Niederdeutsche, das sich einmal von den Niederlanden bis nach Ostpreußen, vom Ruhrgebiet bis nach Dänemark erstreckte, hat also seine charakteristischen landsmannschaftlichen Unterschiede herausgebildet. Und wenn Sie jetzt vermuten, dass auch das westfälische Platt keine homogene Einheit bildet, sondern selbst schon wieder jede Menge Ausdifferenzierungen aufweist, dann kann ich nur sagen: Recht haben Sie! So verwandelt niemand anders den »g«-An- und Auslaut so formvollendet in den schroffen Reibelaut »ch« wie wir Münsterländer. Deshalb hört sich das normalerweise weich anklingende »Guat goan« – was soviel heißt wie: »Mach es gut« oder: »Lass es dir gut gehen« – bei uns wie ein im hinteren Rachenraum hervorgeraspeltes »chuat choan« an, das zuverlässig dafür sorgt, dass es einem danach alles andere als gut geht. Zumindest im Hals.
Es ist wirklich so: In dem vergleichsweise engen westfälischen Raum können wir Ihnen sage und schreibe vier Mundartgruppen anbieten: das Südwestfälische, das Ostwestfälische, das Münsterländische und das Westmünsterländische Platt. Ja, Sie haben recht gelesen: Allein das Münsterland weist zwei Varietäten auf. Damit leisten wir uns eine »Twiärsdriewerie« (Quertreiberei), die unseren Alltag auf unverantwortliche Weise erschwert. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Ein ehrlicher, grundsolider Coesfelder Bürger fährt in die gut 30 km entfernte westmünsterländische Stadt Borken zum Shoppen. Nichts Böses ahnend sieht er mit einem Male, wie jemand einen Juwelierladen ausraubt. Mit dem festen Willen, diesen Dieb mit Hilfe der anderen Passanten dingfest zu machen, ruft er laut aus: »‘n Daiw, ‘n Daiw!« Ich garantiere Ihnen, die Einheimischen – und möglicherweise auch der Ganove selber – werden gar nicht verstehen, was dieser Mann eigentlich von ihnen will, weil sie einfach nicht wissen, dass der münsterländische »Daiw« identisch mit dem westmünsterländischen »Deew« ist. Denn hätten sie es gewusst, hätten sie – da bin ich mir ziemlich sicher – garantiert dabei mitgeholfen, die Versicherung des Juweliers vor großem finanziellen Schaden zu bewahren.
Читать дальше