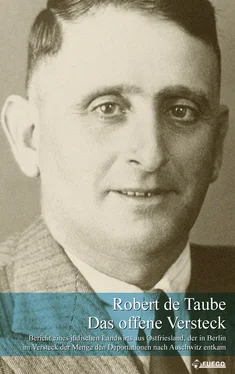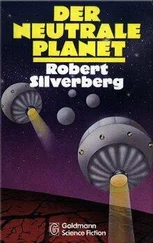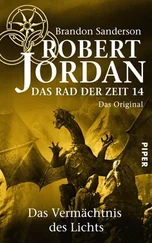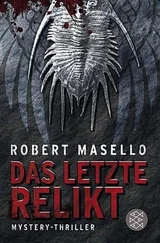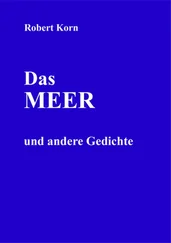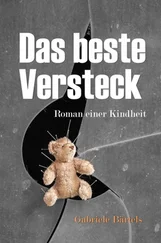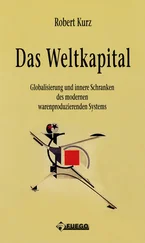VI. Emigrationsbemühungen
Die aus dem KZ Sachsenhausen entlassenen Brüder Ernst, Robert und Kurt de Taube mussten in regelmäßigen Abständen ihre Ausreisebemühungen persönlich bei der Gestapo nachweisen. Bereits im Dezember 1938 unternahmen sie den Versuch, in die USA auszuwandern, da hierzu in einem gewissen Maße landwirtschaftliche Vorerfahrung nützlich sein konnte. Zertifikate zum Nachweis landwirtschaftlicher Tätigkeit zur Vorlage beim Konsulat in Bremen stellten u.a. der Oldenburger Landesrabbiner Leo Trepp und ausgerechnet der genannte Kreisbauernführer Erich Reents aus. 16Das Ziel USA zerschlug sich für die Brüder de Taube vermutlich deshalb, weil dort keine Fürsprecher die nötigen Bürgschaften leisten konnten.

Rosa und Samuel de Taube (vorne) mit Recha und Robert Pohl 1940 in Birmingham
(© Sammlung Pohl, Lexington, Kentucky)
Ganz anders sahen die Chancen in England aus. Dr. Robert Pohl, den die ältere Schwester Recha nach dem Tod ihres ersten Ehemanns Max Heymann in zweiter Ehe geheiratet hatte, war von 1906 bis 1919 bei English Phoenix Dynamo in Bradford, Yorkshire, beschäftigt gewesen. Er besaß zur britischen Insel zahlreiche alte Kontakte sowie neue, die er - bis zu seiner Entlassung durch die Nationalsozialisten - durch das Prestige eines Chefingenieurs der AEG Turbinenwerke in Berlin bekam. Den 1912 geborenen Stiefsohn Horst Heymann hatte er 1927/28 eine Quaker-Schule in England besuchen lassen. Horst brach 1933 sein wegen der nationalsozialistischen Berufsverbote zwecklos gewordenes Studium an der Technischen Hochschule Darmstadt ab, ging zusammen mit seiner späteren Ehefrau Edith Marcuse nach Birmingham und schloss dort mit Hilfe der Freunde von Robert Pohl die Ausbildung zum Elektroingenieur ab. 17Robert und Recha Pohl folgten nach einer sorgfältigen Planung im Juni 1938. Ihr gemeinsamer Sohn Walter besuchte bereits seit April 1937 ein Quaker-Internat in Somerset.
Auf der Basis dieses familiären Netzes fanden Samuel und Rosa de Taube am 25. August 1939 in Birmingham bei den Pohls Aufnahme. Das war eine Woche vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, des Luftkriegs mit England und dem Ende der Emigration dorthin. Die Pohls mussten für das jetzt mittellose alte Ehepaar aufkommen und, da die eigene Wohnung begrenzt war, sie in einem Boarding House in der Nähe unterbringen. Samuel de Taube berichtete 1946, wie am späten Abend des Tages vor der Abreise der protestantische Pastor und seine Ehefrau in das Gutshaus kamen, um ihr Entsetzen und Mitgefühl über das Geschehen auszudrücken. Seine Gemeinde sei so „verseucht“, dass sie es nur nachts wagen könnten, Abschied zu nehmen. „Unser und Ihr Gott lebt und wird Euch segnen. Er wird Gerechtigkeit und Anstand zurückkehren lassen.“ 18
Mit Kriegsbeginn fiel England als mögliches Emigrationsland aus. Kurt schaffte im Februar 1940 die Ausreise in das zu diesem Zeitpunkt letzte Gebiet, das überhaupt noch Flüchtlinge aufnahm – Shanghai. Robert de Taube bemühte sich 1940, jetzt schon von Berlin aus, nach Australien und Bolivien zu kommen und lernte Spanisch und Englisch – vergebens. Ab April 1940 war die Tür aus Deutschland zu und der Völkermord an den europäischen Juden begann im Jahre darauf. Ernst de Taube und seine Ehefrau Frieda wurden 1943 von Berlin nach Auschwitz deportiert - ein Schicksal, das Robert de Taube für sich abwenden konnte.
VII. Robert de Taube in Berlin 1940 bis 1945
Mit Beginn Ende Januar 1940 organisierte die Geheime Staatspolizeistelle in Wilhelmshaven die Vertreibung der Juden in ihrem Zuständigkeitsbereich, d. h. dem Land Oldenburg und dem preußischen Regierungsbezirk Aurich (Ostfriesland). Begründet wurde die Aktion mit dem angeblich „weiterhin frechen Auftreten der Juden“, der „Gefahr“ jüdischer Spionage oder Sabotage in der „Grenzzonenregion“ Weser-Ems oder auch mit der Wohnraumbeschaffung für „deutsche Volksgenossen“. Mit solchen Sätzen hatten einige Landräte und Bürgermeister der Region schon seit Kriegsbeginn im September des Vorjahres darauf gedrängt, ihre Bezirke endlich „judenrein“ zu machen. Allerdings konnte die anfänglich betriebene Deportation in das okkupierte Polen nicht beim Reichssicherheitshauptamt durchgesetzt werden. 19
Betroffen von der Vertreibung waren fast alle im Gebiet lebenden jüdischen Männer und Frauen. Ausgenommen blieben nur die in christlich-jüdischer „Mischehe“ lebenden jüdischen Partner sowie zunächst die Bewohner der beiden jüdischen Altenheime in Emden und Varel. Alle anderen wurden zu Einzelgesprächen direkt bei der Gestapo am Rathausplatz von Wilhelmshaven, wie Robert de Taube und seine Brüder, oder auf die Landratsämter und Rathäuser vorgeladen. Innerhalb weniger Wochen hatten sie sich unter Androhung der Verschleppung in ein Konzentrationslager eine neue Unterkunft in Großstädten außerhalb der Weser-Ems-Region zu suchen. Im Unterschied zu den im Herbst 1941 beginnenden Sammeldeportationen deutscher Juden nach Osteuropa konnten die Opfer hier noch selbst eine gewisse Auswahl des Vertreibungsziels treffen. In der Praxis beschränkte sich das allerdings meist auf den Unterschlupf in „Judenhäusern“ von Berlin oder Hamburg, den die örtlichen jüdischen Gemeindevertretungen zuwiesen. Da lediglich einzelne Zimmer bezogen werden konnten, blieb keine andere Wahl, als fast das gesamte verbliebene Hab und Gut zurückzulassen oder es bestenfalls unter Wert eiligst zu verkaufen.
Robert de Taube ging im März 1940 nach Berlin. Ende 1941 überstand er durch die Simulation eines Rückenleidens in dem katholischen St. Hildegard-Krankenhaus die erste Deportationswelle Berliner Juden nach Osteuropa. Danach hatte er 14 Monate Zwangsarbeit in einer Kreuzberger Fabrik zu leisten, weil den Nationalsozialisten wegen des Krieges die Arbeitskräfte auszugehen drohten. Im März 1943 entschied er sich nach der überfallartigen Deportation seines Bruders Ernst und dessen Ehefrau nach Auschwitz, die auch ihn getroffen hätte, wenn er nicht vorher gewarnt worden wäre, in den Untergrund zu gehen und irgendwie zu überleben. Nach schwierigen Anfängen auf der Straße und in kurzfristigen Unterschlupfen schuf sich Robert de Taube eine Art offenes Versteck, ein Netzwerk verschiedener Adressen und Tätigkeiten. Er fuhr als „August Schneider, Landschaftsgärtner aus Hamburg“ mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Papiere kreuz und quer durch Berlin und die Peripherie bis hin zur rund 50 Kilometer entfernten Spargelregion Beelitz. Er handelte mit Gemüse, Obst und Kleidungsstücken, arbeitete als Gärtner und Hausmeister und lebte nacheinander und manchmal gleichzeitig unter einem Dutzend Berliner Adressen. Ausgerechnet im noblen Villenviertel von Grunewald, bei der reichen Witwe Hanna Sotscheck-Cassirer, fand er seine beste Bastion. Als Gärtner machte er den vom namhaften Landschaftsarchitekten Georg Belá Pniower gestalteten Nachbargarten für die Erfordernisse der Kriegswirtschaft tauglich. Wegen seiner beruflichen Fähigkeiten und seines offensichtlichen Charmes hätte er im Zeichen des kriegsbedingten Männermangels in verschiedene Familien des ländlichen Umlands einheiraten können. Ohne nichtjüdische Unterstützer und ohne fast unglaublich großes Glück hätte er aber nicht überlebt. Mehrfach entkam er nur knapp den Häschern der SS und den Bomben der Alliierten, die die Reichshauptstadt in Schutt und Asche legten. Im September 1945 kam er nach einer einzigartigen Odyssee durch den Untergrund der untergetauchten Juden und parallel durch die arrivierte Berliner Gesellschaft und nationalsozialistische Bauernfamilien zurück nach Wilhelmshaven.
Читать дальше