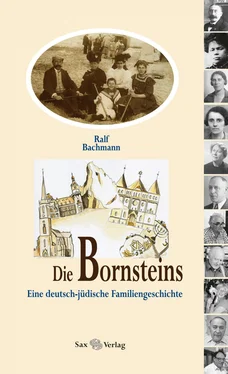Anzeige aus dem Falkensteiner Adressbuch, 1907
Wenig zart spielte er auch dem Schmied, der zu seinem Stammtisch gehörte, bei einem gemeinsamen Berlin-Ausflug mit. Für Falkensteiner war ein Besuch in Berlin etwas Großes, und Opa Max wollte dem wohl noch die Krone aufsetzen, als er sie ins Hotel »Adlon« führte, dieses stinkfeine Haus mit dem Duft der großen weiten Welt und dem etwas aufdringlicheren der Halbwelt. Man setzte sich dort an einen Tisch im riesigen Restaurant mit den glatten Marmorfliesen, bestaunte die mondäne Garderobe und das extravagante Auftreten der Hautevolee der Reichshauptstadt, nippte an Kaffee oder Bier und fühlte sich sehr unsicher in der fremden, unheimlichen Umgebung. Mein Opa tat so, als ob er einmal für kleine Jungs müsse, flüsterte aber heimlich dem Oberkellner etwas ins Ohr und legte ihm ein Geldstück in die Hand. Bald wurde über »Hausfunk«, dessen ehrfürchtig verfolgte Durchsagen bis dahin dem Herrn Rittmeister und wirklichen Geheimen Rat von Sternberg, dem Herrn Akademiepräsidenten Prof. Dr. von Stubenrauch und der Operettensängerin Fräulein Fritzi Massary galten, ausgerufen: »Der Herr Schmied aus Falkenstein möchte bitte sofort zu Hause anrufen. Das Schmiedefeuer ist ausgegangen.« Der aus seiner Anonymität Gerissene lief puterrot an, schlurfte, alle Blicke auf sich ziehend, erschrocken über die Fliesen in Richtung Rezeption und merkte den Schwindel erst am schallenden Gelächter der Mitgereisten, die inzwischen Mitverschwörer und froh waren, dass es sie diesmal nicht getroffen hatte.
Jüngst kam mir noch eine andere Episode zu Ohren. Onkel Max fuhr mit Schwager Julius im Zug nach Leipzig. Der hatte die Gewohnheit, im Coupé als Erstes die Schuhe auszuziehen und als Zweites einzuschlafen. Als er dieses Stadium erreicht hatte, nahm Opa einen der Schuhe und band ihn außen an die Abteiltür. Vor Leipzig weckte er Julius auftragsgemäß. Der suchte vergeblich nach dem fehlenden Schuh. Großvater wusste natürlich von nichts. Aber der Schwager reagierte auf nicht erwartete Art. Er nahm den verbliebenen Schuh, öffnete das Fenster, warf ihn hinaus und zürnte: »Dann brauche ich den auch nicht mehr.« Spätestens beim Aussteigen dürfte er das bitter bereut haben. Vielleicht hatte er wenigstens zwei Paar Socken an. Opa besaß nach eigener Aussage nur ein einziges und begründete das mit dem überzeugenden Argument: »Was brauche ich zwei Paar Socken, wenn ich nur ein Paar Füße habe.«
Opa Max tat auch viel Gutes. Seine Kinder hatten durch seine Großzügigkeit eine solide Pensionatsbildung und verdankten ihm den besten Start ins Leben. In den Erinnerungen der Alten, mit denen ich sprach, die es aber auch nur von ihren Eltern wussten, spielten erlassene Raten und geschenkte Schuhe eine Rolle, wurde er ein Wohltäter genannt. Aber wie das so ist, von seinen Streichen war zu Hause oft, davon aber nie die Rede.
2. Kapitel
Aus dem Führer-Depot ins Musée d’Orsay
Die Geschichte eines Makart-Gemäldes oder: Wo man dem Abschiedsgruß der Lewins in Paris begegnet
Das Museum Orsay in der Rue de Lille ist eines der jüngsten in der französischen Hauptstadt. Erst 1986 wurde der Umbau eines schmucken Belle-Époque-Bahnhofs an der Seine in eine faszinierende moderne Bildergalerie abgeschlossen. Aber meine Cousine Ruth, die beste Fremdenführerin für Kunstliebhaber rund um Notre-Dame, pflegte zu sagen: Wer dieses Museum versäumt hat, dem bleibt wohl nichts übrig, als seinen Parisbesuch zu wiederholen. So führte sie meine Frau und mich gleich bei unserer ersten gemeinsamen Visite in der Metropole des Nachbarlandes dorthin, und wir sind ihr aus mehr als einem Grunde bis heute dankbar dafür. Nirgendwo sonst – den Louvre nicht ausgenommen – findet man die Werke der französischen Impressionisten in solcher Fülle und Vollständigkeit wie im Musée d’Orsay, nirgendwo hat man so viele beglückende Wiederbegegnungen mit alten Bekannten aus dem Schaffen von Manet und Monet, Renoir und Pissarro, aber auch von Cézanne und Gauguin, van Gogh und Toulouse-Lautrec wie in diesem auf die Zeit von 1848 bis 1914 beschränkten Musentempel mit dem gläsernen Bahnhofsdach.
Acht Meter Makart und eine Störung der Museumsordnung
Das Wirken des österreichischen »Malerfürsten« Hans Makart, der zwar kein Rembrandt war, aber mit Rubens zumindest die Vorliebe für pralle weibliche Rundungen teilte, fällt zwar in jenen Zeitraum, doch es ist wohl eher ein Zufall, wenn ihm in einem so französisch geprägten Museum auch ein Platz eingeräumt wurde. Nur diesem Zufall ist es zu verdanken, dass das Orsay in meine Sammlung deutsch-jüdischer Plaudereien geriet. Und dieser Zufall führte auch dazu, dass ich die Museumsordnung mit einer Blitzlichtaufnahme und die Museumsruhe – soweit man davon bei einem ununterbrochenen Strom zehntausender Besucher sprechen kann – durch einen Aufschrei störte. Es geschah beim Anblick der »Abundantia«, wie ich inzwischen weiß die römische Göttin des Überflusses. Das ist ein Gemäldepaar von über acht Metern Länge: vier Meter »Die Gaben der Erde« und vier Meter »Die Gaben des Meeres«. Da rief ich zwar unoriginell, aber absolut spontan und lauthals: »Ja kann denn das wahr sein?« Unter den »Gaben des Meeres«, einer Gruppe üppiger Damen mit Kindern, Netzen und Meeresfrüchten, zu deren bräunlich getönten Farben als Blickfang der nackte Rücken einer der Fischerinnen kontrastiert, hatte ich in meiner Jugend so manche Mußestunde verbracht und mich in schlüpfrigen Träumen als Gespiele der wohl nicht nur Fische fangenden Schönen gefühlt. Das Bild über der Couch in unserer Stube war freilich kleiner, eine Kopie, nach Ansicht von Kunstkennern die beste, das Werk eines jüdisch-ungarischen Malers namens, wenn ich nicht irre, Boris Birnenbaum. Der Weg des Originals ist eine wahrhaft dramatische Geschichte, das Schicksal der Kopie nicht minder.
Im vornehmen Leipziger Musikviertel lebte ein schon altes, ehedem sehr wohlhabendes jüdisches Ehepaar namens Lewin, das sein Leben und sein Vermögen dafür angelegt hatte, kenntnisreich Werke der Malerei zu sammeln, die nun dicht an dicht alle Wände ihrer Wohnung bedeckten. Meine Mutter kannten die Lewins aus früheren Zeiten, als sie noch die Bornstein Hertha war. Sie gehörten wohl zu einem Zweig jener Familie Lewin, in die Rosa, jene Schwester meines Großvaters eingeheiratet hatte, die gemeinsam mit ihrem Mann Paul Lewin das Geschäft in Falkenstein übernahm.

Die Gaben des Meeres (Ausschnitt)
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mit den Lewins jemals Kontakt hatten, bis es zu jenem Besuch kam, der der erste und der letzte zugleich werden sollte. Als das Kunstsammlerehepaar 1943 die Aufforderung zum »Transport« erhielt, beschloss es, nicht auf den deutschen Tod im Auschwitzer Gas zu warten, sondern den Zeitpunkt vorzuverlegen und damit selbst zu bestimmen. Vorher wollten die beiden gern wenigstens ein paar der Kunstwerke vor dem Zugriff der Nazis bewahren. So fragten sie meine Mutter – in aller Vorsicht aus einer Telefonzelle –, ob sie nicht, es sei die letzte Gelegenheit vor ihrer Abreise, an diesem Abend einmal zu ihnen kommen könnte, um ein Geschenk entgegen zu nehmen.
Doch es hätte praktisch Selbstmord bedeuten können, wäre sie als Jüdin, die ohnehin nur dank ihres nichtjüdischen Mannes noch nicht den gleichen Weg vor sich hatte, der Einladung gefolgt. So einigte man sich schnell auf meinen älteren Bruder und mich. Uns als »Mischlingen« konnte nicht viel passieren. Lewins empfingen uns still, aber freundlich. Lange erzählten sie uns ganze Essays über den Lebensweg von wertvollen Bildern aus ihrem Besitz und machten uns auf deren Besonderheiten aufmerksam. Dass sie beschlossen hatten, ihrem Leben unmittelbar nach unserem Besuch ein Ende zu setzen, ließen sie uns weder merken noch wissen.
Читать дальше