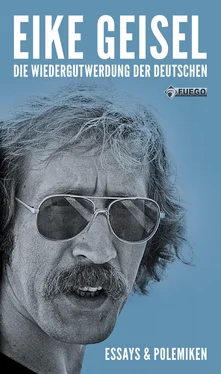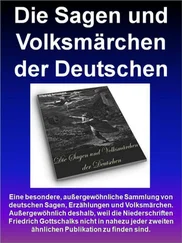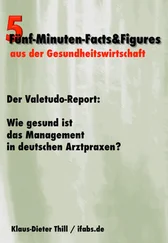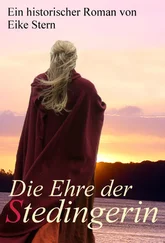1 ...6 7 8 10 11 12 ...23 Die Wiedervereinigung mit der deutschen Geschichte ging dem nationalen Zusammenschluss voraus. Für die historische Versöhnung hatte man die Juden noch gebraucht. Mit der im November endgültig und unwiderruflich vollzogenen Verwandlung der beiden deutschen Staaten in die, wie sich rasch zeigen sollte, völkische Einheit Deutschland, waren hingegen die im letzten Jahr so ausgiebig gefeierten Juden als Seelentröster ganz entbehrlich geworden.
Aus der schon immer an Israel, dem beliebtesten Tummelplatz deutscher Selbstentlastung, gewonnenen Einsicht, es sei niemand besser als die Deutschen, machte der Herausgeber des Spiegel Rudolf Augstein einen aktuellen kategorischen Imperativ: »Warum ein geteiltes Berlin, wo doch für Jerusalem trotz aller ethnischen- und Annexionsprobleme gelten wird: Zweigeteilt? Niemals«, schrieb er am 6. November 1989, als käme er aus einer jenseitigen Redaktionskonferenz Axel Springers zurück, der dies fast wörtlich vor über zwanzig Jahren geschrieben hatte. Um jedoch Verwechslungen mit dem vergleichsweise gemäßigten Chauvinismus der Bild- Zeitung auszuschließen, fügte Augstein noch folgenden Satz hinzu: »Dies falsche Gewicht wird die junge Generation, weil das nämlich nichts mit Auschwitz zu tun hat, nicht mehr mittragen.« Mit anderen Worten: es sollte niemand etwas tun dürfen, was den Deutschen untersagt ist, schon gar nicht die Juden.
Andere Zeitungen ersparten sich den langen Umweg über Israel und wiesen mit je nach Klientel verschiedenen Andeutungen darauf hin, dass jener flüchtige Staatssekretär der DDR, der nicht so muffig und spießig gelebt hatte wie seine nun vom volksgemeinschaftlichen Sozialneid heimgesuchten Landsleute, dass jener Mann, der Devisen in die Schweiz geschafft hatte, Jude sei. Mit einem catch-word des stalinistischen Judenhasses rüstete die taz das Ressentiment ihrer antifaschistischen Leserschaft auf und teilte unter der Überschrift »Die Biografie eines Kosmopoliten« mit, dass auch ein Mitarbeiter des Devisenhändlers nun völkisch identifiziert worden war. »Wir sind das Volk« skandierten unterdessen diejenigen, die bloß gern wie die geschassten Funktionäre im schäbigen Neckermann-Luxus daheim wären. Und der DDR-Staatssekretär Schalk-Golodkowski wußte, als er sich absetzte, dass man besser die Koffer packt, wenn in Deutschland sich die Bevölkerung in das Volk verwandelt. Er wollte nicht jenen in die Hände fallen, die über Nacht aus Mitläufern zu einer nach Ermittlungskommandos gegliederten Volksgemeinschaft geworden waren.
Wie es zum Selbstbild der bundesrepublikanischen Gesellschaft gehört, die Deutschen seien das erste Opfer Hitlers und die Nachkriegsgesellschaft eine Vereinigung von Hinterbliebenen gewesen, so präsentierte sich die Bevölkerung der DDR vom untersten Volkspolizisten bis zum höchsten Parteifunktionär als allesamt von ein paar Schurken betrogene Idealisten. Und natürlich hatten alle von nichts gewusst. Mit diesen Auskünften war auch dem letzten Zweifler im Westen klar, nicht, dass hier jemand seine sofortige Entmündigung verlangte, sondern dass es sich bei dem Mob, der nun zur Parole »Deutschland einig Vaterland« überging, tatsächlich um die eigenen Brüder und Schwestern handeln musste. Und gerade dieser Nähe wegen werden sie sich, wenn die Familienfeier erst einmal vorüber ist, auch künftig nicht ausstehen können.
Einer mit ganz ausgeprägtem Familiensinn in diesen bewegten Tagen war der Schriftsteller Martin Walser. Seit er an der Teilung Deutschlands litt, genas seine Literatur zusehends. Und die völlige Wiederherstellung seiner Gesundheit vermeldete er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit einem schwärmerischen Lobgesang auf die Medizin: »Es gibt das Volk, das ist jetzt bewiesen.« Bewiesen war freilich nur, über welche Klarsicht die Nazis damals verfügten mit der Aufforderung: »Nun Volk steh auf und Sturm brich los!« Nun stand ein Begriff auf, und als die Sache losstürmte, wollten viele den Anschluss nicht verpassen. Auch die Grünen nicht. Ganz so, als sei dieser Begriff zwischenzeitlich nur eingemottet gewesen und habe etwas Staub angesetzt, holte ihn Joschka Fischer frischgebügelt aus der historischen Tiefendimension hervor: »Zum ersten Mal auch seit der blutigen Niederschlagung von 1848 hat der Begriff ›Volk‹ wieder einen guten, einen aufrechten Klang«, blochte er in der taz . Dieser »gute, aufrechte Klang« hallte wieder in den »Rote raus!«-Parolen der fundamentalistischen Montagsumzüge in Leipzig; er hallte wieder in den Schlägen, mit denen die vom Parteimitglied zum Volksgenossen aufgestiegenen Befehlsempfänger ihrer inneren Stimme nun Ausländer malträtierten; er hallte schließlich wieder im Geräusch umstürzender Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen – einer Morgengabe, auf welche noch keine deutsche Volksbewegung verzichten wollte.
Dabei hätten die Deutschen doch Grund genug, gerade den Juden für den erfolgreichen Abschluss ihrer nationalen Selbstfindung dankbar zu sein. Noch im letzten Jahr hatten sie sich in zahlreichen Ausstellungen, im Radio und im Fernsehen, in Geschichtswerkstätten und in neu gegründeten jüdischen Museen über die Toten hergemacht. Je heftiger sie sich mit jüdischen Toten beschäftigten, desto lebendiger wurden sie selbst. Je gründlicher sie erforschten, was jüdisch sei, desto fundamentaler erfuhren sie sich als Deutsche; kurz: am 9. November 1989 wurde ein kollektives Bedürfnis befriedigt, das der manischen Beschäftigung mit den Juden logisch von Anbeginn zugrunde lag. Seit alle wieder Deutsche sind, müsste es deshalb bei ihnen in unbefangener Umkehrung eines alten Grundsatzes nationaler Selbstvergewisserung heißen: »Die Juden sind unser Glück.« Denn was wäre ohne sie aus der Endlösung der deutschen Frage geworden?
1989
Jede Untat hat auch ihre guten Seiten. Der Dieb stiehlt, damit wir das Privateigentum verteidigen, der Mörder mordet, damit wir das Gewaltmonopol des Staates anerkennen. Jedes Laster verweist auf die Tugend: ohne Verbrechen also keine Moral. In den Zustand dieser prästabilierten Harmonie von Gut und Böse ist mittlerweile auch die jüngere deutsche Geschichte aufgestiegen, nachdem allgemein anerkannt ist, »dass Deutschland der Welt viel mehr geschenkt hat als Auschwitz je kaputtmachen könnte« (Schönhuber). Schließlich: ohne Hitler kein Staat Israel, ohne die Vertreibung keine Exilforschung und ohne die Vernichtung der Juden keine Woche der Brüderlichkeit.
Vor dem Hintergrund dieser neuen Ausgewogenheit, die von einem hauptamtlichen Geschichtsverwalter mit der ansprechenden Dienstbezeichnung »Leiter des Referats ›Gedenkstätten‹ in der Berliner Senatskanzlei« als »eine erwachsene Form nationaler Identitätssuche« bezeichnet wurde, ist der Enthusiasmus zu sehen, welchen gegenwärtig eine Ausstellung der Berliner Festspiele auslöst: ohne deutschen Lebensraum keine »Jüdischen Lebenswelten«. Die gigantische Ausstellung im Gropius-Bau wird flankiert von einer Reihe weiterer Ausstellungen in der Akademie der Künste, auf dem jüdischen Friedhof Weißensee und im Haus der Wannseekonferenz. Und wer alle dazugehörigen Führungen, Konzerte, Theater- und Filmveranstaltungen, Vorträge und Lesungen besucht, wird dann bis Ende April wahrscheinlich den Zustand geistiger Verwirrung erreicht haben, den der Berliner Kultursenator schon im Januar bei der Eröffnung einer Ausstellung an den Tag legte, als er sich nicht zu entscheiden wußte, ob die Nazis nun besiegt worden waren, abgetreten sind oder einfach »Tschüss« gesagt haben. Er entschied sich dann doch für: abgetreten.
Während des Historikerstreits hatte der Kanzler ein Machtwort gesprochen: die deutschen Verbrechen seien unvergleichlich und einzigartig. Sein feinsinniger Vorgesetzter Weizsäcker übernahm nun die Schirmherrschaft über die »Jüdischen Lebenswelten«, eine andere Spitzenleistung, nach der es ohne die vorausgegangene kein Bedürfnis gegeben hätte. Vor fünfzig Jahren hatten die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten Millionen von Juden aus aller Herren Länder ordentlich eingesammelt und fürsorglich umgebracht. Zum Jubiläum wurde, wie es anerkennend in der linken Wochenzeitung Freitag hieß, der Versuch gemacht, was übrig geblieben war, »praktisch wieder einzusammeln«. Auf 4500 Quadratmetern sind fast 2500 Objekte von über 300 Leihgebern aus aller Welt zu sehen, eine Meisterleistung, auf die Festspielintendant Eckart besonders stolz ist: »... die bedeutendste Ausstellung von Handschriften, die es weltweit je gegeben hat«. Man gedenke mit dieser Ausstellung auch »des versuchten Völkermordes der deutschen Reichsregierung an den europäischen Juden«, fährt er im Geleitwort des Katalogs fort in der Gewissheit, dass versuchter Völkermord strafbar, aber eine derartige Bemerkung über den Dilettantismus der Nazis ungeahndet bleibt. Ohne die Todeslager keine »Jüdischen Lebenswelten«. Die Aufeinanderfolge gehorcht dem deutschen Grundsatz: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst wurden die Juden bürokratisch vernichtet, jetzt werden sie gefühlig veredelt. Die niederen Instinkte, von denen die pflichteifrigen Normalvergaser bei ihrer Dienstausübung ja gar nicht getrieben wurden, kommen erst fünfzig Jahre später und als erhebende Gefühle zutage. Insofern sind die Deutschen erst nach Auschwitz zu Rassisten geworden, die ihren psychischen Haushalt mit der vergleichsweise ungefährlichen postmortalen Sonderbehandlung der Opfer regulieren.
Читать дальше