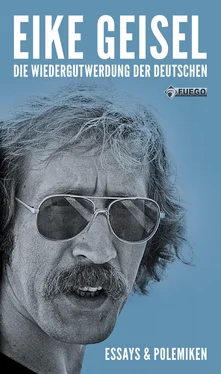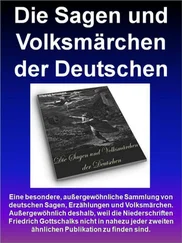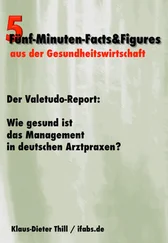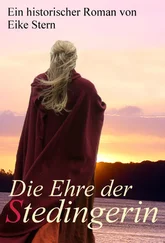Doch auch in Hamburg wollte man sich in der Tradition des linken Rituals nur wechselseitig versichern, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Dabei weiß jeder, dass es Linke gibt, die ihre Frau verprügeln oder ihre Kinder quälen, dass sie, wenn möglich, die Arbeitskraft anderer ausbeuten; dass Linke gelegentlich ihre Freunde an Geheimdienste verraten und sie manchmal sogar umbringen. Warum in aller Welt sollte es deshalb nicht auch linke Antisemiten geben?
Das Thema der Gewerkschaftsveranstaltung war aber nicht in diese schon hundertfach beantwortete Frage gekleidet. Es hieß »Antisemitismus oder berechtigte Kritik an Israel?« Schon die Formulierung verriet die Konfusion, oder vielmehr die verdrückte, verschämte Absicht. Denn logisch kann das Bindewort »oder«, das eine Alternative ankündigt, kein Fragezeichen nach sich ziehen. Standen die Lehrer also vor der Wahl, sich für Antisemitismus oder Kritik zu entscheiden?
Doch mit der Frage war auch schon die Antwort angedeutet. Das Beiwort »berechtigt« sollte, was sich für Kritik hielt, moralisch salvieren und gegen den Einwand, es gehe vielleicht antisemitisch dabei zu, unanfechtbar machen. Kritik freilich bedarf keiner Berechtigung. Wenn sie sich diese eigens bestätigt, hat sie sich bereits dementiert und in Gesinnung verwandelt. Kritik kann jeder an jedem und können alle an allem üben, selbstverständlich auch an Israel. Doch wie in zahllosen vorausgegangenen Diskussionen war es auch in Hamburg nicht Kritik, sondern der Oberton konformierender Empörung, der die Debatte um die rhetorische Frage bestimmte. So unbeholfen sich diese Gesinnung hinter dem verquasten Titel der Veranstaltung versteckte, so unverfroren und direkt kam sie in einer Forderung zum Ausdruck, welche von einer »Arbeitsgruppe Palästina im Friedensausschuss« formuliert worden war: »Nur wenn wir uns kritisch mit Israel auseinandersetzen, können wir glaubhaft im Unterricht latentem Antisemitismus entgegentreten.« Unabhängig von allem anderen Unfug dieses Satzes könnte man seiner Logik zufolge rassistischen Attacken gegen farbige Asylsuchende nur dann glaubhaft entgegentreten, wenn man vorher Südafrika oder noch besser die USA kritisiert hat. Was Leute, die derlei formulieren, glaubhaft bestimmt nicht können, das ist: begründungslos, einfach als Gattungswesen dem Rassismus entgegentreten. Ohne böse Juden kein gutes deutsches Gewissen. Unmittelbarer Anlass jener pädagogischen Behauptung wie der Gewerkschaftsveranstaltung war der Ärger, den ein längeres Interview der Hamburger Lehrerzeitung mit Ralph Giordano ausgelöst hatte. Die Lehrer lamentierten: »Giordano denunziert linke und pazifistische Kritiker Israels, ohne diese Personengruppe näher zu kennzeichnen.« Dieses Versäumnis Giordanos sei hier mit einer genauen Kennzeichnung dieser Personengruppe nachgeholt: es handelt sich beispielsweise um die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Hamburg.
Die innige Verbindung, die Ehrbarkeit und Ressentiment in der besonderen Empörung über Israels Politik längst eingegangen sind, demonstrierte hier Norman Paech, ein Hochschullehrer aus Hamburg. Er lehrt öffentliches Recht, Staats- und Völkerrecht und gelegentlich andere Menschen das Fürchten, indem er Hamburger Lehrern die rechtsradikale Propaganda von der Schuld der Juden am Antisemitismus in leicht entschärfter Form empfiehlt: für ihn sind Juden am Hass auf sie nur mitschuldig. Die Grünen waren vor einem Jahr noch etwas bescheidener, für sie trug Israel die Mitschuld daran, dass es mit irakischen Raketen beschossen wurde.
In der Hamburger Lehrerzeitung teilte Professor Paech seinen Kollegen in der GEW mit: »Israel muss sich allerdings in der Tat fragen, ob seine Palästina-Politik nicht einem latenten Antisemitismus in Deutschland Nahrung gibt – und dem können wir nicht entgegensteuern, indem wir schweigen.« Die Frage erübrigt sich: Schweigen worüber? Die demagogische Figur dieser Wendung hat Tradition. Es handelt sich bei ihr um eine besonders beliebte Formel antisemitischer Agitation, um die Formel vom »provozierten Antisemitismus«. Wer sich über historische Beispiele dieser Anschuldigung informieren möchte, sollte gelegentlich mal wieder in ein Buch schauen, das für kurze Zeit zur intellektuellen Grundausstattung der Linken gehört hat, in die von Adorno und anderen vorgelegte Studie über die autoritäre Persönlichkeit. Im Kapitel über Themen und Techniken des amerikanischen Agitators sind all jene Äußerungen versammelt, die sich trotz ihres historischen Alters nachgerade jugendfrisch ausnehmen. Und wie quicklebendig diese alte Formel von der Mitschuld der Juden an ihrer Verfolgung ist, zeigt die im Brustton pädagogischer Verantwortung für Israel vorgetragene Ermahnung von Norman Paech. Nicht vom Antisemitismus will er reden, sondern von dessen Zulieferern in Israel. Der Anwalt der Menschenrechte, als der er sich versteht, präsentiert sich gerade dadurch als ein Gegner des Judenhasses, dass er die Juden beschwört, die Anlässe dazu aus der Welt zu schaffen. Unter diesem Aspekt muss man auch die weiter unten beschriebenen pädagogischen Versuche sehen, die Lehrer in diesem Zusammenhang an ihren Schülern verüben.
Dass Norman Paech über die israelische Beihilfe zum deutschen Antisemitismus nicht schweigen kann, verdankt er, wie er in einem Zeitungsinterview sagte und in Hamburg wiederholte, einem ganz besonderen Zungenlöser: dem Pfingsterlebnis einer Israelreise.
Er war, wie er mitteilte, vor 25 Jahren »in der Aura der Kollektivschuld« nach Israel gefahren. Und dort war ihm zuteil geworden, worauf die Wallfahrer nach Lourdes immer nur vergeblich hoffen: Gesundheit. »Ich wurde erst dort auf die Lage der Araber aufmerksam«, berichtete er über das wundersame Mittel seiner dauerhaften Genesung. »Seit jener Zeit fühle ich mich in dieser Frage gefordert«, beschrieb er im salbungsvollen Jargon des Berufspolitikers die anhaltende moralische Wirkung dieser Entdeckung. Es war nicht Damaskus, wo es ja auch eine Lage der Araber gab, dass er vom Saulus zum Paulus geworden war, sondern Jerusalem. Dort hatte er sich vom Linken in einen Deutschen verwandelt, in einem moralischen Kurbad, das sich in der Folgezeit des Ansturms von Rekonvaleszenten aus der Bundesrepublik kaum erwehren konnte.
Von der »Aura der Kollektivschuld« erlöst, hatte er schon Mitte der 60er Jahre persönlich ein Ziel erreicht, dessen allgemeine Verwirklichung die Nationalzeitung noch immer einklagt. Die Leiden der Palästinenser vor Augen, konnte er aus dem Schatten Hitlers heraustreten. Nun war er frei für eine neue kollektive Aufgabe ganz eigener Art, nämlich für die des Bewährungshelfers. Und wie viele andere Absolventen des Bildungsurlaubs im Nahen Osten entdeckte er eine exklusive Fürsorgepflicht der Deutschen für Israel: »Ich vermag nicht«, begründete er dieses Ansinnen, »als Konsequenz aus den Verbrechen der Generation vor uns zu schweigen, wenn die Überlebenden, ihre Kinder und Enkel, Menschenrechte anderer verletzen.« Wenn israelische Polizisten prügeln, wenn israelische Soldaten Zivilisten erschießen, dann strapazieren diese Taten vor allem die deutsche Kollektivgeduld. Wolfgang Pohrt hat dieses Bewährungshelfersyndrom einmal treffend als sozialarbeiterische Ermächtigung der Deutschen beschrieben, ihre Opfer davon abzuhalten, rückfällig zu werden.
Über ein Vierteljahrhundert lang versucht Norman Paech nun schon geduldig, dieser Rückfallgefahr entgegenzutreten. »Er hat sich«, heißt es über ihn in der Zeitschrift Semit , »mehr als einmal öffentlich engagiert, wenn es darum ging, Recht und Menschenrechte zu verteidigen, oft genug konträr zur offiziellen politischen Meinung ... Im Februar dieses Jahres reiste Norman Paech mit einer Delegation durch die besetzten Gebiete Israels ... Das Ergebnis dieser Reise soll in Buchform veröffentlicht werden. Es weist überprüfbar nach, mit welchen Schachzügen Israel seine Politik den Palästinensern gegenüber durchsetzt.«
Читать дальше