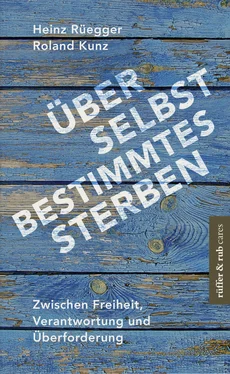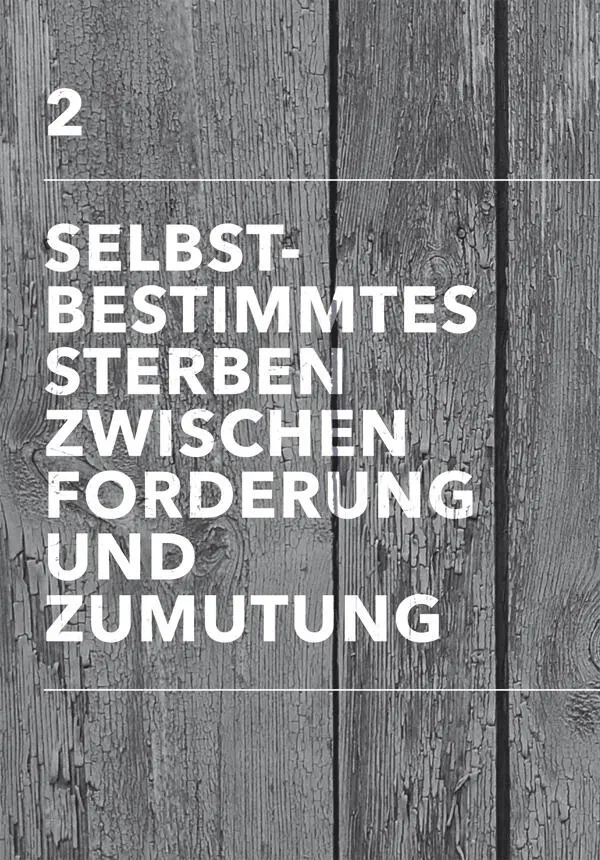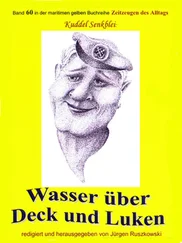Sterben wird zur Aufgabe eines medizinischen Managements. Es ist gerade zentral für heutige Sterbeverläufe, dass wir mitbestimmen können, ja in vielen Fällen sogar müssen, wie wir sterben möchten.20 Darauf sind wir kulturell und mental nicht vorbereitet. Kein Wunder, fühlen sich viele angesichts dieses Paradigmenwechsels überfordert – so sehr ihn manche auch als Ausweitung persönlicher Freiheit und individueller Handlungsautonomie begrüßen mögen.
Vom Kampf gegen den Tod zum Einsatz für ein friedliches Sterben
Der Umgang mit Sterben und Tod gehörte jahrhundertelang nicht zu den Aufgaben der Medizin. Im »Corpus Hippocraticum«, einer maßgebenden Sammlung medizinischer Texte aus vorchristlicher Zeit, wird dem Arzt ausdrücklich geraten, sich von Sterbenden fernzuhalten. Die Betreuung und Begleitung von Sterbenden war Sache der Angehörigen oder von Geistlichen. Man kann geradezu von einer »historischen ›Nicht-Zuständigkeit‹ des Arztes für den Prozess des Sterbens und des Todes« sprechen.21 Gegen den Tod konnte medizinisch nichts getan werden, und auch der Sterbeprozess konnte nicht wesentlich gelindert werden. Deshalb galt das Augenmerk primär der richtigen inneren Einstellung des Sterbenden, mit der dieser seinem unausweichlichen Geschick entgegengehen sollte. Als Anleitung dazu entwickelte sich im Mittelalter die Literaturgattung »Ars moriendi« mit Anleitungen zur Kunst eines guten, gottergebenen Sterbens.22 Diese Situation änderte sich mit dem Aufkommen einer naturwissenschaftlich basierten Medizin. Das Sterben wurde nun als biologische Folge fortschreitender Krankheitsprozesse verstanden; durch rasante Fortschritte der pharmakologischen und medizinischen Wissenschaften wurden wirksame Möglichkeiten entwickelt, dagegen anzugehen. Der Internist Frank Nager hat darauf hingewiesen, dass »der Tod für die Mediziner des naturwissenschaftlich-technischen Zeitalters ein ›factum brutum‹ – eine nackte Tatsache – ist, dem sie den unerbittlichen Kampf angesagt haben. […] Im 20. Jahrhundert hat sich die moderne Heiltechnik zu einer gigantischen Veranstaltung gegen Sterben und Tod entwickelt.«23 Die heute noch da und dort vorherrschende »Todesverdrängung moderner Heiltechniker« hat den Tod zum Erzfeind der Medizin erklärt: »Von Berufs wegen ist er [der Tod] unser Feind, um nicht zu sagen – unser Todfeind.«24 Nun sind eine Medizin und ein Gesundheitssystem, die den Tod vor allem als zu bekämpfenden Feind wahrnehmen, letztlich unmenschlich und lebensfeindlich.25 Sie nehmen die Endlichkeit des menschlichen Lebens als elementaren Aspekt der »condition humaine« nicht ernst und können deshalb auch das Sterben von Menschen als wichtigen letzten Teil des Lebens nicht hilfreich begleiten. Peter Steiger, Intensivmediziner am Zürcher Universitäts-Spital, kommentiert eine heute weit verbreitete Tendenz insbesondere der Spitzenmedizin mit der lapidaren Feststellung: »Man will die Menschen heutzutage nicht mehr sterben lassen.«26 Kein Wunder, dass die Angst bei vielen Menschen groß ist, nicht sterben zu können beziehungsweise aufgrund medizinischen Intervenierens nicht sterben zu dürfen, obwohl das Leben eigentlich zu Ende geht.27
Gegen eine solche einseitige medizinische Haltung hat sich in neuerer Zeit zunehmend Widerspruch erhoben. So hat etwa der Medizinethiker Daniel Callahan schon in den 1990er-Jahren eindringlich gefordert, die Medizin müsse die menschliche Sterblichkeit ganz neu ernst nehmen und dem Tod wieder seinen berechtigten Platz im Leben eines Menschen zugestehen. Er hält fest: »Die Tatsache seines unabwendbaren Sieges – seiner letzten Notwendigkeit – muss wieder in das eigene Selbstverständnis der Medizin aufgenommen werden, muss ein Teil ihrer Aufgabe werden, eine Begrenzung ihrer Kunst, die aber gleichzeitig die Natur dieser Kunst definiert.«28 Callahan ist überzeugt: »Eine Medizin, die sich eine Akzeptanz des Todes ganz zu eigen gemacht hätte, wäre eine große Veränderung im Vergleich zu ihrem gegenwärtigen Konzept; sie könnte dann den Raum schaffen, in dem die Sorge für die Sterbenden nicht ein nachträglicher Einfall wäre, wenn alles andere versagt hat, sondern dies für sich selbst als eines ihrer Ziele sehen. Diese Sorge um einen friedlichen Tod sollte genauso Ziel der Medizin sein wie die Förderung der Gesundheit.«29 Diese Überzeugung hat Eingang gefunden in den von Callahan geleiteten Prozess einer breit abgestützten internationalen Definition der Ziele der Medizin, die zu dem 1996 veröffentlichten »Hastings Report« führte: Die letzte von vier Zielbestimmungen besagt, zu den Aufgaben der Medizin gehöre »die Verhinderung eines vorzeitigen Todes und das Streben nach einem friedvollen Tod«.30 Hier tritt das Bemühen um die Ermöglichung eines friedlichen Sterbens gleichrangig neben den Kampf gegen einen vorzeitigen Tod als zentrale Aufgabe der Medizin in den Blick. Diese Perspektive ist in neuerer Zeit insbesondere in der Entwicklung einer Palliative Care und als Teil davon einer Palliativmedizin als eigener medizinischer Disziplin umgesetzt worden.31 Palliative Care verzichtet bewusst darauf, einen sich abzeichnenden Sterbeprozess durch kurative, auf Heilung zielende medizinische Maßnahmen aufzuhalten und den Tod zu bekämpfen; sie akzeptiert das Sterben und den Tod als fundamentale, zum Leben gehörende Phänomene. Palliative Care konzentriert sich darauf, durch umfassende lindernde Maßnahmen den Sterbeprozess zu erleichtern und die Lebensqualität der betroffenen Patientinnen so gut wie möglich zu unterstützen. Im Fokus steht also eine Medizin, die die »Gleichrangigkeit von ärztlichem Heilungsauftrag und ärztlichem Auftrag zur Hilfe im Sterben« ernst nimmt.32 Ziel ist nicht mehr Lebenserhalt oder Lebensverlängerung. Ziel ist nicht mehr der Kampf gegen den »Todfeind Tod«. Ziel ist vielmehr die Ermöglichung eines friedlichen, eines »guten« Sterbens – so weit das nur irgendwie möglich ist. Und dazu gehört, die Autonomie eines Patienten und seine Selbstbestimmung auch bezüglich seiner Vorstellungen und Wünsche eines »guten« Sterbens absolut zu respektieren.
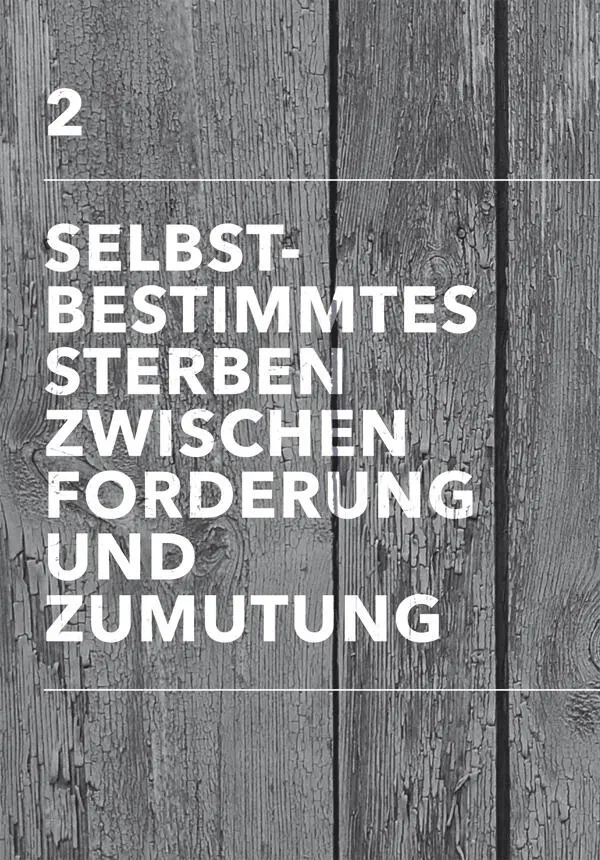
Die Medikalisierung des Sterbens und die Fortschritte der Medizin brachten es mit sich, dass sich im Verlauf eines Sterbeprozesses immer häufiger komplexe Entscheidungssituationen ergaben und dass die Entscheidungsbefugnis faktisch weitgehend in die Hände der Ärzteschaft geriet. Ihr gestand man kraft ihres medizinischen Wissensvorsprungs weithin unhinterfragt zu, darüber zu bestimmen, was im Kampf gegen den Tod medizinisch gemacht werden sollte und wie lange der Kampf fortzusetzen sei. Aus dem unspektakulären, selbstverständlichen Sterben war ein medizinisch kontrolliertes und dominiertes Sterben unter der Oberaufsicht von Ärzten geworden.33
Die Angst vor medizinischer Übertherapie und die Einforderung des Rechts auf den eigenen Tod
Diese Situation war durchaus ambivalent: Auf der einen Seite entlastete sie die betroffenen Patientinnen und ihre Angehörigen von medizinisch-fachlich wie existenziell schwierigen Entscheidungen über Leben und Tod. Die Verantwortung konnte nach diesem Modell des ärztlichen Paternalismus an die Experten abgegeben werden. Auf der anderen Seite war damit eine Entmündigung der Betroffenen verbunden; sie sahen sich mitunter ohnmächtig der Eigendynamik einer medizinischen Logik ausgeliefert, die davon ausging, dass im Kampf gegen den Tod alle zur Verfügung stehenden therapeutischen Mittel eingesetzt werden soll ten, denn: Das Leben als höchstes ethisches Gut rechtfertigte zu seinem Schutz einen solchen Einsatz moralisch nicht nur, sondern es verlangte ihn geradezu. Daniel Callahan sieht darin die »moralische Logik des medizinischen Fortschritts«.34 Nach seiner Einschätzung sind »die Forderung nach Kontrolle und die Ablehnung eines Todes, wie er sich ereignet, wenn wir ihn unmanipuliert geschehen lassen, nicht nur stark, sie sind für viele eine Leidenschaft geworden. Das einzige Übel, das größer scheint als der persönliche Tod, wird zunehmend der Verlust der Kontrolle über diesen Tod.«35 Und dank der beeindruckenden Fortschritte in der jüngsten Vergangenheit stehen der Medizin inzwischen sehr viele Instrumente zur Verfügung, um eine solche Kontrolle über den Tod wahrzunehmen beziehungsweise seine Bekämpfung zwecks entsprechender Lebensverlängerung erfolgreich durchzuführen. Darum stellt sich die Medizin, wie die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften selbstkritisch festhält, in der Regel spontan auf die Seite des Lebens und versucht den Tod zu verhindern.36
Читать дальше