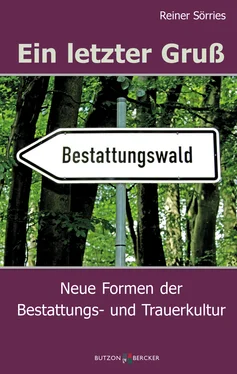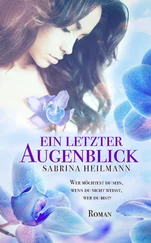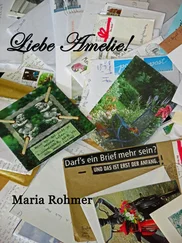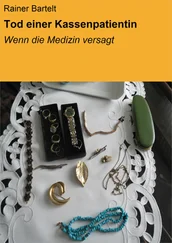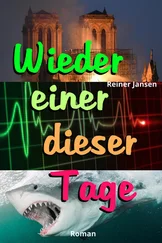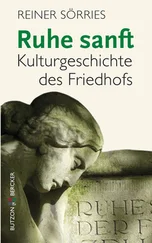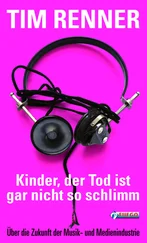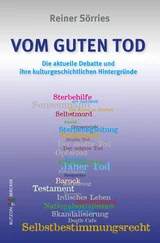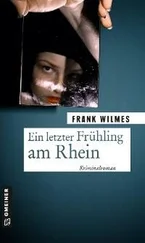Im Bestattungswesen, das seit fast 200 Jahren eine von Männern besetzte Domäne war, engagieren sich zunehmend Frauen, die meist als Quereinsteigerinnen diesen Beruf ergreifen. Sie berücksichtigen u. a. die Tatsache, dass Frauen zu ihrem Körper ein anderes Verhältnis haben als Männer und auch im Tode ihren ungeschützten Körper nicht den Händen und Augen von Männern ausgesetzt wissen wollen. Es keimt die Erkenntnis, dass Menschen mit homosexueller Orientierung, vor allem die Zu- und Angehörigen, ein Gespräch mit einem/einer heterosexuellen Bestatter/in scheuen. Dem Partner eines schwulen Verstorbenen fällt es möglicherweise schwer, zu sagen: „Mein Mann ist verstorben“, wenn er nicht die Gewissheit hat, auf Verständnis zu stoßen. Gay-Bestattungen und bekennend lesbische Bestatterinnen sind immer noch die große Ausnahme.
Auf Friedhöfen vollzieht sich Diversity zwar seit Jahren, aber keineswegs programmatisch, sondern als das Ergebnis eines schleichenden Prozesses von den Rändern der Gesellschaft her. Zu nennen sind etwa die mittlerweile auf einigen Großstadtfriedhöfen anzutreffenden AIDS-Gemeinschaftsgräber, die durchaus als Bekenntnisse zu schwulen Lebensentwürfen zu sehen sind. Und einer Einzelinitiative ist der 2014 eröffnete erste Lesbenfriedhof in Berlin zuzuschreiben.
Die AIDS-Szene hat sich eigene Bestattungsrituale gegeben oder erkämpft, auch eigene Formen der Erinnerungskultur kreiert, wobei erst das Internet der queeren Szene (englisch queer: etwas, das von der Norm abweicht) Räume des Gedenkens eröffnet hat. Es ist an der Zeit, sich mit Gender und Diversity in der Bestattungs- und Friedhofskultur zu befassen, um einerseits Ausgrenzungen zu vermeiden und andererseits keine Rand- oder Nebenkultur entstehen zu lassen, die sich im Zuge der Liberalisierung der Bestattungs- und Friedhofsgesetze ergeben könnten.
Relativ weit fortgeschritten ist das Bestattungs- und Friedhofswesen im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit des religiösen Bekenntnisses. Zumindest gilt dies für Muslime, die auf vielen Friedhöfen ihre eigenen Grabfelder besitzen bzw. auf den Friedhöfen einen gewissen autarken Gaststatus besitzen. Doch auch diese Entwicklung beruht nicht auf einem Bewusstseinswandel der Mehrheitsgesellschaft, sondern ist der Eigeninitiative der Muslime zu verdanken. Sie gründeten eigene Bestattungsinstitute und die Ausländerbeiräte der Kommunen erstritten Grabareale für Muslime. Angehörige anderer Religionsgemeinschaften haben erst vereinzelt ähnliche Rechte.
Eine Gesellschaft, die mit und von der Verschiedenheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger lebt, muss sich der Aufgabe stellen, auch Diskriminierungen in der letzten Lebensphase, bei der Bestattung und der Trauer zu vermeiden.
Nicht minder müssen Wege gefunden werden, eine Diskriminierung derer zu vermeiden, die als professionelle Helfer die Menschen in der letzten Lebensphase begleiten. Der Sachverhalt ist verstörend: In Pflegeeinrichtungen sind ganz überwiegend Frauen beschäftigt, und viele von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Obwohl weitgehend Einverständnis herrscht, dass sie unterbezahlt sind, gehören sie zu den unteren Einkommensgruppen. Ihre gesellschaftliche Reputation ist gering, und daraus folgt, dass Pflegerinnen, aber auch Pfleger mehrfach diskriminiert werden. Bei Angehörigen des Bestattungsberufes hat in den letzten Jahren zwar eine Verbesserung des Status stattgefunden, doch begegnet man ihnen häufig noch mit Vorbehalten. Auch hat die Statusaufwertung des Bestatters im Sinne eines modernen Dienstleistungsberufes allenfalls die Vorderbühne des Geschäftsinhabers erreicht, während jene, die auf der Hinterbühne mit der Abholung und Herrichtung des Leichnams befasst sind, nach wie vor mit einem Totengräberimage stigmatisiert sind. Meist sind sie im Bestattungsinstitut nicht fest angestellt, sondern arbeiten auf Honorarbasis, je nach Bedarf, und entbehren einer sozialen Absicherung. Nicht unähnlich sind die Verhältnisse im Friedhofswesen, wo im operativen Bereich zumeist Billiglöhner beschäftigt sind. Jene, die im Krematorium mit der Einäscherung der Leichen befasst sind, wagen es in der Öffentlichkeit kaum, über ihren Beruf zu reden.
Im Sinne von Diversity Management muss die Situation dieser Personenkreise unbedingt mit bedacht werden, um ihre Situation als gesellschaftliche Randsiedler zu verbessern. Bestatter, Friedhofsgärtner und Steinmetze sehen sich zudem mit dem Vorurteil konfrontiert, mit dem Tod anderer Menschen Geschäfte zu machen.
Diskriminierungsmechanismen greifen also sowohl bei jenen, die in der letzten Lebensphase stehen, als auch bei denen, die diesen Weg begleiten und organisieren. Viele Anstrengungen, diese Situation zu verbessern, beruhen auf den Initiativen einzelner Personen, Gruppen oder Institutionen, während sie noch nicht als gesellschaftliches Anliegen gesehen werden.
Da aber heute letztlich jeder sein Recht auf Individualität beansprucht, erlangt die Verschiedenheit als Teil der Identität ihre eigene Bedeutung. Und ein Blick auf diese Verschiedenheit kann dazu beitragen, auch den Wandel der Bestattungs- und Trauerkultur besser zu verstehen, ihn vielleicht sogar als Chance zu begreifen.
Die Verschiedenheit von Frau und Mann ist keineswegs nur eine biologische, sondern auch eine sozial konstruierte, indem dem jeweiligen Geschlecht bestimmte Verhaltensweisen nicht nur zugeschrieben, sondern auch abverlangt werden. Mit diesem Sachverhalt befasst sich nach Anfängen in den 1960er- und 1970er-Jahren in den USA auch in Deutschland seit den 1980er-Jahren die sogenannte Geschlechterforschung als eigene Disziplin, auch hierzulande als Gender Studies bezeichnet.
Das den Geschlechtern traditionell zugeordnete Trauerverhalten kann diesen Sachverhalt verdeutlichen. Auf einer Zeichnung von Rudolf Jordan, darstellend das Begräbnis des jüngsten Kindes von 1857 ist dies prototypisch dargestellt. (Abb. 1)
Während die Frau überwältigt vom Schmerz um das tote Kind in gebückter Haltung die Hände vors Gesicht geschlagen hat, bleibt der Mann aktiv, trägt den Sarg des Kindes und blickt mit offenen Augen nach vorne. Die Frau ist passiv, der Mann aktiv. Das Töchterchen hingegen übernimmt die Rolle des unverständigen Kindes, das die Situation nicht begreift und wie unbeteiligt wirkt.

Abb. 1: Rudolf Jordan, Begräbnis des jüngsten Kindes, 1857
Die Passivität der Frau und die Aktivität des Mannes im Trauerfall spiegeln sich in der Folge auch in der Konvention der Trauerkleidung. Während die Frau über Monate, bisweilen über Jahre Gefangene einer peniblen Trauermode war, beschränkte sich das Tragen von Trauerkleidung beim aktiven Mann auf kurze Zeit, die rasch dem Trauerflor am Ärmel wich, um ihm die Hände fürs Tun frei zu halten.
Diese Rollenzuschreibung an Mann und Frau im 19. Jahrhundert korrespondiert mit dem Sachverhalt, dass das Bestattungsgewerbe in dieser Zeit eine Männerdomäne geworden war. Davor war über viele Jahrhunderte die Frau jene Person, die sich als Begine, als Totenwäscherin, als Seelnonne, als Toten- oder Leichenfrau um die Bestattung der Verstorbenen kümmerte. Die neue Arbeitsteilung im 19. Jahrhundert folgte dem ökonomischen Interesse des Mannes, der als Fuhrunternehmer oder Sargtischler das gesamte Bestattungsgewerbe an sich zog, als es ihm die neue Gewerbefreiheit möglich machte.
Galten diese Rollenverteilungen im 19. Jahrhundert als gegeben und unumstößlich, so wurden sie im Laufe der Emanzipationsbewegung kritisch hinterfragt. Aber es dauerte bis in die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, bis Frauen begannen, ihre Passivität ins Gegenteil zu verkehren. Schließlich wehrten sie sich nicht mehr gegen eine „Trauer als zweifelhaftem Privileg der Frauen“ 13, sondern erhoben darauf einen geschlechtsspezifischen Anspruch
Читать дальше