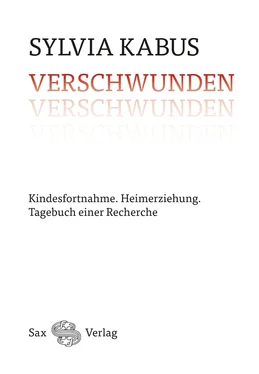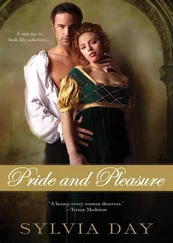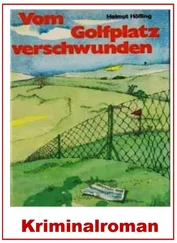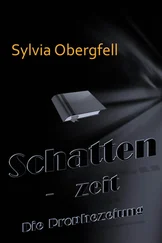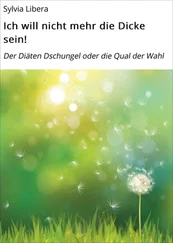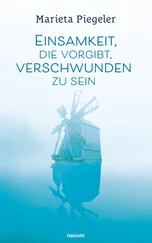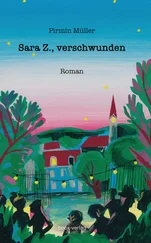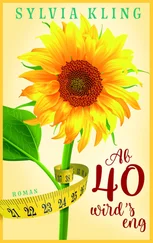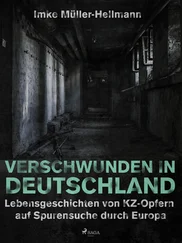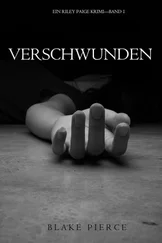»Heute?«
»Hören Sie auf.«
Es klingt enttäuscht, wie seit langem. Nicht so sehr von Einzelheiten, eher in etwas Wesentlichem.
Also kennt er die Agra. Ich erzähle ihm, was ich weiß über die junge Grundstücksbesitzerin, die ich suche, welchen Hergang ihrer Geschichte die aufgefundenen Archivdokumente zu Immobilienbewegungen in der Gartenstadt Markkleeberg zusammensetzten. Ihr Aufenthaltsort ist zu dieser Zeit offiziell unbekannt, doch ihr Flurstück inmitten vieler Moorbeetgärtnereien grenzt an die Landwirtschafts- und Gartenbauaustellung. Zu deren 10. Jubiläum soll unter anderem eine große Tierschau veranstaltet und die gesamte Spitze südlich des Tierschaugeländes aufgekauft werden, ihr Flurstück inbegriffen. Doch sie wie auch ihre Eltern bleiben unauffindbar. Ein Pächter zahlt statt der Pacht Grundsteuer an die Stadt. Er weiß nichts. Vermutlich sei die Besitzerin nach Westdeutschland gegangen.
Eine Großmutter soll noch hier leben. Sie wird schriftlich aufgefordert, umgehend eine Vollmacht für den zu erzwingenden Grundstücksverkauf zu beschaffen. Niemand antwortet.
Es eilt. Zum »Abwesenheitspfleger« der Angelegenheit der jungen Petra wird der Sektionsleiter der Ausstellungsverwaltung. In einem durchgesetzten Kaufakt vertritt er gleichzeitig die Interessen der Agra und nunmehr auch die der Gegenpartei, der Besitzerin, gebilligt vom Jugendamt. Notfalls solle das Aufbaugesetz in Anspruch genommen werden, steht vermerkt. Im April 1961 ist der Kauf abgeschlossen und von der Abteilung Volksbildung, der die »Jugendhilfe« unterstellt ist, vormundschaftlich genehmigt. Etwas Geld wird als »Kaufpreis« beim Notariat hinterlegt. Das Grundbuchblatt der Eigentümerin ist geschlossen.
Ein Verwaltungschef, der per Federstrich zum Jugendpfleger wird. Ein Grundstück, mit Genehmigung des Jugendamtes verkauft. Innerhalb von drei Monaten gehört es der Agra.
So fing meine Suche an. Ich wollte die Eigentümerin finden, mit ihr darüber sprechen.
Herr K. hört ausdruckslos zu. Denkt er an seine Lehre zur selben Zeit dort? Er war da, die Vorgänge der frühen Agra-Jahre waren Alltag für ihn.
Wir sprechen über das Gelände der ehemaligen Landwirtschaftsausstellung. Von ihren Skulpturen und rätselhaften Rudimenten geht eine einnehmende, wenn nicht einsaugende Atmosphäre aus. Verfall und grüner Triumph. Einem Areal unberührter Stellen, die noch immer nicht bis ins Letzte verplant und zweckbestimmt sind, entsprechen ähnlich viele Leerstellen in der historischen Aufarbeitung. Die Geschichte der Agra ist verbunden mit Zwangskollektivierung und Kohleabbau. »Gemeinsam stellten sich alteingesessene Bauern und Neubauern den volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten der Landabgabe für die Braunkohlengewinnung; gemeinsam gingen sie den nicht einfachen Weg der sozialistischen Umgestaltung. So entstand 1952 die erste Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft LPG ›Rosa Luxemburg‹ ...«2 1990 wurde diese Darstellung veröffentlicht. Stellten sie sich oder wurden sie, nachweislich, gezwungen? Im Archiv stieß ich auf wütende Proteste aus der Bevölkerung gegen unmöglich zu erreichende Erntesolle, auf unverblümte Beschimpfungen und Ablehnung der regierenden Kommunisten, anonym und mit Namen und Adresse.
Der Ort selbst, heute: eine ausgeschürfte und inzwischen neugestaltete Landschaft, in der Parks, Kanäle und Wasserarme, barocke Einschlüsse, von der Zeit scheinbar Verschontes, umso stärker berühren.
Herr K. ist bewegt von Bildern seiner Jugend. Eine lebhafte, vielleicht als frei empfundene Zeit. Lebenshoffnung. Körperlich frei, Bewegung, Natur, Tiere. Menschen.
»Und die Menschen damals?«
»Die Menschen?«
»Wie waren sie?«
Er lässt eine der Pausen, nach denen er zurückkehrt zu einem leise wegwerfenden Ton.
»Sie waren ... interessierter! Das!«
»Woran?«
»Interessierter.«
Am Leben? Aneinander? Es scheint eine Erfahrung aus langem Erleben zu sein, die sich irgendwann von selbst versteht.
Aber um all das geht es plötzlich nicht. Nicht um »sozialistisches Eigentum« an Immobilien, sondern an einem Kind. Der weiße Fleck ist hier.
»Sie war weg. Als ich hinkam, war sie weg.«
Das springt hin und her zwischen ihm und mir. Es ist März, doch in den Nachmittag kommt etwas wie verlangsamende Herbstschwere.
Nach der Lehre heiratete er, das Paar bekam drei Töchter, Silke, Steffi, Petra. »Alle ein Jahr auseinander, Petra war die Jüngste.« Doch die Ehe hielt nicht, er und seine Frau ließen sich scheiden, er verlor die Kinder, die zunächst zu ihrer Mutter kamen. Mutter, ja, doch sie war jung, sie schaffte es nicht, nach der Trennung zurechtzukommen. Vorübergehend kamen die beiden älteren Töchter in ein Heim in Altenburg, durften dann zurück zu ihrer Mutter.
»Ich hatte niemanden damals«, sagt er, »die Kinder wurden mir hinterm Rücken abgekapselt, ich lebte drei Jahre lang ganz allein. Nach einer Zeit bekam ich Silke zurück für eine Weile. Heute sind die beiden Großen erwachsen und weggezogen, doch ich bin in Kontakt mit ihnen. Nur die Kleine ... Mit drei Jahren ... Sie kam erst ins Heim, sollte zurückkommen, doch dann war sie plötzlich fort.«
»Was heißt fort?«
»Weg. Ja!«
Irgendwann in der Zeit nach der Scheidung sei er unvermittelt ins Jugendamt bestellt worden. Er wusste nicht weshalb, nein. Bei Nichterscheinen wurde ihm mit der Polizei gedroht.
»Plötzlich? Völlig überraschend?«
»Auf jeden Fall! Das hatte ich mir nicht träumen lassen! Ich weiß nicht, wer das war, wer das in die Wege geleitet hat, bis heute nicht. Es ging alles so schnell, dabei bin ich überhaupt nicht zum Überlegen gekommen. Das Ganze passierte an einem Vormittag. Ich kam in ein Einzelzimmer. Eine Angestellte war da, den Namen kann ich Ihnen sagen, ich habe ihn behalten. Eine sehr Große, Stämmige. Die Frau war eine Strafe. Sobald man etwas sagte, hieß es: Wenn Sie nicht ruhig sind, sperren wir Sie ein. Da gab es kein Gespräch. Sie hat den Zettel hingepackt und gesagt: Ihre Tochter ist zur Adoption freigegeben. Unterschreiben Sie.«
»Und vorher?«
»Nichts. Die haben mir nichts zukommen lassen, denen war das wurscht, was mit mir war.«
Ich frage, was er unterschrieben habe.
»Die Frau vom Jugendamt saß da und legte mir das hin, und ich musste unterschreiben. Es war halb verdeckt. Sie setzen nur den Namen drunter, hier! Entweder Sie unterschreiben oder Sie gehen ins Gefängnis. Das war das Einzige, was ich denken konnte. Gefängnis.«
Methoden von Jugendämtern, die zu Unterschriftsleistungen führten, nicht nur in diesem Fall. »Ich war so fertig und hatte solche Angst, dass ich alles machte, was er wollte. Er legte einen Brief hin, gab mir einen Kugelschreiber und diktierte«, berichtete die Mutter eines angeschossenen und infolgedessen ertrunkenen dreiundzwanzigjährigen Flüchtlings an der Berliner Sektorengrenze, der die Unterschrift sogar unter die Genehmigung einer sofortigen Einäscherung abgepresst wurde.3
»Ich hab gesagt: Ich habe jetzt mein Todesurteil unterschrieben. Das weiß ich noch.«
»Und die Frau?«
»Und die Frau: Ja, Sie können gehen. Das hat sich erledigt.«
Ich bin beschäftigt mit dem, was sich für das Amt »erledigt« hatte. Mit der Eile, der brutalen Selbstverständlichkeit. Der Überrumpelung.
»Das war eine schlaflose Nacht danach, der Kopf wie ein Hubschrauber, es hörte nicht auf. Was heißt eine? Es ging immer so weiter. Danach hat sich keiner mehr Gedanken darum gemacht. Das war die DDR. Nach Neunundachtzig haben sie die Frau rausgeschmissen.
Die Kleine kam zuerst in ein Kinderheim, drei war sie da. Am Straßenbahnende Rosental, dann links, eine Villa. Sie hing mir am Herzen. Ich habe sie noch jeden Tag besucht, nach der Arbeit bin ich hingefahren, die kannten mich dort schon. Es war sauber, sie waren höflich, es war nicht abgeschottet. Soweit. Aber ...«
Читать дальше