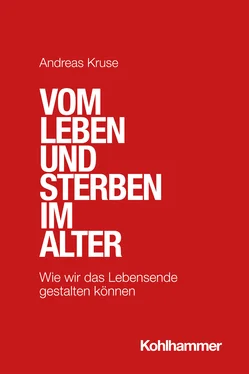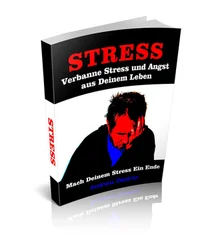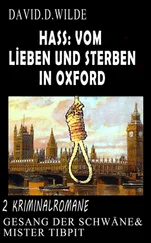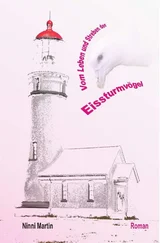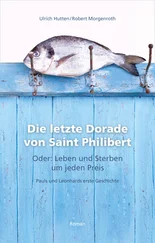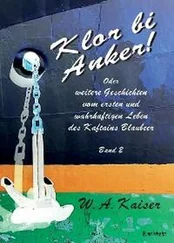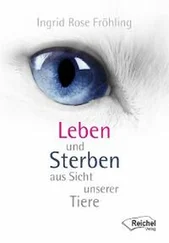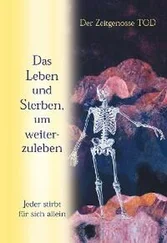Es ist zu bedenken, dass man bei der Versorgung und Begleitung eines schwerkranken oder sterbenden Menschen wenigstens eine gewisse persönliche Vorstellung davon haben sollte, was im Prozess der schweren Krankheit und des Sterbens psychologisch und existenziell geschieht (von Scheliha, 2010; Roser, 2019): Nicht, um Patientinnen und Patienten Überzeugungen aufzudrängen, sondern um selbst eine Orientierung, einen Kompass zu besitzen, der das eigene psychologische und existenzielle Erleben und Handeln leitet, ohne dabei die Offenheit für alle Zeichen, Aussagen und Deutungen, die von den Patientinnen und Patienten ausgehen, zu verlieren. Es sei hier betont: Den Dreh- und Angelpunkt der Versorgung und Begleitung bilden neben fachlichen Standards die Werte, Überzeugungen und Bedürfnisse der Patientin bzw. des Patienten (Caspari, Lohne, Rehnsfeldt et al., 2014; Remmers, 2019).
Wenn Symptome gelindert und kontrolliert, wenn Werte, Überzeugungen und Bedürfnisse schwerkranker und sterbender Menschen verstanden und ausdrücklich aufgegriffen werden: Sind dann alle Ängste genommen? Hier möchte ich vor vorschnellen Annahmen und Vereinfachungen warnen. Nicht wenige Menschen neigen ja dazu, die Aussage zu treffen, sie hätten vor dem Sterben Angst, nicht aber vor dem Tod. Vielfach ist zu hören, dass man mit dem Tod »keine Probleme« habe – schließlich erlebe man diesen ja nicht an sich selbst –, wohl aber mit dem Sterben, da man Angst vor einem qualvollen Sterben habe. Ich stehe dieser Aussage skeptisch gegenüber. Das Leben aufzugeben, die engsten persönlichen Bezugspersonen zurückzulassen, von der Welt Abschied zu nehmen: Dies fällt zumindest jenem Menschen, der gerne lebt, der in und an der Welt Freude empfindet, der sich in der Welt und für die Welt engagiert, schwer. Es ist ein endgültiger Abschied. Diesen Abschied mag man Jahre vor dem Tod in seiner persönlichen Bedeutung diminuieren – der Abschiedsschmerz wird größer und größer, wenn man unmittelbar mit dem herannahenden Tod konfrontiert ist. Dies heißt nun nicht, dass der Mensch mitten im Leben niedergeschlagen oder verzweifelt sein und jegliche Initiative zur Selbst- und Weltgestaltung aufgeben müsste. Es heißt vielmehr, dass der Mensch »lernen« muss, sich auf das Faktum des eigenen Todes rechtzeitig einzustellen, dass er lernen muss, »anzusterben«, wie dies Michelangelo Buonarroti (1475–1564) in einem seiner 42 Sonette ausgedrückt hat.
Des Todes sicher, nicht der Stunde, wann.
Das Leben kurz, und wenig komm ich weiter;
den Sinnen zwar scheint diese Wohnung heiter,
der Seele nicht, sie bittet mich: stirb an.
Die Welt ist blind, auch Beispiel kam empor,
dem bessere Gebräuche unterlagen;
das Licht verlosch und mit ihm alles Wagen;
das Falsche frohlockt, Wahrheit dringt nicht vor.
Ach, wann, Herr, gibst du das, was die erhoffen,
die dir vertraun? Mehr Zögern ist verderblich,
es knickt die Hoffnung, macht die Seele sterblich.
Was hast du ihnen so viel Licht verheißen,
wenn doch der Tod kommt, um sie hinzureißen
in jenem Stand, in dem er sie betroffen.
(aus: Michelangelo Buonarroti, 2002, »Zweiundvierzig Sonette«;
übersetzt von Rainer Maria Rilke)
In diesem Sonett kommt die Bereitschaft zum Ausdruck, bereits viele Jahre vor Eintritt des Todes »anzusterben«, dies heißt, sich allmählich von der Welt zu lösen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass wir weder die uns umgebende Welt noch unser Leben als »unseren Besitz« auffassen dürfen. Im Gegenteil: Wir sind dazu aufgerufen, uns in das Loslassen und Hergeben einzuüben und damit die Welt und unser Leben im Sinne von Gegebenem, das wir irgendwann zurückgeben müssen, zu deuten 2 2 Siehe dazu auch die Schrift von Erich Fromm (1900-1980): »Haben oder Sein« (1976), in der diese Aussage ein zentrales Motiv bildet.
. Mit der Loslösung von der Welt – und dies heißt in den Worten Michelangelos: mit dem »Ansterben« – stellt sich der Mensch auf den eigenen Tod ein.
Auch die von Notker Poeta (deutsch: Notker der Dichter, Notker der Stammler) (ca. 840–912) stammende Antiphon: »Media in vita in morte sumus« (dt.: Mitten im Leben sind wir vom Tode umfangen) erinnert uns daran, rechtzeitig mit der Vorbereitung auf unseren Tod zu beginnen, uns in die abschiedliche Existenz einzuüben – was nicht bedeutet, dass sich der Mensch aus dem Leben zurückzöge, seine Möglichkeiten zur Selbstgestaltung und Weltgestaltung ungenutzt ließe.
Zurück zum Titel des Buches: »Vom Leben und Sterben im Alter«. Dieser Titel dient als Metapher für das herannahende Lebensende, welches hier aus der Perspektive des chronisch erkrankten Menschen betrachtet wird, vor allem aus der Perspektive des alten Menschen. Mit diesem Titel wird der Übergang von einer schweren chronischen Erkrankung zu einem präfinalen und finalen Zustand überschrieben – ein Übergang, der in aller Regel kontinuierlich zunehmend (progredient) verläuft, was sich nicht nur mit Blick auf die physische, sondern auch mit Blick auf die psychische, die soziale und die existenzielle Situation von Patientinnen und Patienten zeigt.
1.1 Die verschiedenen Bereiche der Person im Prozess des Sterbens
Der körperliche Bereich
Im körperlichen Bereich dominiert ein stetiger Rückgang der Widerstandsfähigkeit (gegen interne und äußere Stressoren) und der Restitutionsfähigkeit: Infektionen können immer schlechter abgewehrt werden, nach einer akuten Verschlechterung der Gesundheit wird deren Wiederherstellung immer unwahrscheinlicher, das nach optimaler Therapie und Rehabilitation erreichte Leistungsniveau unterschreitet jenes, das vor der akuten Verschlechterung der Gesundheit bestanden hat. Da akute Krankheitsepisoden mehr und mehr zunehmen, bedeutet dies langfristig einen deutlichen Rückgang der Leistungsfähigkeit des Organismus; möglicherweise bis hin zu einer vita minima. Eingetretene Einbußen in einzelnen Organfunktionen lassen sich immer weniger kompensieren. Diese Veränderungen münden schließlich in einem deutlich erhöhten Auftreten von körperlichen (und in deren Folge: von kognitiven) Symptomen und in einer verringerten Selbstständigkeit, die bis hin zu einer ausgeprägten Hilfsbedürftigkeit oder sogar Pflegebedürftigkeit führt (Burkhardt, 2019). Die Patientinnen und Patienten zeigen nicht selten stark ausgeprägte Erschöpfungssymptome, die auch die Teilnahme an aktivierenden oder rehabilitativen Maßnahmen erschweren.
Die längsschnittliche Abbildung dieses kontinuierlich zurückgehenden körperlichen Leistungsniveaus lässt sich mit dem in der Geriatrie entwickelten Frailty-Konzept vornehmen, das auch als eine phänotypische Annäherung an die zunehmende körperliche Verletzlichkeit des Menschen verstanden werden kann. Nach Linda Fried, auf die dieses Konzept zurückgeht, ist den folgenden fünf klinischen Merkmalen – die in ihrer Gesamtheit das Frailty-Konzept konstituieren – besondere Beachtung zu schenken (Fried et al. 2001):
1. dem ungewollten Gewichtsverlust (über fünf Kilogramm im vergangenen Jahr),
2. der subjektiv erlebten körperlichen Erschöpfung,
3. der körperlichen Schwäche (bestimmt mit der Messung der Handkraft),
4. dem verlangsamten Gang,
5. der geringen physischen Aktivität.
Wenn mindestens drei dieser klinischen Merkmale vorliegen, wird von Frailty gesprochen. Nun ist Frailty aber nicht per se mit der stark ausgeprägten Verletzlichkeit – man könnte in diesem Krankheitsstadium auch sagen: Gebrechlichkeit – des Menschen am Ende seines Lebens gleichzusetzen; vielmehr ist die Gebrechlichkeit eine stark ausgeprägte Form von Frailty. Und doch eignet sich das Frailty-Konzept auch zur Charakterisierung des organismischen Zustandes des Menschen am Ende seines Lebens, denn in allen (und eben nicht nur einzelnen) Merkmalen, die unter Frailty subsumiert werden, zeigen sich so stark ausgeprägte Leistungseinbußen und Restitutionsdefizite, dass deutlich wird: die verbliebenen physischen Ressourcen werden ausschließlich für die Aufrechterhaltung grundlegender Lebensfunktionen benötigt (Clegg et al., 2013). Dies aber gelingt dem Individuum immer weniger, sodass wiederholt abrupte Verschlechterungen des allgemeinen Gesundheitszustandes auftreten, die sich immer weniger kompensieren lassen. Daraus resultiert – betrachtet man den gesamten Krankheitsverlauf in der letzten Lebensphase – eine zunehmend geringere physiologische Leistungs- und Restitutionskapazität, die schließlich in einen Finalzustand mündet. Der Altersmediziner Cornel Sieber (2005) versteht Frailty als Folge von Einbußen in mehreren physiologischen Merkmalen, die gerade aufgrund ihrer Häufung ein »ausbalanciertes System gefährden« können; im Falle von Einbußen in zahlreichen physiologischen Merkmalen, so kann gefolgert werden, ist dieses ausbalancierte System nicht nur gefährdet, sondern bricht zusammen (»Desorganisation«) und kann zunächst nur noch in Ansätzen, bald aber gar nicht mehr wiederhergestellt werden.
Читать дальше