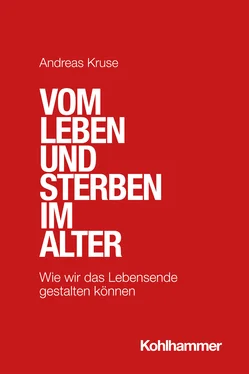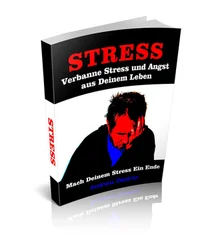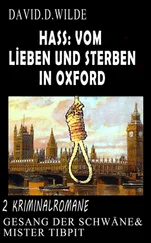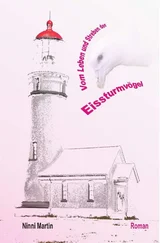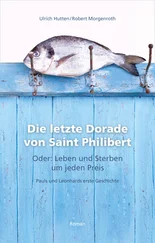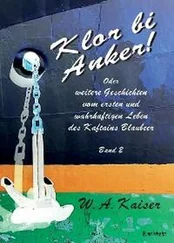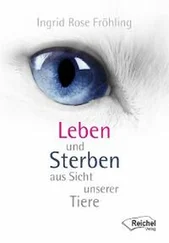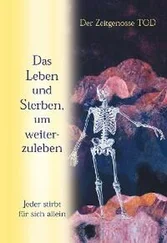Dabei sind die einzelnen Geschichten schon für sich genommen bedeutungshaltig, verweisen schon für sich genommen auf Aspekte des Lebens, die das Individuum als bedeutsam erachtet. Im Prozess des Erzählens entfalten die einzelnen Geschichten aber auch in der Hinsicht Wirkung, dass sie Aspekte der Identität konstituieren, in ihrer Gesamtheit die Identität, wobei die Identität grundsätzlich Veränderungen unterliegt, die sich wiederum in den erzählten Einzelgeschichten (stories) wie auch in der Gesamtgeschichte (Metastory) niederschlagen.
Die erzählten Geschichten sind als Rekonstruktion dessen zu begreifen, was gewesen ist. Sie beschreiben somit eine stilisierte Vergangenheit und treffen mit dem zusammen, was das Individuum erwartet, was das Individuum in Zukunftsstories berichtet (Ebd.). Aus Vergangenheits- und Zukunftsstories bildet sich schließlich die Gesamtstory oder die Gesamtvision des Lebens. Allerdings darf nicht übersehen werden: Diese Gesamtstory, diese Gesamtvision kann nicht wirklich erzählt werden; sie kann im Kern nur aus den Vergangenheits- und Zukunftsstories erschlossen werden.
Wir fügen einzelne Geschichten zusammen, wir nehmen in dieser Zusammenfügung bestimmte Akzentuierungen und Präzisierungen vor. Die Zusammenfügung einzelner stories kann und soll uns dazu dienen, etwas auf den Punkt zu bringen, eine zentrale Botschaft über uns zu vermitteln. Die Zusammenfügung und Akzentuierung bedeuten aber immer auch Aufgabe, Verlust von Details. Dies ist eine ganz natürliche Folge und auch nicht weiter zu beklagen. Problematisch wird dieser Prozess dann, wenn die Vielfalt der Einzelstories (und damit der Aspekte der Identität) verlorengeht, wenn das Individuum diese Vielzahl so stark reduziert, dass sich das Leben in den erinnerten und berichteten stories nur noch sehr unvollständig ausdrückt, in seiner Vielfalt nicht mehr zum Ausdruck kommt. In diesem Fall besteht die Gefahr der seelischen Verkümmerung und schließlich der psychischen Störung.
Eine bedeutende Aufgabe der psychotherapeutischen Behandlung ist darin zu sehen, die Offenheit des Menschen für die vielfältigen Einzelstories zu fördern und auf diesem Wege zu einer deutlich lebendigeren, reichhaltigeren Gesamtschau des eigenen Lebens zu gelangen. Da Geschichten ja nicht nur im Sinne von (stilisierten) Beschreibungen der Vergangenheit zu deuten sind, sondern auch im Sinne von Erwartungen und Hoffnungen (Ritschl, 2004), besitzt die psychotherapeutische Intervention auch das Potenzial, über die Förderung von Offenheit für die Vielfalt persönlicher Geschichten auch die lebendige, differenzierte Antizipation der persönlichen Zukunft zu fördern – mit allen positiven Folgen für die Nutzung der Entwicklungsmöglichkeiten, die die Zukunft bietet, wie auch für die Auseinandersetzung mit Grenzen, die in der Zukunft (allmählich) sichtbar werden. Vor allem aber kann die Wiedergewinnung einer lebendigen, reichhaltigen Identität dazu beitragen, dass das Individuum zu einer Neubewertung seines Lebens gelangt und damit die Grundlage für den reiferen Umgang mit der eigenen Endlichkeit schafft.
2.2 Die zweite theoretische Perspektive: »Ich-Integrität«
Die Aussagen zum Lebensrückblick führen vor Augen, wie wichtig die Entwicklung der Persönlichkeit – und zwar über den gesamten Lebenslauf – für die Art und Weise ist, wie Menschen ihre Verletzlichkeit und Endlichkeit, wie sie den Tod deuten. Sie führen weiterhin vor Augen, dass Entwicklung der Persönlichkeit auch meint: Innerpsychische und zwischenmenschliche Konflikte auszuhalten, diese bewusst und verantwortlich auszutragen, sich um deren Lösung zu bemühen. Dabei ist allerdings auch zu bedenken und wurde in den Aussagen zum Lebensrückblick hervorgehoben: Es gibt Konflikte, die das Individuum zum Zeitpunkt ihres Auftretens vielleicht gar nicht bewusst und verantwortlich austragen konnte, weil diese als so bedrohlich wahrgenommen wurden, dass ein Ausweichen, ein Fliehen, ein Verleugnen die einzige »Antwort« war, die dem Individuum offenstand. Man denke nur an familiäre Konflikte im Kindes- und Jugendalter oder an große seelische Belastungen, die durch Demütigungen, durch Unterdrückung, durch Vernachlässigung, schließlich durch körperliche oder seelische Gewalt bedingt waren. Das Ausweichen, das Fliehen machen diese Konflikte nicht ungeschehen. Sie führen nicht zu einer Lösung der Konflikte. Vielmehr bestehen diese fort, ohne dass sich das Individuum dessen bewusst sein muss. Es sind zwei Annahmen, die die Aussagen zum Lebensrückblick so bedeutsam machen: Zum einen die Annahme, dass gerade im hohen Alter, bedingt durch die als »bedrängend«, wenn nicht sogar als »bedrohlich« erlebte Verletzlichkeit und Endlichkeit, abgewehrte (und damit ungelöste) Konflikte wieder thematisch werden, das heißt in das Zentrum des Bewusstseins treten; ganz ähnliches gilt für die seelischen Verletzungen, denen das Individuum im Lebenslauf ausgesetzt war und die es zum Zeitpunkt ihres Auftretens nicht innerlich verarbeiten konnte (Radebold, 2015a,b). Zum anderen die Annahme, dass auch im hohen Alter das Potenzial besteht, derartige Konflikte und Verletzungen auch nachträglich zu verarbeiten, diese auch im Rückblick auf das Leben innerlich zu überwinden. In dieser Annahme, die sich auch durch die Psychotherapieforschung eindrucksvoll belegen lässt (Heuft, Kruse & Radebold, 2006; Maercker, 2014), drückt sich die Bedeutung aus, die psychische Prozesse im hohen Alter für die Gesamtgestalt des Lebens besitzen. Und wenn ich hier von Gesamtgestalt des Lebens spreche, so meine ich damit auch die Einstellung und Haltung zum Tod: Denn diese bestimmt die Gesamtgestalt des Lebens mit – ob dies dem Individuum bewusst ist oder nicht.
Entwicklung der Persönlichkeit
Wenn es heißt, dass die Entwicklung der Persönlichkeit über den gesamten Lebenslauf für deren Deutung von Verletzlichkeit, Endlichkeit und Tod von zentraler Bedeutung sei, so erwächst daraus eine weiterführende Frage: Was genau ist eigentlich unter Entwicklung der Persönlichkeit zu verstehen? Die Psychologie der Lebensspanne kann auf mehrere Modelle der Persönlichkeitsentwicklung blicken, die ausdrücklich auch von Entwicklungspotenzialen im hohen Alter ausgehen (Kessler, Kruse & Wahl, 2014). Aus diesen Modellen sei eines ausgewählt, das für ein tiefes Verständnis der Einstellung und Haltung des Menschen zum Tod besonders fruchtbar ist und dabei in der (Fach-)Öffentlichkeit auf großes Interesse stieß und stößt. Gemeint ist hier das von dem (deutsch-)US-amerikanischen Ehepaar Erik Homburger Erikson (1902–1994) und Joan Mowat Erikson (1903–1997) erarbeitete Entwicklungsmodell (Erikson, 1998; Erikson, Erikson & Kivnick, 1986).
Diesem Modell zufolge durchläuft (oder vielleicht besser: durchlebt) das Individuum in seinem Leben acht psychosoziale Krisen, wobei jeder Lebensphase eine spezifische Krise zuzuordnen ist. Die Tatsache, dass das Ehepaar Erikson von Krisen und nicht von Entwicklungsaufgaben spricht (wie dies andere Autorinnen und Autoren tun), weist auf die erste Besonderheit dieses Modells hin. Diese lässt sich dann eher verstehen, wenn man die Herkunft des Wortes »Krise« bedenkt: Dessen Ursprung liegt in dem altgriechischen Wort krinein (κρίνειν), was übersetzt bedeutet: scheiden, entscheiden. Das heißt: In den einzelnen Lebensphasen scheiden sich zwei mögliche Entwicklungspfade voneinander, und dem Individuum ist die Aufgabe gestellt, jenen Entwicklungspfad zu beschreiten (man könnte auch sagen: sich für jenen Entwicklungspfad zu »entscheiden«), der eine weitere Differenzierung der eigenen Persönlichkeit beschreibt. Die Umschreibung der acht psychosozialen Krisen ist demnach so angelegt, dass ein positiver, der weiteren Differenzierung der Persönlichkeit förderlicher Entwicklungspfad einem negativen, der weiteren Differenzierung der Persönlichkeit abträglicher Entwicklungspfad gegenübergestellt wird. Die zweite Besonderheit dieses Entwicklungsmodells liegt in der Annahme, dass die Krisen im Lebenslauf immer auch als psychosoziale zu verstehen sind. Das heißt, neben den biologisch-genetischen Entwicklungseinflüssen sind auch soziale Einflüsse zu berücksichtigen, wie sich diese in Erziehungs-, Lern- und Bildungsprozessen sowie in gesellschaftlichen Vorstellungen »gelungener Entwicklung« in den einzelnen Lebensphasen niederschlagen. Natürlich liegt hier die Frage nahe, ob ein derartiges Entwicklungsmodell kulturübergreifende Bedeutung beanspruchen kann und zudem unabhängig von den Zeitperioden ist, in denen sich die Entwicklung eines Individuums vollzieht. Doch gehen wir einmal davon aus, dass ein derartiges Entwicklungsmodell für den westlichen Kulturkreis – und sogar noch über diesen hinaus – wie auch für die heutige Zeit Gültigkeit beanspruchen kann (Dunkel & Harbke, 2017), dann ist es sinnvoll, in diesem Modell auch eine bedeutende entwicklungspsychologische und lebensgeschichtliche Rahmung für die Einstellung und Haltung des Individuums zu Verletzlichkeit, Endlichkeit und Tod zu sehen.
Читать дальше