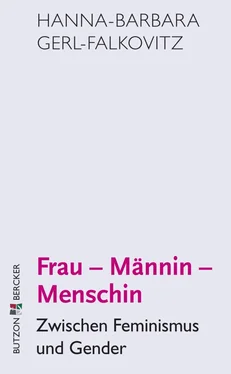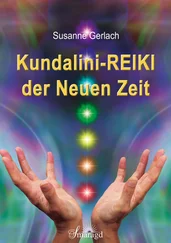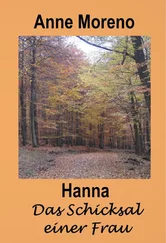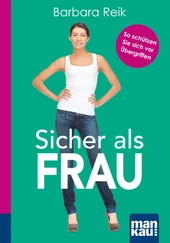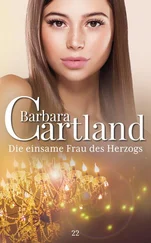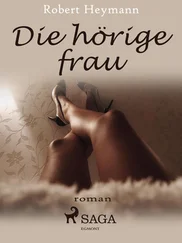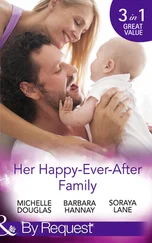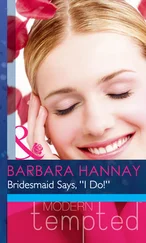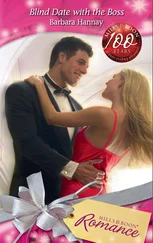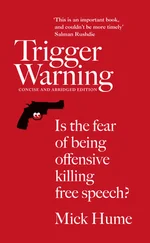Diese letzte Folge eines ursprünglich entdeckungsfreudig, ja im Namen der Freiheit vollzogenen Ansatzes kann zwar nicht einfach anklagend der mentalen Struktur zur Last gelegt werden; dennoch ist ihre geistige Weichenstellung deutlich auszumachen. Dass die damals verborgenen Rückseiten einer Denkhaltung mit der Technikkritik seit der Mitte des 20. Jahrhunderts zum Vorschein kommen, weist auf die Notwendigkeit einer Überholung des einst Gewonnenen hin.
Sofern der Logos die Welt des Mannes durchdringt und durchdringend klärt, wird alles Nicht-Logosbestimmte gerichtet und ausgeschlossen. In dieser Welt des Exklusiven rückt die Frau entschieden auf die Seite des zu Bändigenden, das unter den Schleier gehört, in dieses Dunkel, in dem sie ohnehin „zuhause“ ist, das aber in der Kleidung noch einmal betont wird mit dem Verbinden der Mundpartie, der Unsichtbarkeit ihres Körpers, der Alterslosigkeit unter den schwarzen Gewändern, dem Gesichtslosen. Deutlicher und dualistischer als zuvor gerät die Frau auf die Seite nicht nur des Verborgenen, sondern notwendig des Dienenden. Dies gilt kulturübergreifend auch für die „Achsenzeit“ in China; Konfuzius wird der Satz zugeschrieben: „Nur eine unwissende Frau ist tugendhaft.“ 58
Wenn sie an der männlich geprägten Welt teilnimmt, dann zweitrangig, falls nötig maskulinisiert, wie die Bildungsgeschichte (oder Legende?) an den mönchisch oder männlich verkleideten mittelalterlichen Frauen zeigt. In einer Reihe von Kulturen, besonders der europäischen, gelangt die Frau auch zu einem gewissen Recht, ohne dass ihr dies jedoch ursprünglich, vielmehr nur abgeleitet zukommt. 59Der Geschlechter„kampf“ kann von mehrfachen Vollzügen her bestimmt sein: vom „Benutzen“ der Frau als Gebärerin, während sich Liebe im individuellen Sinn von Mann zu Mann aufbauen kann wie im antiken Griechenland; vom Einsetzen der Frau als Arbeitskraft oder auch als Mitgiftbringerin (bis zum heutigen Tag finden sich „Mitgiftmorde“ zum Zweck einer zweiten Heirat in Indien). Die starke Geschlechterspannung entwickelt freilich auch den personalen Bezug, etwa im Minnedienst, im Gedanken der Einzigkeit der Geliebten, sogar der unglücklich Geliebten. Und es gelingt auch, die Liebe als die eigentliche „Versöhnung“ des Kampfes zwischen den Geschlechtern zu erfassen, wie es Hegel in den Vorlesungen über Ästhetik II versucht. Dennoch, auch bei Hegel in der Rechtsphilosophie von 1821 (§§ 161 – 169) gilt als Regel die hierarchische Überordnung des Mannes über die Frau als das Gegebene; im Recht wird nur nachvollzogen, was die Natur ohnehin eingerichtet hat. 60
Diese (noch) vertraute Welt sei mit den wenigen Hinweisen nur angedeutet; gerade hier ist das Forschungsmaterial überreich und muss deswegen als Porträt einer Denkhaltung nicht gänzlich ausgezeichnet werden.
Für den Gottesbezug des Menschen wird notwendig die Vatergestalt in ihrer befreienden Größe einsichtig und erfahrbar. Gerade, wo die Vaterwelt und das Gottesbild mit ihr neu befragt werden müssen, ist es wesentlich, sich auch den gedanklichen Durchbruch dieser Theologie deutlich vor Augen zu halten, sonst gelangt man in jene Unklarheit, die keine echte Lösung bringt, sondern ein Zurück. So ist zunächst hervorzuheben, dass sich der Vaterwelt, gestützt von Judentum und Christentum, Folgendes verdankt: Die vielen numinosen Mächte und Gewalten werden nun von einem Einzigen, dem Einzigen, in Schranken gehalten, und mehr als das: Sein Gegenüber, der Mensch, muss sich nun ebenso einzeln, ichhaft vor ihm verantworten. Die grundsätzliche Entdeckung nicht nur des Vatergottes, sondern auch der Person findet Ausdruck etwa in der Gestalt des Mose, der gegen das Volk ein Ich setzt in jenem heiligen Zorn, in dem die Gruppe nicht mehr gilt, nicht mehr das bisher gehabte Wir, nicht mehr das Kindhafte, das selber nicht unbedingt entscheiden muss, schon gar nicht entscheiden darf, sondern jenes innerste und tiefste Getroffensein von einem Anruf, für den der Einzelne einzustehen hat, wenn es sein muss bis zum Martyrium. Religionsgeschichtlich kennen nur Judentum und Christentum den Martyrer 61, aus dem Grunde, weil die mythisch-religiöse Bindung ein Rücktauchen voraussetzt in das, was alle denken, alle glauben, während hier etwas anderes sein Recht fordert: die Unersetzlichkeit des eigenen Standpunktes, eingefordert vom lebendigen Gott. Es ist wohl nicht einfach eine menschliche Entdeckung, sondern eben tatsächlich Durchbruch der Offenbarung, dass Gott anders ist als die Welt – während in den mütterlichen Kulturen Erde, Sonne, Mond, die Elementarkräfte der Welt immer auch dämonisch-göttliche Mächte waren. Gott ist anders als diese Welt, nicht identisch mit der Erde, nicht identisch mit der Fruchtbarkeit, nicht identisch mit Sexualität: eine Grundaussage Israels gegen Kanaan. Ebenso tief greifend die Offenbarung, die auf diesem unerschütterlichen Element aufruht, dass Gott gut ist, licht, ewig, Einer – Formulierungen, die nicht einer früheren Zeit angehören, wo sich helldunkle, unentscheidbare Potenzen, wo sich religiöse Urangst und religiöses Opfernmüssen mischen, wo ein unbekanntes Dunkel befriedet werden muss.
Gerade am Vater wird nun die entschiedene Eindeutigkeit des Guten offenkundig: „Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm“ (1 Joh 1,5) – während in der mythischen Polarität Licht und Finsternis in den Göttern (oder Gott und Teufel) sich die Waage halten. Auch die Zeit wird nun in ihrem Entscheidungscharakter erkannt; mit der Sprengung der antiken Kreisform wird das Empfinden der Wiederkehr des Gleichen und damit der Gleichgültigkeit des Geschehens aufgehoben. Geschichte wird unwiederholbar, weil fortschreitende Heilsgeschichte, wie im großen Entwurf des Augustinus in De civitate Dei ; dies drückt sich in der Jahreszählung seit Christi Geburt aus. Damit setzt eine ungeheure Befreiung aus dem Ungegliedert-Richtungslosen des bloßen Nacheinanders der Jahre ein. (Demgegenüber ist übrigens das Kirchenjahr auf die gegenwärtige Erinnerung des Immergültigen gegründet.) So bringt die Vatergestalt Gottes das Bewusstsein von Endgültigkeit: nicht zuletzt vom unwiderruflichen Angenommensein im Guten, von der Durchsetzung des Rechtes und der Gerichtetheit, auch der Geistigkeit gegenüber dem Ungeordneten und Doppeldeutigen. Altes wie Neues Testament lassen sich daraufhin durchprüfen, wie verflochten die Bildlichkeit von Recht, Licht, Sonne, Gesetz und rechts sind; als auffälliges Beispiel dient Psalm 96: „Es freuen sich die Städte Judas deiner Urteile wegen, o Herr (. . .), ein Licht geht auf dem Gerechten und Freude den Rechtschaffenen im Herzen.“ 62Und in der Apostelgeschichte spricht Paulus einen Pseudopropheten an: „Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, die rechten Wege des Herrn zu verdrehen? Nun ist die Hand des Herrn über dir, blind wirst du sein und die Sonne nicht sehen.“ (Apg 13,5 – 12)
Paulus spricht von jenem „Vater“, der die „Söhne“ ein für allemal adoptiert hat (Gal 4,5). Er gebraucht damit das Bild des römischen Vaters, der sein Kind nach der Geburt vom Boden aufhebt, es betrachtet und „entscheidet“, ob es rechtlich gesehen das seine ist. Hat er das Kind einmal angenommen – und diese Entscheidung zu Ja und Nein ist möglich –, so bleibt der Entschluss unverbrüchlich. Paulus benutzt die römische Rechtssprache, um die geistige Entschiedenheit, die Nichtumkehrbarkeit dieses Vorgangs auszudrücken, womit der Vatergott die Söhne adoptiert. Damit setzt nicht einfach eine Unterdrückungsgeschichte der mütterlichen Seite in Gott ein, sondern auch ein Durchbrechen von Qualitäten. Denn wenn Gott unerschütterlich zum Menschen entschlossen ist, heißt das wohl, dass auch der Mensch ihn immer ansprechen kann, ohne Angstschrei, ohne Opferzwang. Es ist jene Form des Gegenübertretens in Freiheit, das Nicht-mehr-Ausgeliefertsein, von dem Kierkegaard scharf beobachtend sagte, seit Jesus Christus seien die Menschen „frech“ geworden. In der Tat ist diese „Frechheit“ im Gegenentwurf gegen das Heidentum mitgegeben; denn wo die Treue Gottes so unverbrüchlich wird, wird selbst die Hölle zum Ort menschlicher Willensrichtung, nicht mehr aber – wie in der griechisch-römischen Antike – zu einem aufgezwungenen, unentrinnbaren Ort der schattenhaft Toten. Nochmals Paulus in einem von Grund auf klärenden Text: „Denn der Sohn Gottes (. . .) war nicht Nein und Ja, sondern in ihm war das Ja. Denn alle Verheißungen Gottes finden durch ihn das Ja.“ (2 Kor 1,19 f.)
Читать дальше