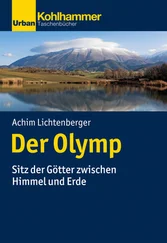Die Top-Schlagzeile des nächsten Tages lautete: „Die sechs Finger des Nikolaus“.
Wissen Sie, was mit Ihnen nicht stimmt? Ich verrate es Ihnen. Sie sind einfach zu perfektionistisch, was die Ergebniserwartung anbetrifft.
Was Sie propagieren, ist eine Philosophie des Zauderns. Das übertriebene Nachdenken und Verharren ist der Vetter der Trägheit und die Vorstufe des Müßiggangs, der sich gerne in sehnsüchtigen Konjunktiven wie „hätte“, „müsste“ und „könnte“ artikuliert. Attribute der gewollten, aber niemals vollzogenen Veränderung führen zu einem fühlbaren Knirschen im Weltgefüge und letztendlich zu einem Stillstand, der die Räder des Fortschritts blockiert. Man kann diese Dinge in jedem halbwegs gelungenen Deutsch- und Geschichtsunterricht lernen, wenn man Ohren hat zu hören.
Wer erschauert nicht angesichts des Verderben bringenden Zauderrhythmus des K., den Kafka seine „dauerhaft gezauderten Wege“ in seinen Labyrinthen nehmen lässt? Zu welcher Elendsgestalt wandelt sich der selbstherrliche Wallenstein in dem Drama Schillers, als er sich um die Wende des 18. Jahrhunderts in ein Knäuel verschiedener Handlungsmöglichkeiten verstrickt sieht und das Zögern zur Maxime seines Handelns macht? Warum zögert in der Orestie des Aischylos der tragische Held, bevor er seine Mutter Klytaimnestra ersticht, obwohl er von der Notwendigkeit seines Tuns überzeugt ist?
Hat der Limbo-Zustand zwischen dem „nicht mehr“ und dem „noch nicht“ irgendetwas Gutes hervorgebracht außer dem törichten Lob, dass tiefe Denker methodisch zaudern, weil sie die negativen Folgen einer Affekthandlung abwehren wollen? In der ganzen Diskussion um Abwägung und Verhältnismäßigkeit wollen wir doch nicht vergessen, dass es die beherzten Macher sind, denen die Durchbrüche gelingen, die die Welt in Atem und am Laufen halten.
Genau das hatte ich aus uneigennützigen Motiven getan. Die öffentliche Meinung war auf meiner Seite. Das ein oder andere bigotte Blatt rief zwar halbherzig dazu auf, der Perversion, wie sie ihrer Meinung nach in der Absteige geschehen war, ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, aber die Mehrzahl der Medien schnürten aus der homoerotischen Skandalgeschichte eine spannungsgeladene und mysteriöse Fortsetzungsstory mit nachgestellten Bildern und aufgeputschten Details. Ein besonders engagiertes Boulevardblatt hatte die Witwe des Fleischers überredet, ihr die Exklusivrechte an dem Hintergrundmaterial ihrer Ehe zu überlassen und veröffentlichte in loser Folge Fotos des verstorbenen Benedikt im Kommunionsanzug und als Messer schwingender Metzger, Aufnahmen einer mehr als traditionell begangenen Hochzeit in weißem Kleid, Spangenschuhen, voll hochfliegender Hoffnungen und düster illustrierte Familiengeheimnisse, deren Bedeutung im Halbdunkel blieben.
Die Umsätze der Messerindustrie zogen augenblicklich an und die Schwulenvereinigung rief zu einem Protestmarsch gegen Diskriminierung auf, der von den Linken unterstützt wurde. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen und vermutete persönliche Motive hinter der bizarren Tat. Goldlocke hieß in Wirklichkeit Stefan und entstammte einer einflussreichen Industriellenfamilie, die für Hinweise, wer ihren Sohn entführt und in hilfloser Lage in einem zweifelhaften Etablissement erstickt hatte, eine stattliche Belohnung ausgesetzt hatte. Nach der Lesart seiner Familie war ihr Sohn ein drogen- und skandalfreier junger Mann mit vielversprechenden Talenten und einer ganz und gar heterosexuellen Neigung, die er schon früh durch eine Verlobung mit einer untadeligen Elevin aus besseren Kreisen unter Beweis stellte. Der Betreiber des „Palais d’Amour“ wurde von Goldlockes Familie für die erlittenen Unbilden und dafür entschädigt, dass er bestätigte, den tragisch ums Leben gekommenen Sohn niemals zuvor gesehen zu haben. Im Überschwang der Gefühle fügte er ungefragt gerne hinzu, dass der junge Mann mitnichten schwul gewesen sein könne, so als ob er aus gefesselten nackten Leichen den Charakter herauszulesen vermochte.
Susi, die Frau des Metzgers, zeigte sich verweint und fotogen auf manchem Titelblatt und präsentierte ihre nichtssagende Geschichte einer Routineehe mit Routineproblemen und Routineannehmlichkeiten. Sie verneinte, von den Neigungen ihres Mannes gewusst zu haben und das einzig Sensationelle, das ein Magazin ausgrub, war ein Foto des angeheiterten Paares in Karnevalsverkleidung nach dem Besuch der „Rocky Horror Picture Show“. Alle interessierten Kreise verständigten sich stillschweigend auf einen Mord im Milieu und die Erkenntnis, dass das Herz eines biederen Fleischers unergründlich und abgründig sei. Susi hatte es nicht mehr nötig zu arbeiten, denn in ihrem Fall zahlte die Lebensversicherung schnell und ohne Aufsehen. Wenn es stimmt, was die anderen in der Suppenküche sagten, verabschiedete sie sich wegen des ganzen Rummels um ihre Person mit einer Mischung aus Wehmut und spürbarer Erleichterung. Sie träumte von einer Eigentumswohnung und einem erfüllten Leben an der Seite eines Mannes, der ihre Kochkünste und ihren Körper gleichermaßen zu schätzen wusste. Sie würde es schaffen und nie erfahren, wer ihrem Glück auf die Sprünge geholfen hatte.
Wie Sie richtig bemerken, hatte jeder etwas von meinem Eingreifen – außer mir. Ich hatte mir die Kleidung und ein Stück weit meine Nerven ruiniert. Ich war das Risiko eingegangen, dort stümperhaft zu agieren, wo ich keine Routine hatte. Andererseits – sollte ich etwa zuerst das Ausbeinen und Nähen erlernen, bevor ich zur Tat schritt? Hier schließt sich der Kreis der Argumente. Besser ist ein unvollkommenes Ergebnis in mehreren Anläufen als ein vollkommenes Zögern. So sehe ich das.
Meine Erfahrung mit der Sache war, dass es sich einfacher mit dem Prädikat lebte, ein großes Arschloch zu sein als ein menschenfreundlicher Altruist. Altruisten nimmt man im Alltag als gegeben hin. Es sind die Freiwilligen, die sich ehrenamtlich um andere kümmerten, die Helden des Alltags, denen man vor der Silvestergala mit warmen Worten öffentlich dankt, um sie möglichst schnell zu vergessen. Altruisten sind farblose oder fanatisch auf Gut gepolte Wesen, das schlechte Gewissen der Gesellschaft, der schmerzhafte Pickel auf der Seele, der eigenes Engagement einfordert. Man trifft sie in Kirchen und Gemeindezentren, bei elitären Wirtschaftsvereinigungen und in Vereinen, die sich um Erdbebenopfer in Südamerika, Mukoviszidose-Kranke und den vom Aussterben bedrohten gelbfleckigen Feuersalamander in den Alpenregionen sorgen. Überall tummeln sie sich und treten mittlerweile massiert in jeder Form und Gestalt auf.
Ich hatte nicht vor, mich an derartigen Aktivitäten zu beteiligen. Ich hatte ein für mich passendes Konzept gefunden, das mir die gesamte Verantwortung aufbürdete, aber auch die maximale Handlungsfreiheit beließ. Was ich von den anderen lernen konnte, war, dass Altruisten zugleich Arschlöcher sein konnten. In den Sprüchen des weisen Salomo heißt es, dass man dem Stier, der da drischt, nicht das Maul verbinden soll. Falls Ihnen diese Aussage zu kryptisch erscheint, wiederhole ich sie gerne: Für gute Arbeit soll man auch einen angemessenen Lohn erhalten, und wenn kein solcher geboten wird, muss man improvisieren. Wie Sie wissen, bin ich ein Meister der Improvisation und von meiner Grundeinstellung einem kleinen Kompensationsgeschäft für meine Mühen nicht abgeneigt. In Altruisten-Kreisen nennt man diesen Vorgang Aufwandsentschädigung. Wenn man es richtig anstellte, konnte man auch bei gemeinnützigen Aktionen eine angemessene Entlohnung erwarten. Ich wusste noch nicht genau, wie ich es anstellen würde, aber allmählich reifte ein Plan heran, den ich recht bald umzusetzen gedachte.
In der Zwischenzeit versuchte ich mir nicht allzu viele Sorgen zu machen und ertrug die erstickende Enge in der Wohnung meiner Mutter, wie es nur ein in sich ruhender Wünscheerfüller zu tun vermag. Nun, so ganz ruhte ich nicht in mir selbst, denn flüchtige Gedanken an das Mädchen im Bus und ein allgemeines Gefühl der Beklemmung belasteten mich. Es ist einfach nicht das Richtige, sich als selbstständiger junger Mann in einer gewerblich genutzten Dienstwohnung einzuigeln und in Schulbücher zu starren, während das Leben vorbeizieht, als hätte es mit einem nichts zu schaffen. Eine Zeit lang trotzte ich den eisigen Temperaturen und frequentierte Spielhallen und Hinterhofkasinos, wo ich bulgarische Fälschungen in beste Währung transformierte. Niemand beachtete den schlaksigen Mann, der sein Geld in homöopathischen Dosen einsetzte und wie ein Schatten verschwand, wenn er einige Scheine getauscht hatte.
Читать дальше