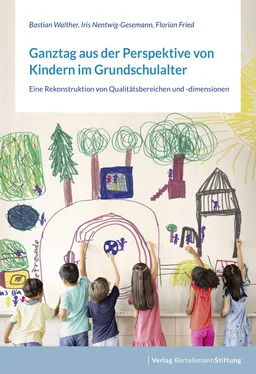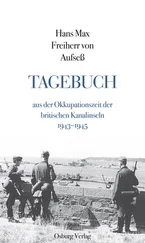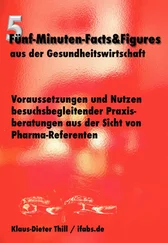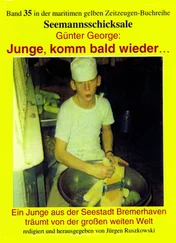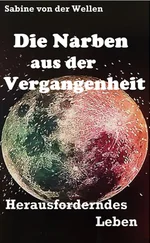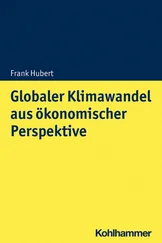Für die Kinder bedeutet dies auch, dass sie immer früher und länger mit (überwiegend weiblichen) Erwachsenen konfrontiert sind, die für die (sozial-)pädagogische Arbeit mit Kindern ausgebildet wurden. Kinder erleben und gestalten also immer mehr Beziehungen mit, bei denen es sich in einer primären Rahmung um rollenförmige Beziehungen handelt – in der Grundschule begegnen Schüler:innen Lehrkräften und anderen pädagogischen Professionellen, die zum einen für ihre Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Kindern bezahlt werden und zum anderen einen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen haben. Auch die Kinder sind hier mit bestimmten Rollenbildern und -erwartungen an ihr Schulkindsein konfrontiert und unterliegen damit normativ-kontrollierenden Erziehungs- und Bildungsvorstellungen.
Ist auch die verbleibende Freizeit von Kindern stark an institutionalisierte Freizeitangebote gebunden – Fölling-Albers (2000: 124) spricht diesbezüglich von einer »Scholarisierung« der Freizeit –, ist von einer Dominanz pädagogischer bzw. pädagogisierter Räume auszugehen: Kindheit vollzieht sich in speziell für Kinder vorbereiteten Räumen und wird von speziell ausgebildeten Fachkräften begleitet. Hitzler sprach schon 1995 von einer »Zerstückelung und Entsinnlichung der Raumerfahrung aufgrund der Spezialisierung und Differenzierung von Räumen« (Hitzler 1995: 131). Je spezialisierter Außen- und Innenräume zudem sind und je mehr sie auf Kinder zugeschnitten werden, umso weniger Gestaltungsmöglichkeiten bleiben den Kindern, die Räume mit ihren Spielideen zu beleben und sie im Sinne von Muchow zu »überlagern«, zu »durchwachsen« und »umzuleben« (Muchow und Muchow 2012: 160).
Nicht nur die weitgehend unbeaufsichtigte »Straßenkindheit« bzw. Draußen-Kindheit ist passé (Zinnecker 1990), sondern auch die Zeiten und Räume, in denen Kinder sich selbst in Peergroups organisieren und Kinderkulturen (Klaas et al. 2011) entfalten können, werden kürzer bzw. weniger. Und mehr noch stellt sich die Frage, ob das Spielen als ko-konstruktive und freie Aktivität (Youniss 1994), die Kindern über die UN-Kinderrechtskonvention als Recht verbrieft ist, sich in einer institutionalisierten und pädagogisierten sowie »verhäuslichten« Kindheit (Zinnecker 1990) noch hinreichend gut und lange entfalten kann.
Den Überlegungen von Zinnecker (2001) folgend, der die Bedeutung der Straße als »gesellschaftlichen Handlungsort für Kinder« herausgearbeitet hat, stellt sich auch in Bezug auf den Ganztag (als einem ganztägigen Lebensort für Kinder) die Frage, ob und wie er zum einen Lernraum und zum anderen Lebensraum sein kann. Zinnecker (ebd.: 83) formuliert: »Zunächst ist der Lebensraum Straße auf Bewegung und Beweglichkeit ausgerichtet und stellt somit ein Gegenmilieu zur eingrenzenden, abschließenden Welt der Familie und anderer pädagogischer Einrichtungen dar. Hier können Kinder ohne Kontrolle ihre Umwelt erkunden, auf Entdeckungsreise gehen. Andererseits nutzen sie diesen öffentlichen Raum auch, um ihre Kompetenzen zu präsentieren.« Aus heutiger Perspektive ist der »Handlungsort Straße« als Metapher zu lesen: Die institutionalisierte Kindheit gewährleistet allen Kindern auch ein Mehr an Schutz und Förderung und trägt zur Bildungs- und Chancengerechtigkeit bei. In Überlegungen zur Qualität des Ganztags muss aber zweifelsfrei die Bedeutung von Explorations- und Bewegungsräumen für Kinder einbezogen werden.
Folgen wir hier weiter den Ergebnissen zweier Studien von Blinkert (Blinkert 1993; Blinkert et al. 2015), ist Kindheit heute vor allem geprägt von einem Verlust an Aktionsräumen bzw. einer zu geringen »Aktionsraumqualität« im Wohnumfeld von Kindern. Unter Aktionsräumen werden Räume verstanden, »welche für Kinder frei zugänglich sind und ein gefahrloses, gestaltbares Territorium mit Interaktionschancen darstellen« (Blinkert 1993: 7 f.). Dort können Kinder sich wild und ein bisschen riskant bewegen ( Bewegung), Neues, Unerwartetes, Herausforderndes und Unbekanntes entdecken und tun ( Kontingenz und Vielfalt), sich von unablässig sichernden und kontrollierenden Erwachsenen entfernen ( Selbstständigkeit und Selbstbestimmheit ) und lernen, (Mit-)Verantwortung für die Gemeinschaft und Regeln des Miteinanders zu übernehmen ( Peer-Gemeinschaft ). Eine Studie von Weidel (2015) zeigt, dass Kinder in besonderer Weise sozialraumorientiert sind: Sie sind daran orientiert, »in der sie umgebenden Umwelt selbstständig Orte auf(zu)suchen, die ihnen interessant und erlebenswert erscheinen und die somit zur Basis von Lernerfahrungen werden. […] In den meisten Fällen stellten diese keine gesondert für Kinder konzipierten Bereiche dar« (ebd.: 60 f.).
Damit wird die Orientierung der Kinder daran, Räume zu erkunden, sie sich anzueignen, umzugestalten, zu umleben und an ihrer Qualität mitzuwirken, unterstrichen. Und damit werden Potenziale des Ganztags deutlich: Das Erkunden, Erschließen und Erspielen von Aktionsräumen kann Kindern sowohl innerhalb als auch außerhalb der physischen Räume, in denen ganztägige Erziehung, Bildung und Betreuung gewährleistet wird, ermöglicht werden.
Qualitätsentwicklung und Professionalisierung im Feld des Ganztags
Qualität kann nur in Bezug auf bestimmte, die Qualitätsentwicklung orientierende, Ziele bestimmt, untersucht und weiterentwickelt werden. Zudem haben verschiedene Akteur:innen bzw. Akteursgruppen unterschiedliche Perspektiven auf die – vom eigenen Standort und aus dem eigenen Erleben heraus wahrgenommene – Qualität von etwas.
In Bezug auf das aktuelle Bildungs- und Qualitätsverständnis von Ganztagsschulen spiegelt auf der Ebene der Ideal- bzw. Zielvorstellungen die folgende Definition den fachwissenschaftlichen Diskurs wider: »Unter der Prämisse, dass Ganztagsschule einem gegenüber reinem Fachlernen aber auch ›bloßer Aufbewahrung‹ der Schüler/-innen erweiterten Bildungsverständnis folgt, ist die umfassende Entwicklung der Persönlichkeit der Schüler/-innen Ziel von Bildung und Erziehung in der Ganztagsschule. (…) Zu betrachten sind demnach nicht nur die Lernfortschritte der Schüler/-innen im kognitiven Bereich, sondern auch fächerübergreifende Wirkungen auf z.B. Motivation, Wohlbefinden und soziales Lernen in Abhängigkeit schulischer Qualitätsmerkmale« (Fischer et al. 2012: 24). Erkennt man die Gültigkeit dieser sehr allgemein gehaltenen Kriterien für den aktuellen Diskurs zum Thema Ganztag und seiner Qualitätsentwicklung an, stellt sich dennoch die Frage, aus wessen Perspektive Qualität beschrieben und bewertet wird, wer dabei mitreden kann und wer nicht. Werden über wissenschaftlich fundierte Kriterien hinaus auch die Qualitätsvorstellungen von Trägern, Fachkräften und Eltern einbezogen? Wird vor allem den Kindern in dieser sie unmittelbar betreffenden Angelegenheit das Gehör geschenkt, das ihnen rechtlich verbrieft ist?
Eine konsequent interperspektivisch konzipierte Qualitätsentwicklung (vgl. Nentwig-Gesemann et al. 2021) impliziert, dass es weder für den empirischen Zugang zu Qualität noch für die praktische Herstellung von Qualität und die Qualitätsentwicklung ausreicht, wenn die verschiedenen Perspektiven nebeneinander gedacht und behandelt werden. Vielmehr muss es darum gehen, das Zusammenspiel der diversen Ebenen und Akteursgruppen, die wechselseitigen Wirkmechanismen und Spannungsfelder zwischen Norm und Habitus, die bei ihrem Aufeinandertreffen entstehen, in den Blick zu nehmen und zu bearbeiten. Die Kernprinzipien einer solchen Qualitätsentwicklung sind Transparenz, Diskurs und Kompromissfreundlichkeit.
Ohne Zweifel zählen die pädagogischen Fachkräfte zu den qualitätsrelevanten Akteursgruppen im Ganztag: Sie müssen – in den gegebenen Rahmenbedingungen – tagtäglich und in der direkten Interaktion mit den Kindern (und Eltern) professionell agieren und die Qualität des Ganztags als Lern- und Lebensort hervorbringen. Darüber hinaus sind sie als Mitglieder eines pädagogischen Teams mit der Erwartung konfrontiert, den Ganztag als Organisation so weiterzuentwickeln, dass er den an ihn gerichteten Erwartungen gerecht wird. Die Rede vom Ganztag als »Schule der Zukunft« und die damit verbundenen Hoffnungen auf »eine Neuordnung des Lernens durch die Verbindung von fachlichen und überfachlichen Gegenstandsbereichen« (Jürgens 2018: 5 f.) schrauben die Erwartungen in die Höhe und bleiben zugleich – zwangsläufig – diffus. Im Sinne eines »Doing Ganztag« kann die Qualität (hier im Sinne von Beschaffenheit) der ganztägigen Erziehung, Bildung und Betreuung nur in komplexen Wechselwirkungsbeziehungen hergestellt werden, zu denen neben den Menschen auch Programmatiken, Strukturen, zeitliche und räumlich-materiale Settings gehören.
Читать дальше