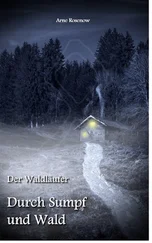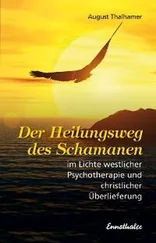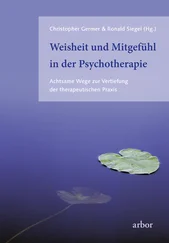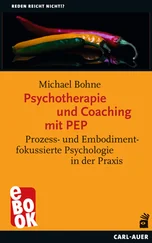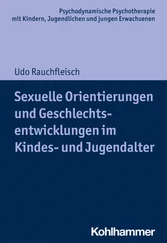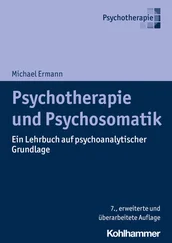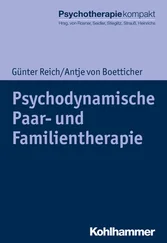2.9.3 Donald W. Winnicott
Eine prominente Rolle in der Geschichte der psychodynamischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie nimmt Donald W. Winnicott (1896–1971) ein, britischer Kinderarzt und Psychoanalytiker. Er geht von der mütterlichen Fürsorge als grundlegend für die psychische Strukturbildung aus. Der Säugling existiert in einer mütterlichen Umwelt: »there is no such thing like a baby … if you set out to describe a baby, you will find you are describing a baby and someone.« (Winnicott 1974, S. 50). Ein Säugling ist ohne einen fürsorglichen Anderen nicht vorstellbar. Die frühe mütterliche Umwelt wird vom Säugling nicht als »Nicht-Ich erlebt. Erst mit zunehmender Ich-Reifung differenzieren sich Subjekt und Objekt.
Die mütterliche Fürsorge besteht im »Halten«, das gleichermaßen ein physischer und psychischer Vorgang ist. Er vermittelt dem Säugling Schutz, psychisch gesehen vor allem Reizschutz, stellvertretende Affektberuhigung und -modulation sowie Integration. »…die Kohäsion der verschiedenen sensomotorischen Elemente ist dem Umstand zu verdanken, dass die Mutter den Säugling hält.« (Winnicott 1974, S. 188).
Eine vollständige Bedürfnisbefriedigung ist eine Illusion. Mit zunehmender Reifung ist das Kind in der Lage, durch eigene Signale zu vermitteln, wessen es bedarf. Eine Mutter, die »gut genug« ist, wird dem Kind Raum geben für diese eigenen Signale und ihre Anpassungsleistungen zurücknehmen. »Unvollständige Anpassung an Bedürfnisse macht Objekte erst zu etwas Realem.« (Winnicott 1995, S. 21). Reifungsprozesse können also in zwei Richtungen gestört werden: Zum einen durch unverträgliche Unterbrechungen der Fürsorge – diese haben traumatischen Charakter. Zum andern durch eine elterliche Haltung, die in verwöhnender Voreiligkeit die Signale des Kindes überfährt. Wenn Mütter und Väter aufgrund eigener unverarbeiteter psychischer Konflikte oder Traumatisierungen das Kind zur Regulierung ihrer beschädigten Selbststruktur funktionalisieren, entspricht das Kind dieser elterlichen Bedürftigkeit durch eine Anpassungsleistung, die eigene Impulse unterdrückt, verdrängt oder abspaltet – es entsteht ein »falsches Selbst«.
Winnicott beschrieb Laute, Gesten, Worte oder einen Gegenstand, mit welchen sich das Kind Separationsprozesse vom primären Objekt erträglich macht, als Übergangsobjekte.
Ein Übergangsobjekt (ein Teddy, ein Kuscheltuch etc.) ist Teil des Selbst, aber auch ein »Nicht-Ich«, in ihm erscheint das Objekt, es gehört aber nicht ganz zum Objekt. Übergangsobjekte ermöglichen einen »intermediären Raum«, in dem Symbolisierungsprozesse reifen.
Als Übergangsphänomene lassen sich Fantasie, Kreativität, Kunst, religiöse Vorstellungen usw. verstehen. Die Psychotherapie stellt ebenfalls einen solchen »intermediären Raum« dar, in dem illusionäre Wünsche und Realität innerhalb einer therapeutischen Beziehung zueinander finden und durch ein reifendes Ich integriert werden können. Auch das Spiel des Kindes konstituiert intermediären Raum (  Kap. 4.6).
Kap. 4.6).
2.9.4 John Bowlby und die Bindungstheorie
John Bowlby (1907–1990, englischer Psychiater und Psychoanalytiker) entwickelte aus Beobachtungen von hospitalisierten Kindern, die früh von ihren Müttern getrennt waren, die Bindungstheorie. Die vergleichbaren Forschungen von René Spitz (1887–1974, österreichisch-amerikanischer Psychoanalytiker) kamen zu ähnlichen Ergebnissen: Nach anfänglichem Protest fallen die Kinder in Gleichgültigkeit, bei länger anhaltender Deprivation stellt sich die »anaklitische Depression« ein (Bowlby 1969, 1976, 1983; Spitz 1996). Bindung ist gemäß Bowlby ein primäres biologisch angelegtes Bedürfnis. Das Bindungssystem strebt nach Sicherheit, Schutz und Geborgenheit. Ohne die Sicherstellung dieser anaklitischen Bedürfnisse kann ein Kind nicht gedeihen. Komplementär dazu besteht das Explorationssystem. Ist das Bindungsbedürfnis befriedigt, ist das Kind fähig, sich von den primären Bindungspersonen zu trennen und die soziale und dingliche Welt zu erkunden. Steigt die Angst bei der Exploration, wird das Bindungssystem aktiviert und das Kind sucht Nähe, Schutz und Trost bei den Bindungspersonen.
Bowlby erforschte zusammen mit Mary Ainsworth (1913–1999, kanadische Psychologin, ab 1950 Mitarbeiterin von Bowlby) Bindungsverhalten und Bindungsstile mittels der »fremden Situation«. Nach einer Trennungssituation von der Mutter fielen die Reaktionen des Kindes beim Wiedersehen unterschiedlich aus: freudiges Begrüßen, Ablehnung und Wut, Teilnahmslosigkeit. Aus diesen Beobachtungen erschlossen Bowlby und Ainsworth verschiedene Bindungsstile: Sichere Bindung, unsicher-ambivalente Bindung, unsicher-vermeidende Bindung und desorganisierte Bindung.
Eine sichere Bindung entsteht durch die Feinfühligkeit der Bindungsperson, mit der sie die Signale des Kindes aufnimmt und versteht und dessen Bedürfnisse in einer angemessenen Zeitspanne und passgenau befriedigt.
Bindungsstile werden als Bindungsrepräsentanzen verinnerlicht und bilden die Grundlage für die Beziehungsgestaltung des Individuums. Sie sind nicht unveränderlich, können sich je nach Entwicklungsbedingungen modifizieren und sind auch psychotherapeutisch beeinflussbar. Eine sichere Bindung ist ein wesentlicher protektiver Faktor für die Entwicklung über die gesamte Lebensspanne. Risikofaktoren für die Bindungsentwicklung sind frühe Trennungen und Verluste, Erkrankungen der Eltern, Traumatisierungen – auch solche der Eltern, sofern sie nicht bearbeitet werden konnten (Brisch 2000, S. 58 ff.).
Die »Britischen Schulen« mit den zwei psychoanalytischen Zentren der Hampstead Child Therapy Clinic und der Tavistock Clinic forcierten v. a. die theoretische und praktische Ausarbeitung der Objektbeziehungspsychologie (Balint, Bion, Winnicott u. a.), zu der man auch die Bindungstheorie (Bowlby) zählen kann.
Der englische jungianische Analytiker Michael Fordham (1905–1995) knüpfte an die Vorstellung des Selbst bei C. G. Jung an. In der Jung‘schen Analytischen Psychologie ist das Selbst Organisator der psychischen Entwicklung, die vornehmlich in einem fortschreitenden Prozess der Individuation besteht mit dem Ziel einer persönlichen Ganzheit (Bovensiepen, S. 206). Fordham ging davon aus, dass es vorgeburtlich ein »ursprüngliches Selbst« gibt, ein ganzheitliches Wesen, das durch extrauterine Erfahrungen deintegriert wird und so Neues in sich aufnehmen kann – durch reintegrative Prozesse. Dieser Wechsel besteht das ganze Leben und formt die Persönlichkeit. In Kindertherapien wird dieser Prozess begleitet und seine Störungen korrigiert, wobei gemäß Jung’scher Vorstellungen der selbstregulativen Kraft der Psyche vertraut wird. Die Arbeit mit Symbolen, Märchen und Mythen erhält große Bedeutung (Lutz 2016). Aus der jungianisch geprägten Kindertherapie ging die Sandspieltechnik hervor (Kalff 2000), die mittlerweile in viele Behandlungsräume von psychodynamischen Kinder- und Jugendlichentherapeuten Einzug gehalten hat.
2.11 Heinz Kohut und die Selbstpsychologie
Das Selbst, seine Entwicklung und Funktionsweise steht im Mittelpunk der Selbstpsychologie, die auf Heinz Kohut (1913–1981) zurückgeht (Kohut 1973, 1979, 1989).
Unter dem Selbst versteht man die Gesamtheit der Person in Interaktion mit anderen.
Das Erleben einer eigenen Identität, das Gefühl, »ich selbst zu sein«, geht zurück auf einen intensiven Austausch mit einem anderen, wobei dieses andere Objekt als Teil des eigenen Selbst und seiner Bedürfnisse fungiert: ein Selbstobjekt. Von Anfang an brauchen Menschen Selbstobjekte zur Befriedigung von Selbstobjektbedürfnissen, so entsteht eine Selbstkohärenz: die möglichst kontinuierliche und zusammenhängende Selbstwahrnehmung in Raum, Zeit und Beziehungserleben. In diesem Streben nach Kohärenz ist das Bedürfnis nach Sinngebung enthalten: sich selbst als Zentrum von Wahrnehmungen, Antrieb und Handlungen sehen und erleben zu können.
Читать дальше
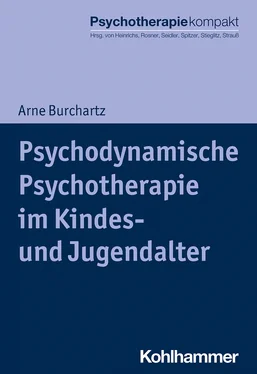
 Kap. 4.6).
Kap. 4.6).