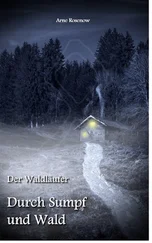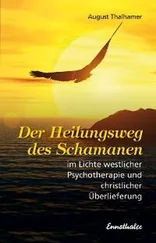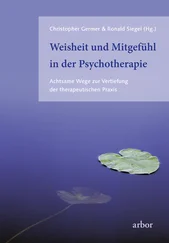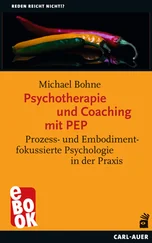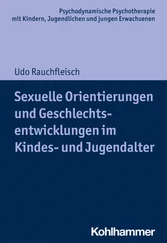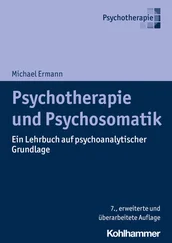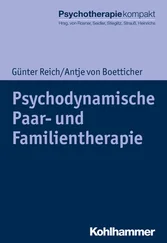Aus der »Zürcher Schule« gingen wesentliche Entwicklungen der psychoanalytischen Pädagogik, der Schul- und Heimpädagogik und der Erziehungsberatung hervor. Erst die »Wiener Schule« (H. Hug-Hellmut, A. Freud, M. Klein) erarbeitete eine therapeutische Kinderanalyse, in der das Spiel, die Übertragung und die Deutung als therapeutisches Agens im Mittelpunkt standen.
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Pädagogik und Psychoanalyse?
2.8 Die Kinderanalyse in Deutschland
Erfuhr die Kinderanalyse in Deutschland am Berliner psychoanalytischen Institut seit den 1920er Jahren insbesondere durch Max Eitingon, der 1923 Ausbildungsrichtlinien formulierte, Karl Abraham und Melanie Klein einen Aufschwung, so verlor ab 1933 »mit der Ausbreitung des Nationalsozialismus, der Emigration jüdischer Mitglieder bzw. Kinderanalytiker und der immer schwächer werdenden Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft (DPG) die junge, aufstrebende Bewegung – wie Anna Freud die Pionierarbeit der Kinderanalyse nannte – zunehmend an Halt.« (Müller-Brühn 2003, S. 97, vgl. auch Lockot 1994, S. 39 ff.). Heftige Auseinandersetzungen innerhalb der DPG, wie man sich gegenüber dem Anpassungsdruck der Gleichschaltung und zu dem neugegründeten »Deutschen Institut für psychologische Forschung und Psychotherapie« unter Leitung von Mathias Heinrich Göring verhalten sollte, führte schließlich 1938 zu deren Auflösung. Der unrühmliche Versuch einer »Rettung« der Psychoanalyse durch den Ausschluss jüdischer Mitglieder 1935 war gescheitert. Damit war auch die Kinderanalyse in Deutschland nicht mehr repräsentiert, die Weiterentwicklung erfolgte nun für lange Zeit in England, den USA, den Niederlanden durch Jeanne Lampl-de Groot, die eng mit Anna Freud zusammenarbeitete, und Frankreich, insbesondere nach dem 2. Weltkrieg, durch Françoise Dolto, Serge Lebovici und René Diatkine (Holder 2002, S. 43 f.). In den USA waren es v. a. die Emigranten, die das Interesse an der Kinderanalyse in die bereits bestehenden psychoanalytischen Institutionen einbrachten; erst ab den 1950er Jahren etablierten sich Ausbildungsgänge nach Vorbild der Hampstead Klinik.
2.9 Die Britischen Schulen
Kinderanalytikerinnen und Kinderanalytikern – seit 1952 durch formelle Ausbildungskurse an der Hampstead-Klinik ausgebildet (  Kap. 2.7.2) – wurde eine vollwertige Anerkennung durch die IPV (Internationale Psychoanalytische Vereinigung) lange Zeit verweigert – und damit der Kinderanalyse eine untergeordnete Rolle zugewiesen. Daran änderte sich auch nichts dadurch, dass an vielen Instituten in Nordamerika, einigen in Lateinamerika und Europa Ausbildungen zum Kinderanalytiker angeboten wurden. Voraussetzung ist, dass vor der Behandlung dreier kinderanalytischen Fälle zwei Erwachsenenanalysen durchgeführt werden. Dieses »dornenvolle Kapitel« (Holder 2002, S. 47) endete vorläufig damit, »dass die IPV die kinder- und jugendlichenanalytische Ausbildung von etwa 700 ihrer Mitglieder offiziell anerkannte und im Roster 2001 erstmals durch ein besonderes Symbol kennzeichnete«. (Roster ist die Liste der Mitglieder und Kandidaten der »International Psychoanalytical Association«, wie die »Internationale Psychoanalytische Vereinigung« englisch heißt: https://www.ipa.world/en/copy_roster.aspx)
Kap. 2.7.2) – wurde eine vollwertige Anerkennung durch die IPV (Internationale Psychoanalytische Vereinigung) lange Zeit verweigert – und damit der Kinderanalyse eine untergeordnete Rolle zugewiesen. Daran änderte sich auch nichts dadurch, dass an vielen Instituten in Nordamerika, einigen in Lateinamerika und Europa Ausbildungen zum Kinderanalytiker angeboten wurden. Voraussetzung ist, dass vor der Behandlung dreier kinderanalytischen Fälle zwei Erwachsenenanalysen durchgeführt werden. Dieses »dornenvolle Kapitel« (Holder 2002, S. 47) endete vorläufig damit, »dass die IPV die kinder- und jugendlichenanalytische Ausbildung von etwa 700 ihrer Mitglieder offiziell anerkannte und im Roster 2001 erstmals durch ein besonderes Symbol kennzeichnete«. (Roster ist die Liste der Mitglieder und Kandidaten der »International Psychoanalytical Association«, wie die »Internationale Psychoanalytische Vereinigung« englisch heißt: https://www.ipa.world/en/copy_roster.aspx)
Neben der Hampstead Child Therapy Clinic etablierte sich in London an der »Tavistock Clinic« (gegründet1920) eine Stätte psychoanalytischer Behandlung, Forschung und Lehre, an dem auch eine Ausbildung in der Therapie von Kindern und Jugendlichen eingerichtet wurde, hauptsächlich beeinflusst von den Prinzipen der kleinianischen Schule. Die bedrängende Situation von Kindern und Jugendlichen durch die traumatisierenden Erlebnisse in den Kriegsjahren führte zu der Forderung, dass auch Kinder Zugang zu psychotherapeutischen Behandlungen haben müssen. Damit war die Notwendigkeit gegeben, Kinderanalytiker auszubilden. Zu den einflussreichen Analytikern der Klinik gehörten auch Wilfred Bion, Michael Balint, John Bowlby und Donald W. Winnicott. Bis heute ist die Tavistock Clinic eines der führenden international anerkannten psychoanalytischen Zentren.
Bereits bei Melanie Klein gewinnt die Objektbeziehung eine besondere Bedeutung. Unter der Objektbeziehung verstehen wir eine psychophysische Interaktion des Kindes mit seinen primären Bezugspersonen. Das »Objekt« wird nicht »objektiv« wahrgenommen, sondern entlang der Triebregungen, Wünsche, Affekte und Ängste des Subjekts. Diese Wahrnehmungen werden als Repräsentanzen verinnerlicht und sind psychisch strukturbildend. Gemäß den Objektbeziehungstheorien konstituieren also nicht allein und nicht überwiegend Triebe und Triebschicksale die Psyche, sondern die Qualität der Objektbeziehungen.
Michael Balint (1896–1970, ungarischer Psychoanalytiker) geht von einer »primären Liebe« zwischen Mutter und Kind aus, die unabhängig von der infantilen Sexualität sei. Ist diese primäre Liebe gestört, also die frühe Objektbeziehung defizitär, geht daraus eine »Grundstörung« hervor, die einhergeht mit einer fundamentalen Mangelerfahrung: »Es ist eine Störung, ein Defekt in der psychischen Struktur, eine Art Mangel, der behoben werden muss.« (Balint 1973, S. 32).
Balint beschrieb zwei verschiedene Charakterstrukturen, in denen frühe Objekterfahrungen verarbeitet werden (2014):
Der oknophile Charakter (okneo, griechisch: anklammern; philos griechisch: lieb, teuer) klammert sich aus Angst vor Objektverlust an das Objekt. Nähe und Verbundenheit zum Objekt, Zusammengehörigkeit sind seine Hauptstrebungen. Oknophilie ist objektgerichtet.
Der philobatische Charakter (batein, griechisch; gehen, wandern) liebt die Objektferne. Nähe beengt ihn, er sucht die Unabhängigkeit und bildet Fähigkeiten aus, allein zurechtzukommen. Philobatismus ist Ich-gerichtet.
Diese beiden Grundstrebungen lassen sich bereits bei Kindern beobachten, auch in ihren Träumen (Hopf 2007).
An die projektive Identifizierung in der kleinianischen Konzeption knüpft Wilfred R. Bion an.
Die projektive Identifizierung ist eine Variante der Projektion, mit dem Unterschied, dass die Inhalte der Projektion – unerträgliche Selbstzustände – dem anderen nicht allein angeheftet werden, sondern in ihn hineingezwängt werden, sodass dieser manipulativ mit diesen Zuständen identifiziert wird.
Damit ist das unbewusste Bestreben verbunden, Kontrolle über das intrapsychische Geschehen des andern zu gewinnen (Hinshelwood 1993, S. 263 ff.). Nun empfindet der Adressat sich so, als wäre er selbst mit diesen Zuständen infiziert, seine Affekte gleichen denen, die mit dem Inhalt der Projektion verbunden sind.
Bion (1897–1979, britischer Psychoanalytiker) beschrieb den frühen Austausch in der Mutter-Kind-Beziehung im »Container-Contained«-Modell. Er unterscheidet zwischen »normaler« und »anormaler projektiver Identifizierung«. Das Objekt wird als ein Behälter, ein Container benutzt, in den das Projizierte ausgelagert – und dort »contained«, also gehalten wird. Darin steckt auch eine unbewusste Mitteilung: Der andere soll eben auch spüren, wie es um den psychischen Zustand bestellt ist. Im Idealfall kann das Objekt, z. B. die Mutter, diese Zustände nachfühlen und in »träumerischer Reverie« verstehend verarbeiten, sodass sie das projektiv Ausgelagerte in veränderter, verträglicher Form und mit Bedeutung angereichert zurückgeben und dem Kind zur Verfügung stellen kann. Diese metabolisierende Funktion des »Containings« nannte Bion die »Alpha-Funktion, »mit der unverstandene, quälende und via Projektion herausgeschleuderte Fragmente, ›Beta-Elemente‹, in verdauliche ›Alpha-Elemente« verwandelt werden.« (Burchartz et al. 2016, S. 103) (  Kap. 6.4.2).
Kap. 6.4.2).
Читать дальше
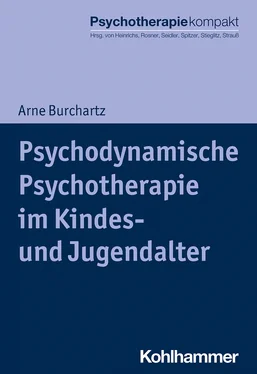
 Kap. 2.7.2) – wurde eine vollwertige Anerkennung durch die IPV (Internationale Psychoanalytische Vereinigung) lange Zeit verweigert – und damit der Kinderanalyse eine untergeordnete Rolle zugewiesen. Daran änderte sich auch nichts dadurch, dass an vielen Instituten in Nordamerika, einigen in Lateinamerika und Europa Ausbildungen zum Kinderanalytiker angeboten wurden. Voraussetzung ist, dass vor der Behandlung dreier kinderanalytischen Fälle zwei Erwachsenenanalysen durchgeführt werden. Dieses »dornenvolle Kapitel« (Holder 2002, S. 47) endete vorläufig damit, »dass die IPV die kinder- und jugendlichenanalytische Ausbildung von etwa 700 ihrer Mitglieder offiziell anerkannte und im Roster 2001 erstmals durch ein besonderes Symbol kennzeichnete«. (Roster ist die Liste der Mitglieder und Kandidaten der »International Psychoanalytical Association«, wie die »Internationale Psychoanalytische Vereinigung« englisch heißt: https://www.ipa.world/en/copy_roster.aspx)
Kap. 2.7.2) – wurde eine vollwertige Anerkennung durch die IPV (Internationale Psychoanalytische Vereinigung) lange Zeit verweigert – und damit der Kinderanalyse eine untergeordnete Rolle zugewiesen. Daran änderte sich auch nichts dadurch, dass an vielen Instituten in Nordamerika, einigen in Lateinamerika und Europa Ausbildungen zum Kinderanalytiker angeboten wurden. Voraussetzung ist, dass vor der Behandlung dreier kinderanalytischen Fälle zwei Erwachsenenanalysen durchgeführt werden. Dieses »dornenvolle Kapitel« (Holder 2002, S. 47) endete vorläufig damit, »dass die IPV die kinder- und jugendlichenanalytische Ausbildung von etwa 700 ihrer Mitglieder offiziell anerkannte und im Roster 2001 erstmals durch ein besonderes Symbol kennzeichnete«. (Roster ist die Liste der Mitglieder und Kandidaten der »International Psychoanalytical Association«, wie die »Internationale Psychoanalytische Vereinigung« englisch heißt: https://www.ipa.world/en/copy_roster.aspx)