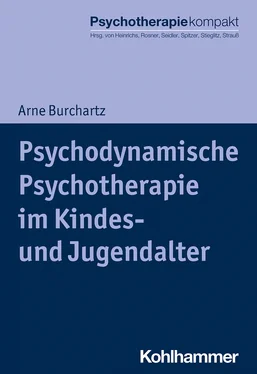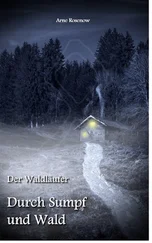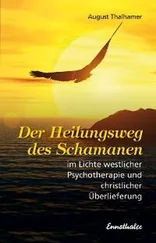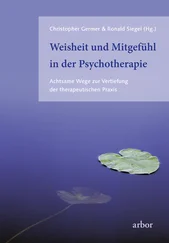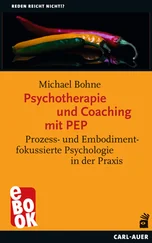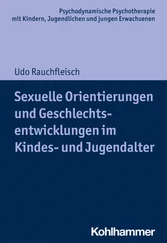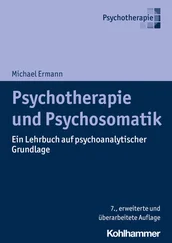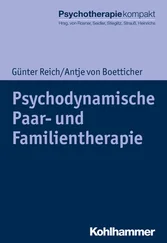Freud betonte, dass ödipale Wünsche und Fantasien zu einer normalen Entwicklung gehören. Für ihn hatten die Aussagen des Kindes genauso viel Gewicht wie diejenigen von Erwachsenen. Herbert, ein kluges und wissbegieriges Kind, nahm die Erklärungen des Professors eifrig auf. Nach der Sitzung bemerkte er: »Spricht denn der Professor mit dem lieben Gott, daß er das alles vorher wissen kann?« (Freud 1909b, S. 278). Wir können darin eine idealisierende Übertragung erkennen, die es dem Jungen leicht machte, sich dem Professor zu offenbaren. Dass die Behandlung Freuds Theorien über den Ödipuskomplex vollständig bestätigten, kann nicht nur auf eine Anpassungsleistung des Kindes zurückzuführen sein, sonst hätte sich kaum eine Auflösung der Phobie eingestellt, die ja eben der Anpassung an die impliziten Verbote und Drohungen der Erwachsenenwelt diente. Herbert war selbstbewusst genug, auch Deutungen zu widersprechen, wenn sie ihm nicht einleuchteten.
Am 7. Oktober 1908 begegneten sich Freud und sein kleiner Patient wieder. Herbert war vollständig geheilt, bei einem späteren Wiedersehen, 13 Jahre später, erinnerte sich Herbert nicht mehr an die Behandlung.
Diese Fallgeschichte aus den Anfängen der Kinderanalyse ist aus heutiger Sicht eher als eine psychoanalytische Elternberatung zu werten. Gleichwohl erbrachte sie wichtige Grundlagen:
Alle Äußerungen eines Kindes sind vollumfänglich ernst zu nehmen und in die Behandlung einzubeziehen. Sie haben das gleiche Gewicht wie Mitteilungen von Erwachsenen.
Deshalb besteht die analytische Haltung weniger in einem »Ausfragen«, als in einem teilnehmenden Zuhören.
Bei der Behandlung von Kindern sind die Bezugspersonen unverzichtbare Gesprächspartner. Sie tragen durch ihre Bereitschaft, problematische Einstellungen zu überarbeiten, Wesentliches bei.
Die Behandlung lässt sich auch verstehen als ein Stück psychoanalytischer Pädagogik: In ihr wurde versucht, durch die Beeinflussung der elterlichen Erziehungshaltung und anderer pädagogischer Maßnahmen der neurotischen Entwicklung bei Kindern vorzubeugen bzw. sie zu korrigieren.
Freud war trotz dieser erfolgreichen Behandlung skeptisch gegenüber Analysen mit Kindern. In seiner Einleitung der Fallgeschichte schreibt er: »…die Sachkenntnis, vermöge welcher der Vater die Äußerungen seines 5jährigen Sohnes zu deuten verstand, hätte sich nicht ersetzen lassen; die technischen Schwierigkeiten einer Psychoanalyse in so zartem Alter wären unüberwindbar geblieben.« Die Ausarbeitung einer Psychoanalyse von Kindern und Jugendlichen war späteren Nachfolgerinnen und Nachfolgern vorbehalten.
Bereits S. Freud behandelte Kinder und Jugendliche nach psychoanalytischen Prinzipien. Gleichwohl war er skeptisch, es standen ihm noch keine ausgearbeiteten Konzepte für Kinderbehandlungen zur Verfügung.
2.6 Die »Züricher Schule«
Oskar Pfister (1873–1956, Pfarrer und Psychologe in Zürich), sozialpolitisch engagiert, nahm 1909 Kontakt mit Freud auf. Im selben Jahr besuchte er Freud und seine Familie in der Berggasse (Alt 2016, S. 485). Fortan standen beide in reger Korrespondenz. Pfister hatte wesentlichen Anteil an der Etablierung der Psychoanalyse in der Schweiz, er wandte die Psychoanalyse in seiner Arbeit mit Jugendlichen an. Es ging ihm um psychoanalytisch fundierte pädagogische Einflussnahme, um eine »Nacherziehung des gestörten Jugendlichen« (Biermann 1971, S. 3). In Folge hatte er zusammen mit anderen Pädagogen wesentlichen Anteil an der Begründung einer psychoanalytischen Pädagogik, zu nennen sind hier Ernst Schneider (1878–1957, Psychoanalytiker, Direktor eines Lehrerseminars) und Hans Zulliger (1893–1965, Volksschullehrer und Kinderanalytiker), der bedeutende Arbeiten zu Kinderbehandlungen beitrug (1952, 1961), wobei er vor allem dem kindlichen Spiel eine heilende Wirkung zuschrieb. Pfister, Schneider, Zulliger waren zusammen mit Anna Freud u. a. Mitarbeitern Herausgeber der »Zeitschrift für psychoanalytische Pädagogik« (1926–1938). Die Erkenntnis, dass der damals durchgängige autoritäre Erziehungsstil für neurotische Fehlentwicklungen und Erkrankungen in Kindheit und Jugend verantwortlich war, führte zu zahlreichen Reformideen, die auch praktisch umgesetzt wurden. August Aichhorn (1848–1949, Pädagoge und Psychoanalytiker) (1925), Siegfried Bernfeld (1892–1953, Pädagoge und Psychoanalytiker) (1970; 1979 [1925]), Anna Freud (1930) sind hier zu nennen. Mit Unterstützung durch Anna Freud gründeten Dorothy Burlingham und Eva Rosenfeld 1927 im Wiener Bezirk Hietzing die Burlingham-Rosenfeld-Schule, in der die Schüler nach psychoanalytisch-pädagogischen Prinzipien unterrichtet wurde, u. a. auch von Joan und Erik H. Erikson und Peter Blos. August Aichhorn war ab 1931 in der Schulleitung. Die Schule bestand bis 1932 oder 1933 (es gibt unterschiedliche Angaben).
Unter dem Einfluss Alfred Adlers (1870–1937), Psychoanalytiker und Begründer der von Freud abweichenden »Individualpsychologie«, und August Aichhorns wurden in Wien eine große Zahl von Erziehungsberatungsstellen etabliert, deren Grundidee ein prophylaktischer Ansatz war: So sollten neurotischen Fehlentwicklungen durch den rechtzeitigen Einfluss auf Eltern vorgebeugt werden. Auf Adler geht auch die Gründung psychoanalytischer Kindergärten v. a. für Arbeiterkinder zurück. Aichhorn und Bernfeld engagierten sich in der Fürsorge- und Heimerziehung.
Die psychoanalytisch-pädagogischen Ansätze konnten allerdings zwei Schwierigkeiten, die sich einer Psychoanalyse des Kindes entgegensetzten, noch nicht lösen:
Kinder assoziieren nicht (Ferenczi 1913). Damit fällt eine wesentliche Voraussetzung für die Psychoanalyse weg, die bei Erwachsenen Ausgangspunkt für die analytische Arbeit ist.
Kinder kommen nicht aus eigenem Antrieb in eine Psychoanalyse, sie haben meist keinen »Leidensdruck«. Wie führt man sie an die therapeutische Arbeit heran?
2.7.1 Hermine Hug-Hellmuth
Als erste Kinderanalytikerin gilt Hermine Hug-Hellmuth (1871–1924). Sie führte das Spiel des Kindes als therapeutisches Medium anstelle der freien Assoziation ein. Das Spiel galt ihr auch als Äquivalent zum Traum. Im Vordergrund ihrer Arbeit stand das empathische Verstehen des Kindes und seiner seelischen Regungen, das bedeutete auch, dass die Grundlage der kinderanalytischen Arbeit eine »positive emotionale Beziehung zwischen Kind und Therapeut« (Biermann 1971, S. 4) sein muss. Für unerlässlich hielt sie auch die Arbeit mit den Eltern. Die Therapie mit einem Kind hatte für Hug-Hellmut auch eine pädagogische Dimension.
Eingehend befasste sich Anna Freud (1895–1982) mit der Kinderanalyse (Holder 2002, S. 32 ff.). Ihre grundlegenden Erkenntnisse legte sie in vier Vorträgen vor der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung vor (1926 [1927]), welche sie als »Einführung in die Technik der Kinderanalyse« 1927 veröffentlichte. Der Schwierigkeit der mangelnden Krankheitseinsicht und des fehlenden Heilungswillens begegnete sie, indem sie zur Einleitung einer Kinderanalyse umfangreiche pädagogische Maßnahmen ergriff, um das Kind an die Analyse heranzuführen. Auch für sie war der Aufbau einer positiven emotionalen Atmosphäre zwischen Kind und Analytiker entscheidend. Neben der Analyse von Träumen regte sie die Kinder zum Malen, Zeichnen und zu symbolischem Spiel und zur Inszenierung im Rollenspiel an. Das Spielen wurde durch die Deutung und das Verbalisieren der inneren Vorgänge begleitet mit dem Ziel, unbewusste Vorgänge ins Bewusstsein zu bringen und damit dem Ich zur Verfügung zu stellen, und zwar mithilfe des Wortes – wobei sich zugleich im Verbalisieren der Sekundärvorgang und damit Denkprozesse überhaupt erst bilden. (Freud 1965, S. 2153). Darin entwickelt sich die Fähigkeit zur Realitätsprüfung und zur Triebbeherrschung.
Читать дальше