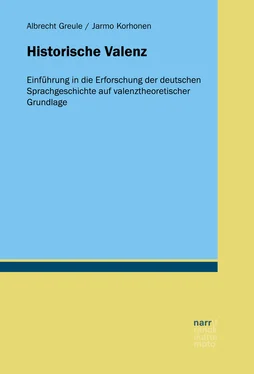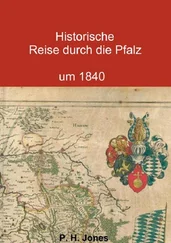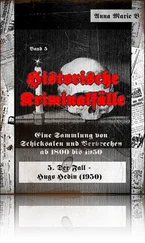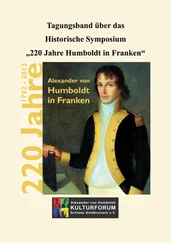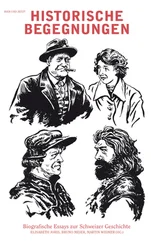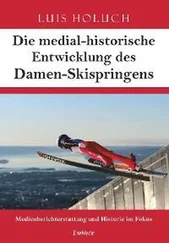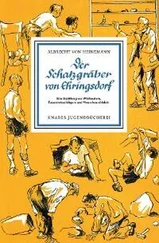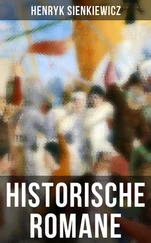1) Verstehenskompetenz: Der Deskribent muss über ein semantisch-funktionales Verständnis der vorliegenden Materialien verfügen.
2) Textkompetenz: Der Deskribent muss bei der Lektüre und Interpretation seiner Texte die innersprachlichen, intratextuellen Fragen aufgrund der Kenntnis satz- und textkonstitutiver Regularitäten und aufgrund extratextueller Vorkenntnisse berücksichtigen.
3) Philologische Kompetenz: Der Deskribent muss über paläografische Fähigkeiten sowie kultur-, religions- und rechtsgeschichtliche die Materialbasis betreffende Kenntnisse verfügen.
4) ErsatzkompetenzErsatzkompetenz: Der Deskribent baut sich aus der sprachlichen Erforschung der Materialbasis seine sekundäre Kompetenz auf, die der sprachlichen Intuition des Textschreibers nahekommen sollte.
Die Annahme einer Deskribenten-Kompetenz oder linguistischen ErsatzkompetenzErsatzkompetenz ist für jede Beschreibung einer älteren Sprachstufe, für die es nur schriftliche Sprachdaten gibt, eine unabdingbare Voraussetzung. Ersatzkompetenz steht als Zusammenfassung aller vier prozesshaft erworbenen Unterarten. Aber dieser abgeleiteten, sekundären Kompetenz fehlt aufgrund ihrer Gebundenheit an die geschlossene Materialbasis die Kreativität. Sie ist nicht fähig, im generativen Sinn unendlich viele neue Sätze zu erzeugen und zu verstehen. Wenn der Deskribent dennoch „neue“, in seinem Korpus nicht belegte Sätze versuchsweise bildet, kann es sich dabei nur um Vermutungen handeln. Die Ersatzkompetenz ist einseitig; ihre Fähigkeit besteht im Wesentlichen im Verstehen der im Korpus belegten Sätze, im Erkennen der sprachlichen Strukturen sowie im richtigen Segmentieren und Klassifizieren der im Korpus belegten sprachlichen Elemente.
3.3 Die Ersatzkompetenz als Erweiterung der muttersprachlichen Kompetenz
Der Erwerb der vollständigen ErsatzkompetenzErsatzkompetenz kann mit dem Erwerb einer Zweitsprache verglichen werden und kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Der Erwerb der Ersatzkompetenz kann – als Ausgleich eines sprachlichen Defizits – aber leichter vor sich gehen, wenn die „tote“ Sprache einen historischen Zustand der Muttersprache des Deskribenten oder einer durch den Deskribenten vollständig erworbenen lebenden Zweitsprache darstellt. Bei deutschsprachigen Deskribenten trifft das auf ahd., mhd. und fnhd. Texte als Materialbasis zu. Es wird sogar angenommen, dass der Erwerb der Ersatzkompetenz einer Erweiterung der für die Muttersprache oder eine Zweitsprache der Gegenwart bereits erworbenen Kompetenz gleichkommt. Für das Deutsche formulierte diese Position der Schweizer Sprachwissenschaftler HANS GLINZ (1913‒2008) (Glinz, Deutsche Syntax. 3., durch einen Nachtrag erweiterte Auflage. Stuttgart 1970, 108f., zitiert nach Greule 1982a, 75f.):
Wir sind […] nicht mehr die unmittelbaren Teilhaber der Sprache um 1500, um 1200, um 900 (ja nicht einmal mehr ganz der Sprache um 1800), sondern wir sind die Erben – zwar bevollmächtigte Erben, indem es unsere eigene Vergangenheit ist, aber doch Erben. Das müssen wir im Auge behalten, und wir müssen in unseren Methoden und in den darauf gestützten Aussagen entsprechend vorsichtig sein. So dürfen wir in erster Annäherung durchaus annehmen, daß unsere Vorfahren in ihrer Sprache größtenteils ähnliche morphosyntaktischemorphosyntaktisch Kategorien besessen haben wie wir (etwa Verb, Nomen, Pronomen, Kasus, Numerus usw.) und daß wir also, sobald wir die andersartige Phonomorphie beherrschen, von unserer gegenwärtigen Sprache zunächst zu einem gewissen Vorverständnis der Texte und ihres syntaktischen Baues kommen können. Dann müssen wir aber jederzeit damit rechnen, daß die Kategorien anders gewesen sein konnten, schon in der MorphosyntaxMorphosyntax (z.B. Rolle des Genitivs, kein Plusquamperfekt, kein so deutliches PassivPassiv), und erst recht in der Nomosyntax. […] Dabei wird man […] nicht […] direkt und unmittelbar von den Texten ausgehen können, sondern man wird zum vornherein alle Vorarbeit nützen müssen, die in Grammatiken und Wörterbüchern gesammelt ist. Man wird sie aber kritisch nützen müssen und sich immer bewußt sein müssen, daß das alles im Grunde lauter Vorbegriffe und Hypothesen sind, die sich immer erst in der Analyse konkreter Texte bewähren müssen, und daß man sich ihrer wohl bedient, sich aber nicht an sie bindet.
4. Vom historischen Korpus zur Valenz und zu den SatzbauplänenSatzbauplan (Methoden)
4.1 Vom Evangelienbuch Otfrids von Weißenburg zur Bestimmung der Valenz althochdeutscherAlthochdeutsch Verben
Das Evangelienbuch Otfrids von WeißenburgOtfrid von Weißenburg (EB) ist einer der wenigen umfangreichen ahd. Texte. Das EB ist in drei vollständig überlieferten Handschriften (V, P und F) überliefert (vgl. Kapitel A.2). Die Handschriften V (Wiener Handschrift) und P (Heidelberger Handschrift) sind im 9. Jh. im Skriptorium des Klosters Weißenburg (heute Wissembourg im Elsass) geschrieben worden. Die Wiener Handschrift (EB/V), an deren Entstehung OtfridOtfrid von Weißenburg selbst beteiligt war, gilt als Haupthandschrift. Eine valenztheoretische Untersuchung, die nicht auf einer Edition des Evangelienbuchs beruht, sondern direkt von der Wiener Handschrift EB/V ausgeht, wird dadurch erleichtert, dass sich die Grammatikografen auf eine Faksimile-Ausgabe des Codex Vindobonensis (1972) stützen und als Korpus auswerten können.
Ein ausdifferenziertes Operationsmodell zur Bestimmung der Verbvalenzen in EB/V mit 14 Einzelschritten, die von der Sammlung der Belegstellen eines bestimmten Verbs V xzu einem Eintrag in ein ahd. ValenzlexikonValenzlexikon führen, entwickelte ALBRECHT GREULE (1982a, 206‒218).
Die Analyseschritte führen von Schritt 1: Sammlung der Belegstellen und Unterscheidung von V x(z.B. (gi)fullen ‚füllen‘) in finite und infinite Formen (z.B. Partizip Präsens fullentaz ) bis zur zusammenfassenden Formulierung eines Lexikoneintrags (Schritt 14). Die Zwischenschritte sind:
Festlegung eines Signifikanten (Zusammenfassung der Schreibweisen von Vx, z.B. fullit, fulta ) und eines vorläufigen Signifikats (Schritt 2 und 3)
Bildung einfacher Sätze mit Vx als PrädikatPrädikat (Schritt 4), Bestimmung der konprädikativen SatzgliederSatzglied in den Belegsätzen (Schritt 5)
Spezifizierung deiktischer Sprachzeichen, z.B. er , thiu , uuir (Schritt 6)
formale und semantische Klassifizierung der SatzgliederSatzglied (Schritt 7 und 8)
Quantifizierung der AdverbialeAdverbial (ErgänzungErgänzung oder AngabeAngabe) (Schritt 9)
QuantifizierungErgänzungobligatorische der ErgänzungenErgänzung (obligatorischobligatorisch vs. fakultativfakultativ) (Schritt 10)
Beschreibung morphosyntaktischermorphosyntaktisch Qualität der LeerstellenLeerstelle (Schritt 11)
Beschreibung der semantischen Qualität der LeerstellenLeerstelle durch KlassemeKlassem (Schritt 12)
Neufassung des Signifikats (Schritt 13), z.B. sind im Korpus zwei SememeSemem von (gi)fullen erkennbar: a) ‚vollmachen‘, b) ‚verrichten, befolgen‘.
Der Analyse des Beispielverbs liegen 13 aus dem Korpus EB/V gebildete EinfachsätzeEinfachsatz zugrunde. Nach Aussonderung der gering belegten Umstandsbestimmungen (AdverbialeAdverbial) werden unter dem LemmaLemma (gi)fúlli- zwei Unterartikel für das ahd. ValenzlexikonValenzlexikon formuliert:
a) fakultativfakultativ 3w: ErgänzungfakultativeE1, E2, E(orn), obligatorischobligatorisch 2w: E1, E2, E(orn) = NP4/NP5, KlassemKlassem 1 ‚belebt‘, Klassem 2 ‚konkret, hohl‘. Paraphrase: x1 macht: y2 ist voll (mit z)Beispielsatz (OtfridOtfrid von Weißenburg 1,21,2) mit todu er (= ther kuning herod ) daga fulta SatzbauplanSatzbauplan: PräpG mit – NGnom – NGakk – P, oder (stellungsneutral) Enom, Eakk, Epräp
Читать дальше