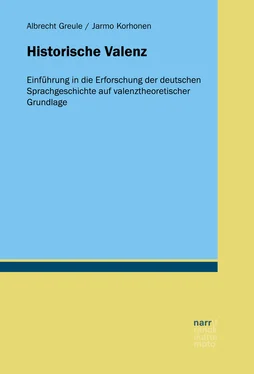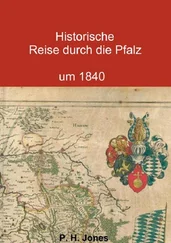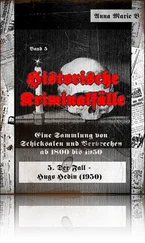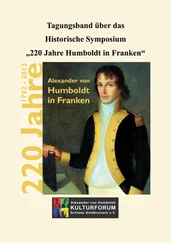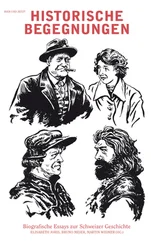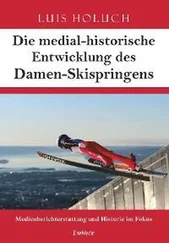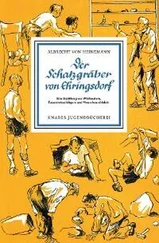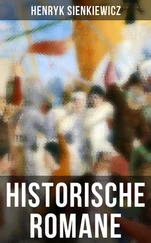1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 2) Anwendung der auf den Verbalsatz eingeschränkten Satzdefinition (= Konstruktion aus SatzgliedernSatzglied mit einem PrädikatPrädikat im Zentrum) auf den Text, was zu einer Liste von konkreten Sätzen führt, vgl. die Liste der 88 Sätze, in die das (ahd.) HildebrandsliedHildebrandslied (Greule 1987, 440‒445) eingeteilt wird (zu den Problemen vgl. Habermann 2007, 86).
3) An die Text-Satz-Segmentierung schließt sich die interpretierende Segmentierung der gegebenen Verbalsätze in SatzgliederSatzglied an.
4) Den konkret ausformulierten SatzgliedernSatzglied wird jeweils – stellvertretend – ein morphosyntaktischesmorphosyntaktisch Kategorialsymbol zugeordnet, z.B. NGnom für ein Satzglied, das mit einer NominalgruppeNominalgruppe im Nominativ identisch ist (z.B. ahd. fater unser ) oder PräpGin für ein Satzglied, das mit einer von der Präposition in eingeleiteten PräpositionalgruppePräpositionalgruppe identisch ist (ahd . in himile ).
5) Die interpretierende Ausscheidung von zusätzlichen SatzgliedernSatzglied (Supplementen, AngabenAngabe) aus der formalisierten Satzstruktur-Beschreibung und die damit einhergehende Feststellung der AktantenAktant (ErgänzungenErgänzung) ermöglicht die Abstraktion eines SatzbauplansSatzbauplan von einem konkreten Satz.
6) Die Zuweisung der TiefenkasusrolleTiefenkasusrolle zu den als ArgumenteArgument fungierenden ErgänzungenErgänzung ergibt schließlich die aus SatzbauplanSatzbauplan und TiefenkasusrahmenTiefenkasusrahmen bestehende und auf das Verb als PrädikatPrädikat bezogene Verb-Aktanten-KonstellationVerb-Aktanten-Konstellation (VAK) (siehe Kapitel B.2).
Beispiel:Die dritte Âventiure des NibelungenliedsNibelungenlied (= Korpus) beginnt mit der Zeile (Strophe 44)
Den herren muoten selten deheiniu herzen leit.
Die Zeile (44,1) ist mit einem (mhd.) EinfachsatzEinfachsatz identisch. Es handelt sich um eine Konstruktion mit dem PrädikatPrädikat muoten (= 3. Person Plural Präteritum Indikativ des Verbs mhd. müejen ‚bekümmern‘) im Zentrum. Die weiteren (konprädikativen) SatzgliederSatzglied sind: den herren (= Siegfried), selten (‚niemals‘), deheiniu herzen leit (‚irgendwelches Herzeleid‘, Plural). Den Satzgliedern werden folgende Kategorialsymbole zugeordnet: NGakk( den herren ) – P( muoten ) – Adv( selten ) – NGnom (deheiniu herzen leit ). Das Adverb selten ist eine zusätzliche, die Zeit betreffende Prädikation und wird ignoriert, so dass der muoten/müejen zugeordnete (zweiwertige)zweiwertig SatzbauplanSatzbauplan (stellungsneutral) lautet: P – NGnom – NGakk. Die Zuweisung der TiefenkasusrollenTiefenkasusrolle erfolgt von der Verbbedeutung her. Die Bedeutung des Verbs mhd. muoten ist ‚Tätigkeit, die einen emotionalen Zustand bewirkt‘ und verlangt ein AgensAgens, das den Zustand bewirkt (im Beispiel abstrakt: deheiniu herzen leit ) und ein PatiensPatiens, den ZustandsträgerZustandsträger ( den herren ). Das ergibt folgende (stellungsneutrale) VAK:
| P( müejen ) – Agens /NGnom– Patiens /NGakk |
Im konkreten Text des NibelungenliedsNibelungenlied ist das PatiensPatiens topikalisiert (an die Satzspitze gestellt) und der Satzinhalt durch selten in der Bedeutung ‚niemals‘ negiert.
Detaillierter wird die Methode, die vom historischen Text-Korpus zur Valenz, zu den VAK und zu ihrer Präsentation im ValenzlexikonValenzlexikon führt, in Kapitel E (Historische Valenz und Lexikografie) dargestellt.
Alle methodischen Schritte setzen die Existenz einer linguistischen ErsatzkompetenzErsatzkompetenz voraus.
3. Die linguistische Ersatzkompetenz (Prokompetenz)
Die erste kritische Diskussion der Methode, wie man vom historischen Text (= Korpus) zur Valenz eines Verbs und zur Erschließung von Satzmodellen gelangt, fasste Thornton (1984, 113‒219) unter der Kapitelüberschrift „From Corpus to Valence“ zusammen. Die Diskussion mündet schließlich in die Annahme und Forderung einer „linguistischen ErsatzkompetenzErsatzkompetenz“ des Deskribenten ein, die JARMO KORHONEN (1976, 208) wie folgt beschreibt:
Diese Art von Kompetenz bezieht sich […] nur auf die Erkennung, nicht auf die Erzeugung sprachlicher Strukturen. Eine generelle linguistische Kompetenz kann sich der Deskribent einer älteren Sprachstufe dadurch aneignen, daß er die Elemente des ihm vorliegenden Korpus beobachtet und miteinander vergleicht, bis er sie allmählich zu identifizieren lernt. Nachdem dieses Stadium erreicht worden ist, vermag nun der Deskribent die Elemente richtig zu segmentieren und zu klassifizieren. Zur Abgrenzung von ErgänzungenErgänzung und AngabenAngabe ist aber noch eine spezifische (d.h. valenzbezogene) linguistische Kompetenz nötig. Eine solche Kompetenz kann der Deskribent aufbauen, indem er seine Kompetenz der Gegenwartssprache auf die zu erforschende Sprachstufe überträgt und sie noch durch weitere Beobachtungen zur Struktur der betreffenden Sprachstufe erweitert. Die Bestimmung des Unterschieds zwischen Ergänzungen und Angaben kann kaum nur im Rahmen einer morphosyntaktischmorphosyntaktisch orientierten Beschreibung erfolgen; damit eine sprach- und linguistikadäquate Deskription gewährleistet werden kann, müssen auch logisch-semantischeValenzlogisch-semantische Begründungen herangezogen werden. Die spezifische linguistische ErsatzkompetenzErsatzkompetenz ist durch textinterne und -externe Vergleiche zu verstärken, wobei sich die Feststellung der Vorkommenshäufigkeit als ein brauchbares Hilfsmittel erwiesen hat: Elemente, die bei bestimmten Lexemen regelmäßig vorkommen, sind als Ergänzungen zu klassifizieren. Als textexterne Vergleichsbasis kommen sowohl zeitgenössische als auch historische Grammatiken und Wörterbücher in Betracht, wenn sie auch nicht explizit valenzbezogene Informationen enthalten.
3.1 Sprachkompetenz, idealer Sprecher-Hörer und „tote“ Sprachen
Die Frage nach einer „Kompetenz“ des Deskribenten historischer Sprachstufen ist vor dem Hintergrund der Sprachtheorie, die der berühmte US-amerikanische Linguist NOAM CHOMSKY 1965 ausarbeitete,1 zu sehen. Im Mittelpunkt der „generativ“ genannten Theorie steht die Kompetenz des „idealen Sprecher-Hörers“. Das Problem der Kompetenz stellt sich im Falle der Beschreibung der Grammatik „toter“ Sprachen, für die es keinen „idealen Sprecher-Hörer“ mehr gibt, völlig neu. Die Grammatik einer „toten“ Sprache kann ohne „native speaker“ nach den strengen Regeln der generativen Theorie gar nicht beschrieben werden. Es wurde in der Forschung deshalb auch bestritten, dass Linguisten – etwa nach entsprechender Ausbildung – eine Kompetenz für eine nur schriftlich fixierte Sprache besitzen können und wie in der Gegenwartssprache Sätze transformieren und generieren, d.h. neu bilden, können. Jedoch wurde vorgeschlagen, anstatt von einem „idealen Sprecher-Hörer“ für ältere Sprachstufen von einer „idealen Sprachkompetenz der Textschreiber“ auszugehen. Da eine Grammatik als Theorie dieser „idealen Sprachkompetenz der Textschreiber“ zu verfassen auf erhebliche Schwierigkeiten stößt, wird in dieser Theorie der Deskribent selbst an die Stelle des „native speaker“ gesetzt.
3.2 Die vierfache Kompetenz des Deskribenten älterer Sprachstufen
In der von ROGER G. VAN DE VELDE (1971) vorgetragenen Methodenlehre, die er auf die altfriesische Syntax anwandte,2 werden vier Unterarten der Deskribenten-Kompetenz unterschieden (vgl. Greule 1982a, 73f.):
Читать дальше