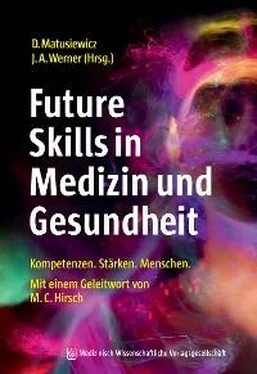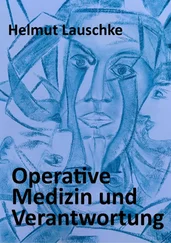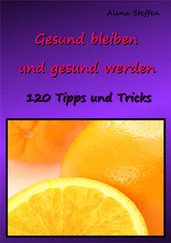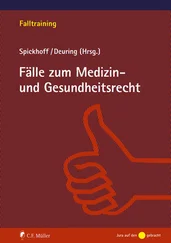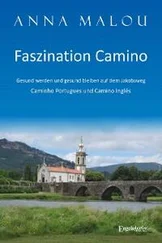Prehm M (2018) Pflege deinen Humor – Eine praktische Anleitung für Pflegepersonal. Springer-Verlag Berlin/ Heidelberg. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56080-8
Scheel T, Gockel C (2017) Humor at Work in Teams, Leadership, Negotiations, Learning and Health. In: Humor at Work in Teams, Leadership, Negotiations, Learning and Health. Springer New York. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-65691-5

Marek Bartzik ist Wirtschaftspsychologe, Mitarbeiter in der Begleitung von Veränderungsprozessen, systemischer Coach und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Frau Prof. Dr. Corinna Peifer im Projekt „Freude Pflegen“ an der Universität zu Lübeck. Das Projekt „Freude Pflegen“ beschäftigt sich mit Humor im Pflegebereich. Es wurde ein Unterrichtskonzept zur Integration in die Pflegeausbildung entwickelt, das systematisch auf eine Verbesserung des eigenen Umgangs mit den herausfordernden Arbeitsumständen hinwirkt. Derzeit wird das Unterrichtskonzept evaluiert.

Corinna Peifer ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität zu Lübeck und leitet dort die Arbeitsgruppe Arbeit und Gesundheit. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Themen wie Flow-Erleben, Stress-Management, Humor und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Sie ist Gründungsmitglied des European Flow-Researcher’s Network und Landesvertreterin für das European Network of Positive Psychology (ENPP) sowie Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Positiv-Psychologische Forschung (DGPPF).
7 Inspiration Gerd Wirtz
7.1 Visionäre statt Technokraten
„Die Digitalisierung hat perspektivisch das Potenzial, Prozesse und grundsätzliche Prinzipien der gesundheitlichen Versorgung zu verändern.“
Macht Ihnen dieses Zitat unseres – wie ich betonen möchte sehr geschätzten – Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. med. Klaus Reinhardt, so richtig Lust auf digitale Medizin? Mir nicht und ich nehme an, Ihnen auch nicht.
An Sätzen wie diesen zeigt sich exemplarisch, warum die Digitalisierung in der Medizin in Deutschland noch nicht auf breiterer Basis etabliert ist: Es gibt derzeit kaum chancenorientierte und motivierende Kommunikation über das Thema. Aber Fortschritt ist immer eine Frage der Akzeptanz.

Die Technik kann schon Vieles leisten, doch die Zustimmung hinkt häufig noch meilenweit hinterher.
Die moderne Medizin könnte mithilfe der digitalen Instrumente schon längst ihren Anspruch einlösen, präventiver und menschlicher zu sein. Doch wir nutzen das immense Potenzial noch lange nicht aus.
Eine Studie zum Thema „Digital Riser“ des European Center for Digital Competitiveness aus dem Jahr 2020 zeigt einen besorgniserregenden Trend: Deutschland gehört zu den Ländern, die im Ländervergleich in Sachen digitale Kompetenz am stärksten zurückgefallen sind. Wenn wir diesen Trend umkehren wollen, müssen wir den Menschen eine positive Vision von der Zukunftsmedizin bieten. Digital Health Literacy ist die Grundlage, damit der Fortschritt in der Gesellschaft ankommt und von ihr weitergetragen wird. Das betrifft Ärzte und Patienten gleichermaßen, denn beide Gruppen eint, dass sie häufig ein verzerrtes Bild von Zukunftsmedizin haben. Mit übertriebener Sorge vor möglichen Gefahren wie Datenmissbrauch und wenig Ideen, wie sie selbst von digitalen Produkten profitieren können.
7.2 Mehr Menschlichkeit in der Pflege statt „Terminator“
Wie sieht unser Bild von der Medizin der Zukunft heute aus? Wie stellen wir uns eine Medizin vor, in der der Einsatz von Robotern, Künstlicher Intelligenz und Datenauswertung so alltäglich ist wie das Abhören mit dem Stethoskop? Wenn ich nach den Rückmeldungen der Teilnehmer meiner Vorträge gehe, herrschen bei diesem Thema Gefühle wie Unbehagen oder gar Angst vor. Eine Teilnehmerin sagte mir kürzlich, ihre Mutter sei jetzt über 80 Jahre alt. Der Umzug ins Altenheim stehe an. Der Gedanke, dass dort in einigen Jahren nur noch Roboter auf den Gängen herumfahren und die alten Menschen versorgen, sei für sie eine Horrorvorstellung. Solche und ähnliche Bilder tauchen in den Köpfen vieler Menschen auf, wenn sie an Zukunftsmedizin denken. Tatsächlich ist unsere Vorstellung von Künstlicher Intelligenz stark geprägt von Science-Fiction-Filmen wie „Star Wars“ oder „Terminator“. Das fand eine Studie des Meinungsforschungsinstitut Allensbach im Jahr 2019 heraus. Können wir uns den freundlichen R2D2 noch als Hausgenossen vorstellen, rührt der Terminator an unserer Ur-Angst der dem Menschen überlegenen Technik, die sich am Ende gegen ihn wendet.
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im realen Pflegeheimalltag sieht hingegen folgendermaßen aus: Pflegekräfte im Altenheim verbringen heute rund 30 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Dokumentation. Drei junge Informatikstudenten kamen auf eine clevere Idee: Genauso wie wir per Alexa bei Amazon einkaufen, können künftig Pflegende die zu dokumentierenden Informationen in ein Smartphone sprechen statt sie am Schreibtisch in den Computer tippen. Nach diesem Prinzip funktioniert die App, den die Gründer in ihrer Firma Voize entwickelten. Der Sprachassistent ist speziell auf die Bedürfnisse im Medizinbereich zugeschnitten. Er muss keinen großen Wortschatz haben, dafür medizinische Fachbegriffe erkennen. Die App muss offline funktionieren, da nicht alle Einrichtungen flächendeckend über WLAN verfügen. Und der Datenschutz muss natürlich gewährleistet sein. Dazu verarbeitet das Gerät den Text direkt auf dem Gerät, statt über den Umweg einer Cloud, wie es Siri oder Alexa tun. Einzig beim Übertragen der Daten in die Pflegesoftware wird WLAN benötigt. Verschlüsselt sind die Daten selbstverständlich auch. Langfristig soll diese Art der Dokumentation den Pflegenden mehr Zeit für die Bewohner verschaffen: für ein Gespräch, einen Spaziergang, gemeinsames Lachen. Kurz: Für mehr Menschlichkeit.
7.3 Wir brauchen eine inspirierende Kommunikation über Zukunftsmedizin
Wir werden diese digitalen Helfer in naher Zukunft brauchen. Eine Umfrage des DGB aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass 69 Prozent aller Pflegenden gestresst sind. 80 Prozent sagen laut Umfrage sogar voraus, dass sie ihren Beruf nicht bis zur Rente ausüben werden. Wenn digitale Produkte unter diesen Voraussetzungen Pflegende in ihrem Berufsalltag unterstützen, ist dies eine positive Nachricht, die wir auf allen Kanälen verbreiten sollten. Denn darum geht es beim Einsatz der Instrumente der digitalen Medizin: Ärzte und Pflegende bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Sie hat das Potenzial, Medizin und alle die darin arbeiten, wieder näher an die Bedürfnisse von Patienten und Bewohnern zu bringen und den Arbeitsalltag zu erleichtern.
Viele Menschen haben ein völlig verzerrtes Bild davon, wie der Einsatz von digitaler Medizin im Alltag konkret aussieht. Der Grund dafür liegt meiner Meinung nach darin, dass die Kommunikation über die neuen Technologien häufig an den Menschen vorbei geht. Ein Beispiel ist die Corona-App. Anfangs gab es eine große Kampagne, die durchaus wirksam war. Über 18 Millionen Downloads konnte die App in kurzer Zeit verzeichnen. Das war ein gutes Ergebnis. Doch dann brach die Kommunikation einfach ab. Anstatt am Ball zu bleiben und eine Vision zu erschaffen, wieviel Freiheit wir erlangen, wenn wir sie richtig nutzen, wurden die Menschen allein gelassen. Nur durch den bloßen Download kann eine solche App ihre Kraft nicht entfalten. Aber da bleibt das Sprechen über die Möglichkeiten von Technik zu technokratisch, zu bürokratisch.
Читать дальше