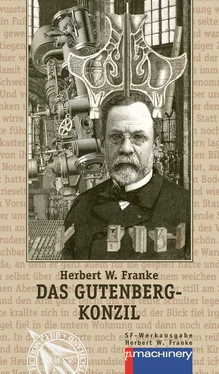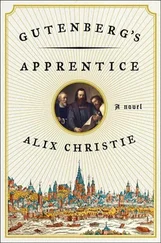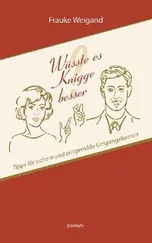Nicht unerwähnt darf ich lassen, dass ich jenes Dorf aufgesucht habe, von dem die Rede sein wird, um mich nach allen Begebenheiten zu erkundigen, die vielleicht Licht in die dunklen Vorgänge bringen könnten. Ich fand zwar einiges, leider aber nur unklare Andeutungen, nichts Greifbares, jedoch auch nichts, was eine Widerlegung bedeutet hätte. Natürlich betrafen die meisten Informationen, die ich erhielt, die Ereignisse, die für das Dorf von ausschlaggebender Bedeutung waren, die Einquartierung einer der letzten Befehlsstellen der deutschen Wehrmacht und die Bombardierung, die viele unschuldige Opfer forderte. Darum herum aber kreisten Gerüchte von einem Spion, der durch Lichtzeichen die Lage des Offiziersstabes verraten haben soll, und manche Dorfbewohner schilderten sogar nähere Umstände von dessen Gefangennahme kurz vor der Einnahme des Ortes durch die Truppen der Gegner. Ich glaube, nicht fehlzugehen, wenn ich diese Geschehnisse mit dem mich interessierenden Fragenkomplex in Verbindung bringe, damit wird natürlich auch jeder Zusammenhang mit Spionage gegenstandslos. Aber das geht erst aus dem letzten Teil der Notizen hervor.
Andere Dörfler erinnerten sich auch noch an ein Flüchtlingspaar, das sich eines Verwundeten angenommen hatte, der hierzulande unbekannt war. Es gelang mir leider nicht, diese beiden Samariter ausfindig zu machen, so sehr ich dies auch anstrebte. Die Verwirrung nach dem großen Fliegerangriff auf das Dorf in den letzten Kriegstagen mag dazu beigetragen haben, dass das Einzelschicksal eines Fremden kaum beachtet wurde. Jeder hatte mit sich selbst zu tun, suchte in den Trümmern nach seinem Eigentum, barg, was zu retten war, und beklagte das Verlorene. Nur wenige Häuser waren erhalten geblieben, von den meisten zeugten nur mehr verkohlte Ruinen; ihre früheren Einwohner hatten sich in alle Winde zerstreut. –
Seit dieser Zeit sind nun einige Jahre vergangen, ich konnte damals bald unversehrt heimkehren. Meinen mitgebrachten Fund verwahrte ich im Dunkel einer Schublade, wo er dem Vergessen geweiht zu sein schien. Als sich aber mit der Zeit die Aufregung der Kriegswehen legte, kam ich mit meinen Gedanken oft wieder zu ihm zurück. Nun habe ich mich endlich entschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, so wie ich ihn bekommen habe, ohne Änderung seiner oft unbeholfenen und doch so eindringlichen Sprache. Es war nur ein Zufall, dass er gerade in meine Obhut gekommen war, ich habe daher kein Recht darauf, ihn meinen Mitmenschen vorzuenthalten. Auch andere mögen sich mit seinen Rätseln befassen, sich ihr Urteil selbst bilden und eigene Erklärungen suchen. Sicher ergeben sich daraus bemerkenswerte psychologische Aspekte, und ich werde mich hier gerne der Meinung der berufenen Fachwelt beugen. Im Übrigen hat mich weniger die wissenschaftlich interessante Seite des Falles interessiert als das besondere Schicksal jenes Gehetzten, die Hoffnung und der Schmerz, zu denen ein Mensch fähig ist. Noch eines will ich nicht verschweigen: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass der Schreiber der nachstehenden Schilderung ein ehrlicher und gewissenhafter Berichterstatter war; kein unwahres Wort dürfte wissentlich hingesetzt sein, wenn auch die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Traum nicht feststellbar sind. Diese Blätter möchte ich ihm widmen, der verschollen ist und dem gegenüber ich eine Pflicht zu erfüllen habe. Möge mancher Trost daraus schöpfen, indem er sein eigenes Leben von einer anderen Warte aus betrachtet, möge er eine Stunde der Stille und der Besinnung weihen.
Denn dann hat das Leben von Bernhard Retroy doch noch einen Sinn gefunden.
H. W. F.
Die Aufzeichnungen des Bernhard Retroy
Jetzt, wo ich den Stift ansetze, um meine Niederschrift zu beginnen, zittert meine Hand, als ob sie sich gegen mein Vorhaben sträube, und ich überlese zaudernd die ersten kümmerlichen Worte. Ich muss mich erst ans Schreiben mit der Linken gewöhnen; noch gleitet sie unsicher übers Papier, die Wörter werden schief und kindlich. Beim großen Luftangriff der vorigen Woche habe ich meine Rechte verloren. Bis heute ist mir nicht klar, auf welche Weise dies geschah. Darüber will ich jetzt nicht nachgrübeln, später werde ich davon zu berichten haben. Doch die Wunde schmerzt und bohrt und lenkt meine Gedanken immer wieder darauf zurück; noch blutet sie zuweilen, und auf dem Weiß des Verbandes wachsen seltsame braunrote Flecken …
Es ist ein gewagtes Unternehmen, alles das aufzeichnen und festhalten zu wollen, was in den letzten Tagen auf mich eingestürzt ist. Werde ich es bewältigen können? Doch ich muss es wohl versuchen. Es soll mich zwingen, die mit mir durchgehenden Gedanken zu zügeln, in ruhigere Bahnen zu lenken …
Vor meinem inneren Auge wogen Schauplätze, Gestalten und Gesichter; kaleidoskopartig wechseln die Bilder: sich drehende Wagenräder, zusammensinkende Körper, Trauer um Abschied und Trennung. Personen tauchen wie Schemen auf, maskenhafte Gesichter verzerren sich zu Grimassen, verschmelzen ineinander, teilen sich in scheußlichen Verzerrungen zu neuen Fratzen, und dazwischen ersteht ein wächsernes Antlitz von kristallener Reinheit, das in seiner Regungslosigkeit und Zerbrechlichkeit an altes modelliertes Porzellan erinnert … Dieser Ferchentanz in meinem Gehirn muss zum Einhalt gezwungen werden. Doch noch treibt alles wie brackiges Wasser durcheinander, kreist und wirbelt, strudelt und schlägt. Quälend ist diese Unklarheit, dieser trübende, wühlende Aufruhr; es liegt an mir, die Klärung abzuwarten; ich muss dazu beitragen, was in meinen Kräften steht. Nur eines soll jetzt für mich Bedeutung haben: dass sich Fieber und Wirklichkeit trennen, das Einst sich vom Jetzt sondert. Sonst müsste ich an meinem Verstand zu zweifeln beginnen und fürchten, dem Wahnsinn verfallen zu sein; nüchtern will ich eins ums andere aufzählen, wie es sich zutrug, ohne zu beschönigen, ohne zu entschuldigen.
Der Beginn jener Reihe von Begebenheiten fällt in den Mai 1945. Wenn ich aber sorglich zurückdenke, stoße ich auf Vorläufer, die viel weiter zurückliegen. Natürlich hatte ich damals keine Ahnung von der Bedeutung mancher Ereignisse; erst bei genauem Überlegen fällt mir dies und jenes ein, doch ich bin sicher, dass manches für immer vergessen bleibt. Anderes ist wieder so konturlos und unumrissen, dass ich es ebenso gut als Zufall ansehen kann. Deutlich zeigten sich diese vorfallenden Schatten eigentlich nur einmal …
Es war an einem Herbstnachmittag am Kai des Wiener Donaukanals. Noch flirrte die letzte Sommersonne in der Luft. Altweiberfäden schwebten nachdenklich unter dem weißblauen Himmel, noch gingen die Leute leicht gekleidet über das holprige Pflaster, heiter klang der Lärm der Großstadt durch die Straßen. Es gab damals keine großen Sorgen, die mich drückten, unbeschwert ging ich meiner Wege. Umso unvermittelter traf mich folgende Episode: Ein ältlicher Mann tauchte aus den Passanten vor, ein unscheinbarer Mensch in fadenscheinigem Mantel und abgetretenen Schuhen. Ein Zug von Resignation lag in den fallenden Linien seiner Mundwinkel, er schien müde, vom Schicksal geschlagen. Man sah ihm aber auch an, dass er früher eine stattliche Erscheinung gewesen sein musste – er trug den Kopf hoch und die Schultern gestrafft. Und obwohl nichts Gefährliches oder Furchterregendes an ihm war, fühlte ich mich von seinem Anblick wie gelähmt.
Wie oft sieht man einen Menschen, von dem man weiß, dass man ihn gekannt hat, doch vermag man sich nicht zu besinnen; man hat vergessen, wer er ist, von wo diese Bekanntschaft herrührt. Von solchen Begegnungen bleibt höchstens ein nachdenklicher Gedanke zurück, der bald verblasst. Man geht seiner Dinge weiter nach und denkt nicht mehr daran. Das jetzige Zusammentreffen war viel schwerwiegender, viel nachhaltiger. Es war, wie wenn ein Stachel die schützende Haut wegreißt und schmerzerregend das empfindliche innere Gewebe bloßlegt; mich beschlich das Gefühl einer Schuld, ich hatte das Bewusstsein, selbst Ursache für die weißen Schläfen, für die eingefallenen Wangen des Unbekannten zu sein. Angestrengt versuchte ich, mich von dem Bann zu lösen, dem ich so unheimlich unterworfen war, und ruhig weiterzuschlendern, als wäre nichts geschehen. Da aber traf mich der Strahl der Augen, der Augen eines waidwunden Tieres, und das markante Gesicht wurde zu einem Ausdruck von grenzenlosem Erstaunen. Der mir so Geheimnisvolle musste mich erkannt haben. Schreckliches schien mit mir verstrickt zu sein … Jetzt gab es kein Zögern mehr, ich stürzte los, in die erste beste Nebengasse hinein, mit aller Behändigkeit meiner fünfzehn Jahre, wie von Furien gepeitscht, von Häschern der Hölle gehetzt, rannte, bis ich am Ende meiner Kräfte war und erschöpft und keuchend an einem Randstein lehnte …
Читать дальше