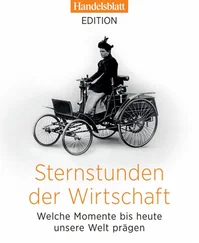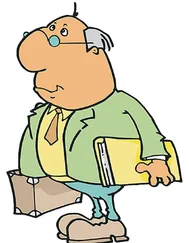Fachliche Kenntnisse der Baumkontrolleure
Die Regelkontrolle durch Sichtprüfung erfordert entsprechend geschulte und praktisch eingearbeitete Kräfte, jedoch nicht den Einsatz von Holz-, Baum- oder Forstfachleuten. Der Baumkontrolleur muss aber über ausreichende Fachkenntnisse verfügen, um die Art und den Umfang von Schäden am Baum erkennen und beurteilen sowie den weiteren Handlungsbedarf einschätzen zu können. Er muss insbesondere beurteilen können, ob eine Verkehrsgefährdung gegeben ist und wie dringlich eine Maßnahme ist. Auch wird verlangt, dass er in der Lage ist, einen Pilzbefall, z. B. durch den Brandkrustenpilz, zu erkennen. Baumkrankheiten müssen ihm geläufig sein. Seine Kenntnisse muss er regelmäßig auf den neuesten Stand bringen. Die insoweit notwendige Fortbildung hat der Vorgesetzte, der Arbeitgeber bzw. Dienstherr dem Baumkontrolleur zu ermöglichen.
Sofern kein Personal mit entsprechenden Fachkenntnissen vorhanden ist, müssen Externe für diese Aufgabe herangezogen werden.
Freie Landschaft und Wald {Wald, Baumkontrolle im}
Nach § 59 BNatSchG ist das Betreten der freien Natur auf Straßen, Wegen und ungenutzten Grundflächen zu Erholungszwecken jedermann gestattet. Gleiches gilt nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BWaldG für das Betreten des Walds. Die Ausübung dieses Rechts erfolgt allerdings auf eigene Gefahr (§ 60 Satz 1 BNatSchG, § 14 Abs. 1 Satz 3 BWaldG i. V. m. den Landeswaldgesetzen). Dies gilt namentlich für naturtypische bzw. waldtypische Gefahren (§ 60 Satz 3 BNatSchG, § 14 Abs. 1 Satz 4 BWaldG). Waldtypisch sind Gefahren, die sich aus der Natur oder der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Walds ergeben. Danach gibt es im Wald insbesondere keine Verpflichtung, die Besucher vor baumtypischen Gefahren zu schützen, z. B. vor Totholz. Insoweit kann keine berechtigte Sicherheitserwartung der Besucher bestehen. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für die Verkehrssicherung von Bäumen an gewidmeten öffentlichen Straßen sind auf private [16]Wege in der freien Landschaft, im Wald und entlang von Waldrändern nicht übertragbar. Regelmäßige Baumkontrollen sind hier den Grundstückseigentümern nicht zumutbar. Gleiches dürfte für markierte private Wege, touristisch beworbene Wege sowie sog. Premiumwanderwege gelten. [17]
Hat der Eigentümer allerdings Kenntnis von einer zeitlich nahen Gefahrenverwirklichung (akute Gefahr) an einem Weg, muss er diese Gefahr beseitigen. Eine Verkehrssicherungspflicht auch für naturtypische bzw. waldtypische Gefahren besteht generell in der Umgebung von Erholungseinrichtungen, wie beispielsweise Ruhebänken, Grillplätzen, Trimm-dich-Pfaden sowie für offiziell eingerichtete Wanderparkplätze. Dort besteht eine Kontrollpflicht in angemessenen Zeitabständen. Die Kontrolltiefe beträgt grundsätzlich eine Baumlänge.
Nach allgemeiner Auffassung besteht eine Verkehrssicherungspflicht nur an Waldaußenrändern, die an gewidmete öffentliche Straßen oder Wege bzw. an Bahnlinien angrenzen sowie bei waldrandnaher Bebauung. Keine Verkehrssicherungspflicht des Waldeigentümers besteht nach dem LG Aachen [18]gegenüber angrenzenden Waldgrundstücken. Dagegen geht das LG Göttingen [19]von einer Verkehrssicherungspflicht an Waldaußenrändern, die an landwirtschaftlich genutzte Grundstücke angrenzen, aus. Jedenfalls sollten Waldeigentümer an solchen Standorten bekannte akute Gefahren beseitigen, v. a. wenn die Gefahr von Personenschäden besteht. [20]
Im Wald sowie in der freien Landschaft haften Grundstückseigentümer nur für unvermutete atypische Gefahren. Atypische Gefahren sind alle nicht durch die Natur oder durch die Art der Bewirtschaftung mehr oder weniger zwangsläufig vorgegebenen Zustände, insbesondere vom Eigentümer geschaffene oder geduldete Gefahren, die ein Erholungssuchender nicht oder nicht rechtzeitig erkennen kann und auf die er sich nicht einzurichten vermag, weil er nicht mit ihnen rechnen muss. Dazu können etwa Forstwegschranken oder nicht gesicherte Holzpolter gehören.
Parkanlagen {Parkanlagen, Baumkontrolle in}
Parkanlagen [21]stehen zwischen domestizierter Stadtlandschaft und freier Landschaft. Eine Verkehrssicherungspflicht besteht in allen Bereichen, in denen ein Verkehr offiziell zugelassen oder faktisch geduldet wird. Das bedeutet, dass sowohl entsprechende Einrichtungen (wie z. B. Ruhebänke) als auch Bäume an diesen Stellen und entlang der Wege sowie an sonstigen Aufenthaltsbereichen (z. B. Liegewiese) zu kontrollieren sind. Totholz oder nicht mehr standsichere Bäume sind insbesondere an Wegen und Aktivitätsschwerpunkten zu entfernen. Eine Differenzierung zwischen gepflegten und naturbelassenen sowie zwischen stark und schwach frequentierten Bereichen ist möglich. Eine Parkanlage kann unterschiedlichen Sicherheitsstufen abhängig von Art und Umfang der Nutzungen zuzuordnen sein.
Dokumentation {Dokumentation, der Baumkontrolle} der Kontrollen
Der Verkehrssicherungspflichtige hat in einer gerichtlichen Auseinandersetzung ggf. nachzuweisen, dass er seiner Verkehrssicherungspflicht inhaltlich und zeitlich nachgekommen ist. Es ist deshalb unabdingbar, dass der Baumkontrolleur die Kontrolle dokumentiert. Dies sollte schriftlich mit Unterschrift geschehen, vorzugsweise mit entsprechenden Formblättern. Alternativ können mobile Erfassungsgeräte (Handhelds) mit speziellen Erfassungsprogrammen verwendet werden. Das Baumkontrollblatt {Baumkontrollblatt} muss bei einer Einzelbaumerfassung mindestens folgende Angaben enthalten:
| • |
Ort (z. B. Straßen-, Parkname) |
| • |
Zeitpunkt der Kontrolle (Datum) |
| • |
beurteilte Bäume (bzw. kontrollierter Bereich) |
| • |
Ergebnis der Kontrolle (festgestellte Schäden oder Auffälligkeiten) |
| • |
weiteres Vorgehen (erforderliche Maßnahmen und Dringlichkeit, d. h. Zeitangabe, bis wann zu erledigen) |
| • |
nächster Kontrollzeitpunkt und Unterschrift des Baumkontrolleurs [22] |
Zudem sollte angegeben werden, wann die veranlasste Maßnahme durch wen ausgeführt wurde. Ergänzend können aufgenommen werden die Baumart, der Stammdurchmesser, die Vitalität und die Baumhöhe (wobei eine Einteilung nach groben Höhenklassen ausreicht, da die Angabe primär Bedeutung für den Einsatz von Hubsteigern hat).
Hinsichtlich des erforderlichen Umfangs der Angaben ist zu unterscheiden: Liegen keine Anzeichen für eine mangelnde Verkehrssicherheit vor, kann die Kontrolle in Form einer Negativkontrolle ohne Einzelbaumerfassung erfolgen. Es werden zwar alle Bäume, die zu kontrollieren sind, einzeln angesprochen. Es werden aber nur die Bäume in das Baumkontrollblatt aufgenommen, bei denen Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Ansonsten reicht ein Festhalten des Orts (Straßen-, Parkname, Spielplatz, Schulgelände, wobei die kontrollierten Bäume bzw. die kontrollierte Fläche eindeutig definiert sein müssen, z. B. durch Markierung oder Schraffierung im Plan) und des Zeitpunkts der Kontrolle mit Unterschrift des Baumkontrolleurs aus. [23]Eine solche Vorgehensweise bietet sich insbesondere bei flächigen Baumbeständen, Alleen, Baumreihen und Waldrändern entlang öffentlicher Straßen an.
Sind an einem Baum jedoch Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit durchzuführen, ist eine Einzelbaumerfassung mit den oben aufgeführten Angaben notwendig.
Es ist anzuraten (insbesondere bei Fehlen eines Baumkatasters), die Bäume, bei denen Maßnahmen notwendig sind, eindeutig zu kennzeichnen (z. B. mit Sprühfarbe oder Plastikmarkierungen), damit sie anschließend problemlos wiedergefunden werden können.
Der Kontrolleur muss im Rahmen seiner Dokumentation entsprechende Zeitvorgaben machen, bis wann die erforderlichen Maßnahmen (auch eingehende Untersuchungen) durchzuführen sind. Die Dringlichkeit der Maßnahmen kann z. B. in den Stufen „sofort“ (nur sehr selten relevant), „umgehend innerhalb von zwei Wochen“, „innerhalb von sechs Monaten“ oder „innerhalb der nächsten zwei Jahre“ festgelegt werden. Die Baumkontrollrichtlinien (Ausgabe 2020) [24]schlagen vor: „unverzüglich“ (i. S. v. § 121 BGB, dies könne im Einzelfall „sofort“ i. S. v. „umgehend“ sein, aber auch innerhalb eines Tages oder sogar erst innerhalb einer Woche), „innerhalb von sechs Wochen“, „innerhalb von sechs Monaten“, „innerhalb des nächsten Jahres bzw. bis zur nächsten Regelkontrolle“. Bei der Festlegung sind v. a. die vom Zustand des Baums ausgehende Gefahr für Personen und Sachen sowie die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu berücksichtigen. Totholz ist bei Straßenbäumen nach der Rechtsprechung [25]unverzüglich, jedenfalls innerhalb von drei Monaten [26]zu entfernen.
Читать дальше